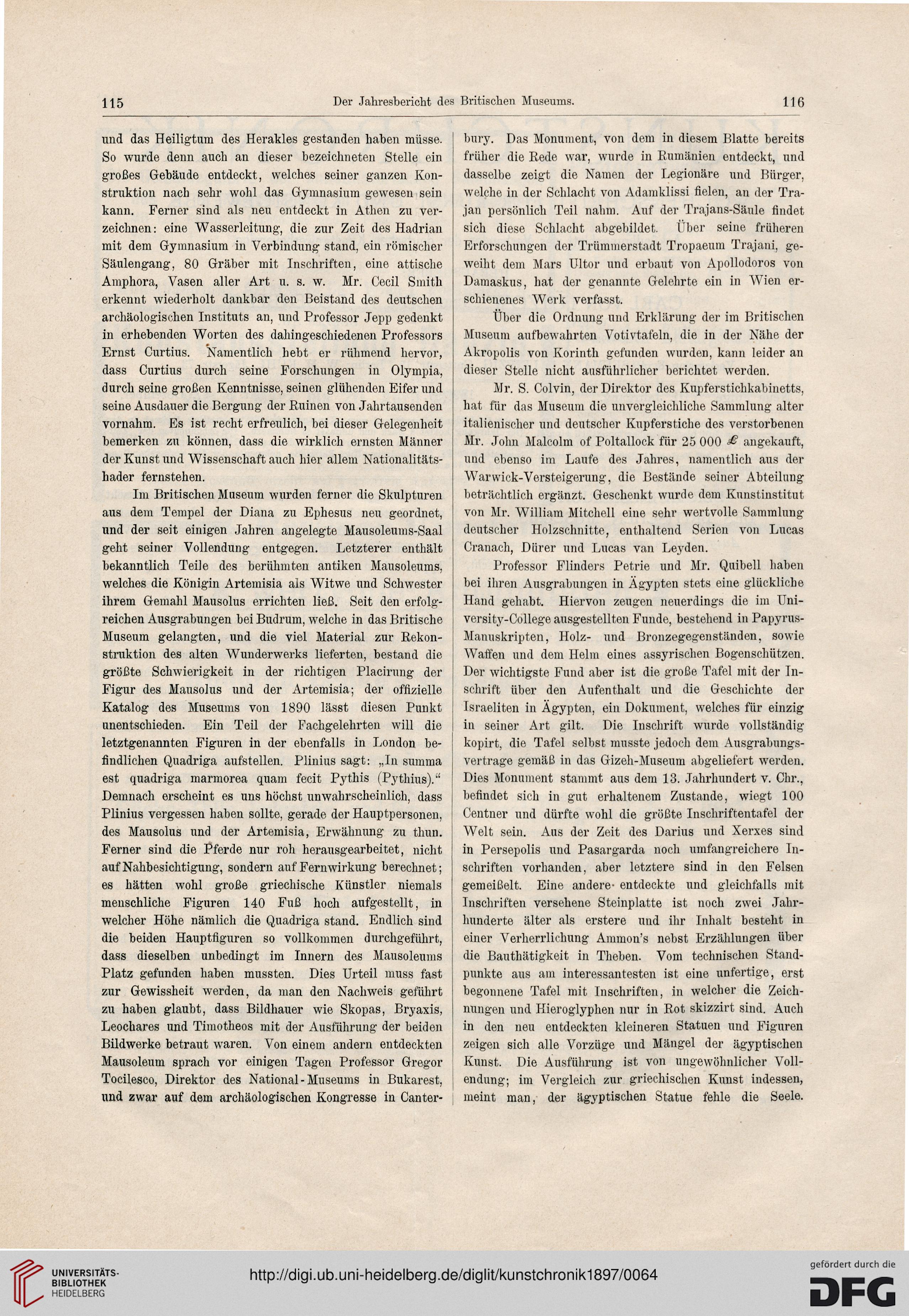115
Der Jahresbericht des Britischen Museums.
116
und das Heiligtum des Herakles gestanden haben müsse.
So wurde denn auch an dieser bezeichneten Stelle ein
großes Gebäude entdeckt, welches seiner ganzen Kon-
struktion nach sehr wohl das Gymnasium gewesen sein
kann. Ferner sind als neu entdeckt in Athen zu ver-
zeichnen: eine Wasserleitung, die zur Zeit des Hadrian
mit dem Gymnasium in Verbindung stand, ein römischer
Säulengang, 80 Gräber mit Inschriften, eine attische
Amphora, Vasen aller Art u. s. w. Mr. Cecil Smith
erkennt wiederholt dankbar den Beistand des deutschen
archäologischen Instituts an, und Professor Jepp gedenkt
in erhebenden Worten des dahingeschiedenen Professors
Ernst Curtius. Namentlich hebt er rühmend hervor,
dass Curtius durch seine Forschungen in Olympia,
durch seine großen Kenntnisse, seinen glühenden Eifer und
seine Ausdauer die Bergung der Kuinen von Jahrtausenden
vornahm. Es ist recht erfreulich, bei dieser Gelegenheit
bemerken zu können, dass die wirklich ernsten Männer
der Kunst und Wissenschaft auch hier allem Nationalitäts-
hader fernstehen.
Im Britischen Museum wurden ferner die Skulpturen
aus dem Tempel der Diana zu Ephesus neu geordnet,
und der seit einigen Jahren angelegte Mausoleums-Saal
geht seiner Vollendung entgegen. Letzterer enthält
bekanntlich Teile des berühmten antiken Mausoleums,
welches die Königin Artemisia als Witwe und Schwester
ihrem Gemahl Mausolus errichten ließ. Seit den erfolg-
reichen Ausgrabungen bei Budrum, welche in das Britische
Museum gelangten, und die viel Material zur Rekon-
struktion des alten Wunderwerks lieferten, bestand die
größte Schwierigkeit in der richtigen Placirung der
Figur des Mausolus und der Artemisia; der offizielle
Katalog des Museums von 1890 lässt diesen Punkt
unentschieden. Ein Teil der Fachgelehrten will die
letztgenannten Figuren in der ebenfalls in London be-
findlichen Quadriga aufstellen. Plinius sagt: „In summa
est quadriga marmorea quam fecit Pythis (Pythius)."
Demnach erscheint es uns höchst unwahrscheinlich, dass
Plinius vergessen haben sollte, gerade der Hauptpersonen,
des Mausolus und der Artemisia, Erwähnung zu thun.
Ferner sind die Pferde nur roh herausgearbeitet, nicht
auf'Nahbesiclitigung, sondern auf Fern Wirkung berechnet;
es hätten wohl große griechische Künstler niemals
menschliche Figuren 140 Fuß hoch aufgestellt, in
welcher Höhe nämlich die Quadriga stand. Endlich sind
die beiden Hauptfiguren so vollkommen durchgeführt,
dass dieselben unbedingt im Innern des Mausoleums
Platz gefunden haben mussten. Dies Urteil muss fast
zur Gewissheit werden, da man den Nachweis geführt
zu haben glaubt, dass Bildhauer wie Skopas, Bryaxis,
Leochares und Timotheos mit der Ausführung der beiden
Bildwerke betraut waren. Von einem andern entdeckten
Mausoleum sprach vor einigen Tagen Professor Gregor
Tocilesco, Direktor des National-Museums in Bukarest,
und zwar auf dem archäologischen Kongresse in Canter-
bury. Das Monument, von dem in diesem Blatte bereits
früher die Rede war, wurde in Rumänien entdeckt, und
dasselbe zeigt die Namen der Legionäre und Bürger,
welche in der Schlacht von Adamklissi fielen, an der Tra-
jan persönlich Teil nahm. Auf der Trajans-Säule findet
sich diese Schlacht abgebildet. Über seine früheren
Erforschungen der Trümmerstadt Tropaeum Trajani, ge-
weiht dem Mars Ultor und erbaut von Apollodoros von
Damaskus, hat der genannte Gelehrte ein in Wien er-
schienenes Werk verfasst.
Über die Ordnung und Erklärung der im Britischen
Museum aufbewahrten Votivtafeln, die in der Nähe der
Akropolis von Korinth gefunden wurden, kann leider an
dieser Stelle nicht ausführlicher berichtet werden.
Mr. S. Colvin, der Direktor des Kupferstichkabinetts,
hat für das Museum die unvergleichliche Sammlung alter
italienischer und deutscher Kupferstiche des verstorbenen
Mr. John Malcolm of Poltallock für 25 000 £ angekauft,
und ebenso im Laufe des Jahres, namentlich aus der
Warwick-Versteigerung, die Bestände seiner Abteilung
beträchtlich ergänzt. Geschenkt wurde dem Kunstinstitut
von Mr. William Mitchell eine sehr wertvolle Sammlung
deutscher Holzschnitte, enthaltend Serien von Lucas
Cranach, Dürer und Lucas van Leyden.
I'rofessor Flinders Petrie und Mr. Quibell haben
bei ihren Ausgrabungen in Ägypten stets eine glückliche
Hand gehabt. Hiervon zeugen neuerdings die im Uni-
versity-College ausgestellten Funde, bestehend in Papyrus-
Manuskripten, Holz- und Bronzegegenständen, sowie
Waffen und dem Helm eines assyrischen Bogenschützen.
Der wichtigste Fund aber ist die große Tafel mit der In-
schrift über den Aufenthalt und die Geschichte der
Israeliten in Ägypten, ein Dokument, welches für einzig
in seiner Art gilt. Die Inschrift wurde vollständig
kopirt, die Tafel selbst musste jedoch dem Ausgrabungs-
vertrage gemäß in das Gizeh-Museum abgeliefert werden.
Dies Monument stammt aus dem 13. Jahrhundert v. Chr.,
befindet sich in gut erhaltenem Zustande, wiegt 100
Centner und dürfte wohl die größte Inschriftentafel der
Welt sein. Aus der Zeit des Darius und Xerxes sind
in Persepolis und Pasargarda noch umfangreichere In-
schriften vorhanden, aber letztere sind in den Felsen
gemeißelt. Eine andere- entdeckte und gleichfalls mit
Inschriften versehene Steinplatte ist noch zwei Jahr-
hunderte älter als erstere und ihr Inhalt besteht in
einer Verherrlichung Ammon's nebst Erzählungen über
die Bauthätigkeit in Theben. Vom technischen Stand-
punkte aus am interessantesten ist eine unfertige, erst
begonnene Tafel mit Inschriften, in welcher die Zeich-
nungen und Hieroglyphen nur in Rot skizzirt sind. Auch
in den neu entdeckten kleineren Statuen und Figuren
zeigen sich alle Vorzüge und Mängel der ägyptischen
Kunst. Die Ausführung ist von ungewöhnlicher Voll-
endung; im Vergleich zur griechischen Kunst indessen,
nieint man, der ägyptischen Statue fehle die Seele.
Der Jahresbericht des Britischen Museums.
116
und das Heiligtum des Herakles gestanden haben müsse.
So wurde denn auch an dieser bezeichneten Stelle ein
großes Gebäude entdeckt, welches seiner ganzen Kon-
struktion nach sehr wohl das Gymnasium gewesen sein
kann. Ferner sind als neu entdeckt in Athen zu ver-
zeichnen: eine Wasserleitung, die zur Zeit des Hadrian
mit dem Gymnasium in Verbindung stand, ein römischer
Säulengang, 80 Gräber mit Inschriften, eine attische
Amphora, Vasen aller Art u. s. w. Mr. Cecil Smith
erkennt wiederholt dankbar den Beistand des deutschen
archäologischen Instituts an, und Professor Jepp gedenkt
in erhebenden Worten des dahingeschiedenen Professors
Ernst Curtius. Namentlich hebt er rühmend hervor,
dass Curtius durch seine Forschungen in Olympia,
durch seine großen Kenntnisse, seinen glühenden Eifer und
seine Ausdauer die Bergung der Kuinen von Jahrtausenden
vornahm. Es ist recht erfreulich, bei dieser Gelegenheit
bemerken zu können, dass die wirklich ernsten Männer
der Kunst und Wissenschaft auch hier allem Nationalitäts-
hader fernstehen.
Im Britischen Museum wurden ferner die Skulpturen
aus dem Tempel der Diana zu Ephesus neu geordnet,
und der seit einigen Jahren angelegte Mausoleums-Saal
geht seiner Vollendung entgegen. Letzterer enthält
bekanntlich Teile des berühmten antiken Mausoleums,
welches die Königin Artemisia als Witwe und Schwester
ihrem Gemahl Mausolus errichten ließ. Seit den erfolg-
reichen Ausgrabungen bei Budrum, welche in das Britische
Museum gelangten, und die viel Material zur Rekon-
struktion des alten Wunderwerks lieferten, bestand die
größte Schwierigkeit in der richtigen Placirung der
Figur des Mausolus und der Artemisia; der offizielle
Katalog des Museums von 1890 lässt diesen Punkt
unentschieden. Ein Teil der Fachgelehrten will die
letztgenannten Figuren in der ebenfalls in London be-
findlichen Quadriga aufstellen. Plinius sagt: „In summa
est quadriga marmorea quam fecit Pythis (Pythius)."
Demnach erscheint es uns höchst unwahrscheinlich, dass
Plinius vergessen haben sollte, gerade der Hauptpersonen,
des Mausolus und der Artemisia, Erwähnung zu thun.
Ferner sind die Pferde nur roh herausgearbeitet, nicht
auf'Nahbesiclitigung, sondern auf Fern Wirkung berechnet;
es hätten wohl große griechische Künstler niemals
menschliche Figuren 140 Fuß hoch aufgestellt, in
welcher Höhe nämlich die Quadriga stand. Endlich sind
die beiden Hauptfiguren so vollkommen durchgeführt,
dass dieselben unbedingt im Innern des Mausoleums
Platz gefunden haben mussten. Dies Urteil muss fast
zur Gewissheit werden, da man den Nachweis geführt
zu haben glaubt, dass Bildhauer wie Skopas, Bryaxis,
Leochares und Timotheos mit der Ausführung der beiden
Bildwerke betraut waren. Von einem andern entdeckten
Mausoleum sprach vor einigen Tagen Professor Gregor
Tocilesco, Direktor des National-Museums in Bukarest,
und zwar auf dem archäologischen Kongresse in Canter-
bury. Das Monument, von dem in diesem Blatte bereits
früher die Rede war, wurde in Rumänien entdeckt, und
dasselbe zeigt die Namen der Legionäre und Bürger,
welche in der Schlacht von Adamklissi fielen, an der Tra-
jan persönlich Teil nahm. Auf der Trajans-Säule findet
sich diese Schlacht abgebildet. Über seine früheren
Erforschungen der Trümmerstadt Tropaeum Trajani, ge-
weiht dem Mars Ultor und erbaut von Apollodoros von
Damaskus, hat der genannte Gelehrte ein in Wien er-
schienenes Werk verfasst.
Über die Ordnung und Erklärung der im Britischen
Museum aufbewahrten Votivtafeln, die in der Nähe der
Akropolis von Korinth gefunden wurden, kann leider an
dieser Stelle nicht ausführlicher berichtet werden.
Mr. S. Colvin, der Direktor des Kupferstichkabinetts,
hat für das Museum die unvergleichliche Sammlung alter
italienischer und deutscher Kupferstiche des verstorbenen
Mr. John Malcolm of Poltallock für 25 000 £ angekauft,
und ebenso im Laufe des Jahres, namentlich aus der
Warwick-Versteigerung, die Bestände seiner Abteilung
beträchtlich ergänzt. Geschenkt wurde dem Kunstinstitut
von Mr. William Mitchell eine sehr wertvolle Sammlung
deutscher Holzschnitte, enthaltend Serien von Lucas
Cranach, Dürer und Lucas van Leyden.
I'rofessor Flinders Petrie und Mr. Quibell haben
bei ihren Ausgrabungen in Ägypten stets eine glückliche
Hand gehabt. Hiervon zeugen neuerdings die im Uni-
versity-College ausgestellten Funde, bestehend in Papyrus-
Manuskripten, Holz- und Bronzegegenständen, sowie
Waffen und dem Helm eines assyrischen Bogenschützen.
Der wichtigste Fund aber ist die große Tafel mit der In-
schrift über den Aufenthalt und die Geschichte der
Israeliten in Ägypten, ein Dokument, welches für einzig
in seiner Art gilt. Die Inschrift wurde vollständig
kopirt, die Tafel selbst musste jedoch dem Ausgrabungs-
vertrage gemäß in das Gizeh-Museum abgeliefert werden.
Dies Monument stammt aus dem 13. Jahrhundert v. Chr.,
befindet sich in gut erhaltenem Zustande, wiegt 100
Centner und dürfte wohl die größte Inschriftentafel der
Welt sein. Aus der Zeit des Darius und Xerxes sind
in Persepolis und Pasargarda noch umfangreichere In-
schriften vorhanden, aber letztere sind in den Felsen
gemeißelt. Eine andere- entdeckte und gleichfalls mit
Inschriften versehene Steinplatte ist noch zwei Jahr-
hunderte älter als erstere und ihr Inhalt besteht in
einer Verherrlichung Ammon's nebst Erzählungen über
die Bauthätigkeit in Theben. Vom technischen Stand-
punkte aus am interessantesten ist eine unfertige, erst
begonnene Tafel mit Inschriften, in welcher die Zeich-
nungen und Hieroglyphen nur in Rot skizzirt sind. Auch
in den neu entdeckten kleineren Statuen und Figuren
zeigen sich alle Vorzüge und Mängel der ägyptischen
Kunst. Die Ausführung ist von ungewöhnlicher Voll-
endung; im Vergleich zur griechischen Kunst indessen,
nieint man, der ägyptischen Statue fehle die Seele.