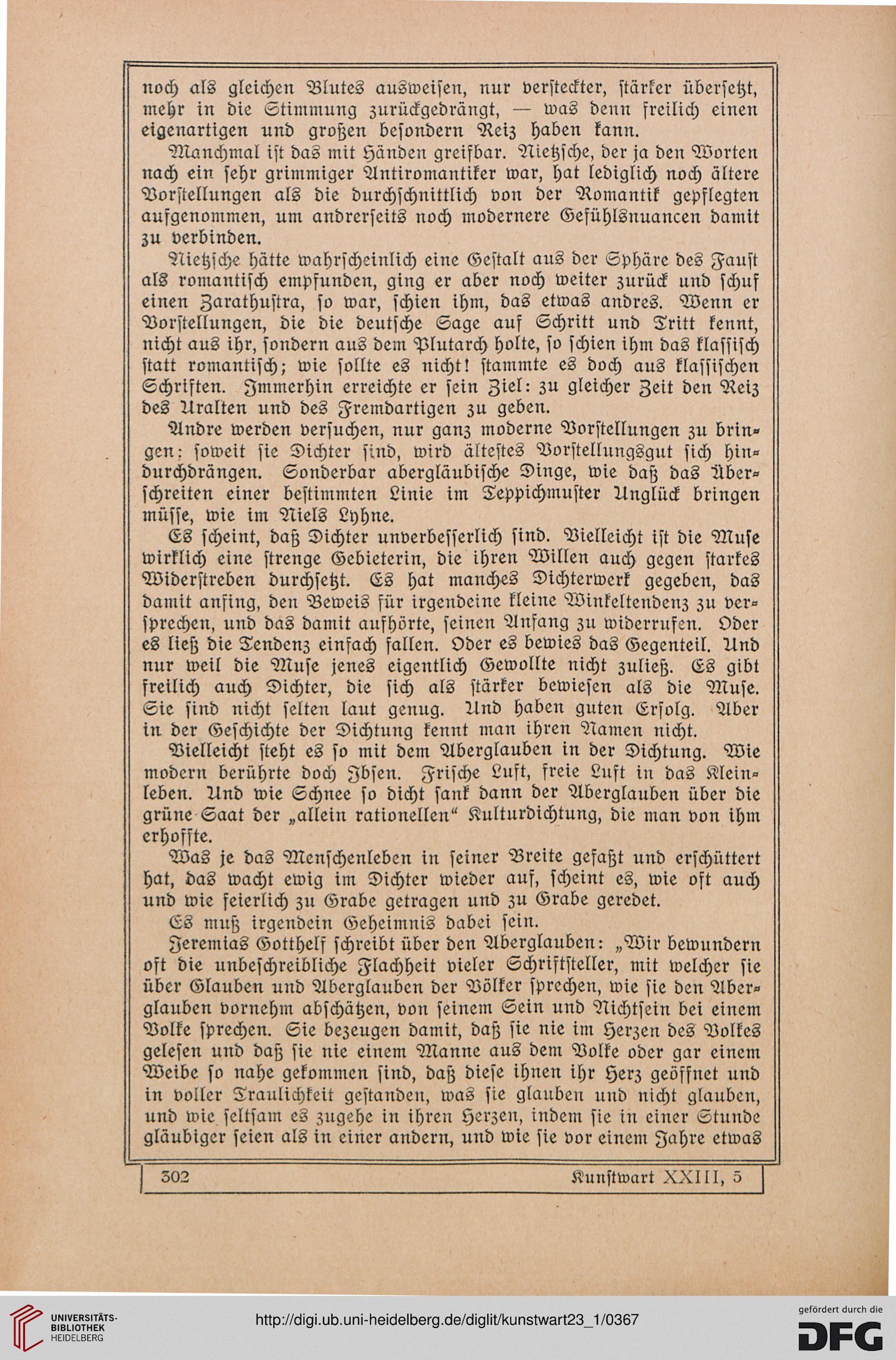noch als gleichen Blutes ausweisen, nur versteckter, stärker übersetzt,
mehr in die Stimmung zurückgedrängt, — was denn freilich einen
eigenartigen und grojzen besondern Reiz haben kann.
Manchmal ist das mit Händen greifbar. Nietzsche, der ja den Worten
nach ein sehr grimmiger Antiromantiker war, hat lediglich noch ältere
Vorstellungen als die durchschnittlich von der Romantik gepflegten
aufgenommen, um andrerseits noch modernere Gefühlsnuancen damit
zu verbinden.
Nietzsche hätte wahrscheinlich eine Gestalt aus der Sphäre des Faust
als romantisch empfunden, ging er aber noch weiter zurück und schuf
einen Zarathustra, so war, schien ihm, das etwas andres. Wenn er
Vorstellungen, die die deutsche Sage auf Schritt und Tritt kennt,
nicht aus ihr, soudern aus dem Plutarch holte, so schien ihm das klassisch
statt romantisch; wie sollte es nicht! stammte es doch aus klassischen
Schriften. Immerhin erreichte er sein Ziel: zu gleicher Zeit den Reiz
des Uralten und des Fremdartigen zu geben.
Andre werden versuchen, nur ganz moderne Vorstellungen zu brin-
gen: soweit sie Dichter sind, wird Lltestes Vorstellungsgut sich hin-
durchdrängen. Sonderbar abergläubische Dinge, wie daß das Äber-
schreiten einer bestimmten Linie im Teppichmuster Unglück bringen
müsse, wie im Niels Lyhne.
Es scheint, daß Dichter unverbesserlich sind. Vielleicht ist die Muse
wirklich eine strenge Gebieterin, die ihren Willen auch gegen starkes
Widerstreben durchsetzt. Es hat manches Dichterwerk gegeben, das
damit anfing, den Beweis für irgendeine kleine Winkeltendenz zu vcr-
sprechen, und das damit aufhörte, seincn Anfang zu widerrufen. Oder
es ließ die Tendcnz einfach fallen. Oder es bewies das Gegenteil. Nnd
nur weil die Muse jenes eigentlich Gewollte nicht zuließ. Es gibt
freilich auch Dichter, die sich als stärker bewiesen als die Muse.
Sie sind nicht selten laut genug. And haben guten Ersolg. Aber
in der Geschichte der Dichtung kennt man ihren Namen nicht.
Vielleicht steht es so mit dem Aberglauben in der Dichtung. Wie
modcrn berührte doch Ibsen. Frische Luft, freie Luft in das Klein-
leben. And wie Schnee so dicht sank dann der Aberglauben über die
grüne Saat der „allein rationellen" Kulturdichtung, die man von ihm
erhoffte.
Was je das Menschenleben in seiner Breite gefaßt und erschüttert
hat, das wacht ewig im Dichter wieder auf, scheint es, wie oft auch
und wie feierlich zu Grabe getragen und zu Grabe geredet.
Es muß irgendein Geheimnis dabei scin.
Ieremias Gotthelf schreibt über den Aberglauben: „Wir bewundern
oft die unbeschreibliche Flachheit vieler Schriftsteller, mit welcher sie
über Glauben und Aberglauben der Völker sprechen, wie sie den Aber-
glauben vornehm abschätzen, von seinem Sein und Nichtsein bei einem
Volke sprechen. Sie bezeugen damit, daß sie nie im Herzen des Volkes
gelesen und daß sie nie einem Manne aus dem Volke oder gar einem
Weibe so nahe gekommen sind, daß diese ihnen ihr Herz geöffnet und
in voller Traulichkeit gestandeu, was sie glauben und nicht glauben,
und wie seltsam es zugehe in ihren Herzen, indem sie in einer Stunde
gläubiger seien als in einer andern, und wie sie vor einem Iahre etwas
302 Kunstwart XXIII, 5
mehr in die Stimmung zurückgedrängt, — was denn freilich einen
eigenartigen und grojzen besondern Reiz haben kann.
Manchmal ist das mit Händen greifbar. Nietzsche, der ja den Worten
nach ein sehr grimmiger Antiromantiker war, hat lediglich noch ältere
Vorstellungen als die durchschnittlich von der Romantik gepflegten
aufgenommen, um andrerseits noch modernere Gefühlsnuancen damit
zu verbinden.
Nietzsche hätte wahrscheinlich eine Gestalt aus der Sphäre des Faust
als romantisch empfunden, ging er aber noch weiter zurück und schuf
einen Zarathustra, so war, schien ihm, das etwas andres. Wenn er
Vorstellungen, die die deutsche Sage auf Schritt und Tritt kennt,
nicht aus ihr, soudern aus dem Plutarch holte, so schien ihm das klassisch
statt romantisch; wie sollte es nicht! stammte es doch aus klassischen
Schriften. Immerhin erreichte er sein Ziel: zu gleicher Zeit den Reiz
des Uralten und des Fremdartigen zu geben.
Andre werden versuchen, nur ganz moderne Vorstellungen zu brin-
gen: soweit sie Dichter sind, wird Lltestes Vorstellungsgut sich hin-
durchdrängen. Sonderbar abergläubische Dinge, wie daß das Äber-
schreiten einer bestimmten Linie im Teppichmuster Unglück bringen
müsse, wie im Niels Lyhne.
Es scheint, daß Dichter unverbesserlich sind. Vielleicht ist die Muse
wirklich eine strenge Gebieterin, die ihren Willen auch gegen starkes
Widerstreben durchsetzt. Es hat manches Dichterwerk gegeben, das
damit anfing, den Beweis für irgendeine kleine Winkeltendenz zu vcr-
sprechen, und das damit aufhörte, seincn Anfang zu widerrufen. Oder
es ließ die Tendcnz einfach fallen. Oder es bewies das Gegenteil. Nnd
nur weil die Muse jenes eigentlich Gewollte nicht zuließ. Es gibt
freilich auch Dichter, die sich als stärker bewiesen als die Muse.
Sie sind nicht selten laut genug. And haben guten Ersolg. Aber
in der Geschichte der Dichtung kennt man ihren Namen nicht.
Vielleicht steht es so mit dem Aberglauben in der Dichtung. Wie
modcrn berührte doch Ibsen. Frische Luft, freie Luft in das Klein-
leben. And wie Schnee so dicht sank dann der Aberglauben über die
grüne Saat der „allein rationellen" Kulturdichtung, die man von ihm
erhoffte.
Was je das Menschenleben in seiner Breite gefaßt und erschüttert
hat, das wacht ewig im Dichter wieder auf, scheint es, wie oft auch
und wie feierlich zu Grabe getragen und zu Grabe geredet.
Es muß irgendein Geheimnis dabei scin.
Ieremias Gotthelf schreibt über den Aberglauben: „Wir bewundern
oft die unbeschreibliche Flachheit vieler Schriftsteller, mit welcher sie
über Glauben und Aberglauben der Völker sprechen, wie sie den Aber-
glauben vornehm abschätzen, von seinem Sein und Nichtsein bei einem
Volke sprechen. Sie bezeugen damit, daß sie nie im Herzen des Volkes
gelesen und daß sie nie einem Manne aus dem Volke oder gar einem
Weibe so nahe gekommen sind, daß diese ihnen ihr Herz geöffnet und
in voller Traulichkeit gestandeu, was sie glauben und nicht glauben,
und wie seltsam es zugehe in ihren Herzen, indem sie in einer Stunde
gläubiger seien als in einer andern, und wie sie vor einem Iahre etwas
302 Kunstwart XXIII, 5