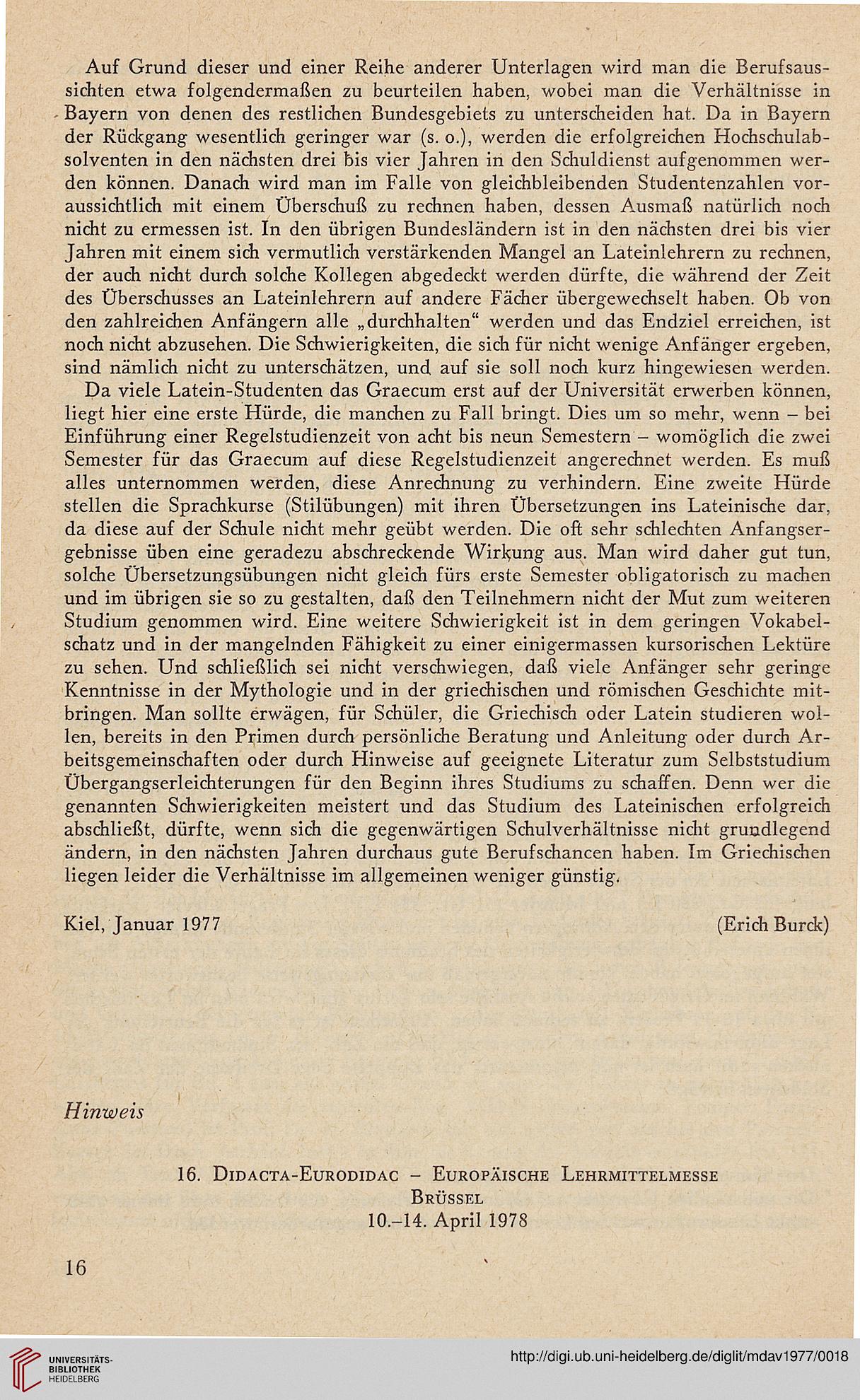Auf Grund dieser und einer Reihe anderer Unterlagen wird man die Berufsaus-
sichten etwa folgendermaßen zu beurteilen haben, wobei man die Verhältnisse in
Bayern von denen des restlichen Bundesgebiets zu unterscheiden hat. Da in Bayern
der Rückgang wesentlich geringer war (s. o.), werden die erfolgreichen Hochschulab-
solventen in den nächsten drei bis vier Jahren in den Schuldienst aufgenommen wer-
den können. Danach wird man im Falle von gleichbleibenden Studentenzahlen vor-
aussichtlich mit einem Überschuß zu rechnen haben, dessen Ausmaß natürlich noch
nicht zu ermessen ist. In den übrigen Bundesländern ist in den nächsten drei bis vier
Jahren mit einem sich vermutlich verstärkenden Mangel an Lateinlehrern zu rechnen,
der auch nicht durch solche Kollegen abgedeckt werden dürfte, die während der Zeit
des Überschusses an Lateinlehrern auf andere Fächer übergewechselt haben. Ob von
den zahlreichen Anfängern alle „durchhalten“ werden und das Endziel erreichen, ist
noch nicht abzusehen. Die Schwierigkeiten, die sich für nicht wenige Anfänger ergeben,
sind nämlich nicht zu unterschätzen, und auf sie soll noch kurz hingewiesen werden.
Da viele Latein-Studenten das Graecum erst auf der Universität erwerben können,
liegt hier eine erste Hürde, die manchen zu Fall bringt. Dies um so mehr, wenn - bei
Einführung einer Regelstudienzeit von acht bis neun Semestern - womöglich die zwei
Semester für das Graecum auf diese Regelstudienzeit angerechnet werden. Es muß
alles unternommen werden, diese Anrechnung zu verhindern. Eine zweite Hürde
stellen die Sprachkurse (Stilübungen) mit ihren Übersetzungen ins Lateinische dar,
da diese auf der Schule nicht mehr geübt werden. Die oft sehr schlechten Anfangser-
gebnisse üben eine geradezu abschreckende Wirkung aus. Man wird daher gut tun,
solche Übersetzungsübungen nicht gleich fürs erste Semester obligatorisch zu machen
und im übrigen sie so zu gestalten, daß den Teilnehmern nicht der Mut zum weiteren
Studium genommen wird. Eine weitere Schwierigkeit ist in dem geringen Vokabel-
schatz und in der mangelnden Fähigkeit zu einer einigermassen kursorischen Lektüre
zu sehen. Und schließlich sei nicht verschwiegen, daß viele Anfänger sehr geringe
Kenntnisse in der Mythologie und in der griechischen und römischen Geschichte mit-
bringen. Man sollte erwägen, für Schüler, die Griechisch oder Latein studieren wol-
len, bereits in den Primen durch persönliche Beratung und Anleitung oder durch Ar-
beitsgemeinschaften oder durch Hinweise auf geeignete Literatur zum Selbststudium
Übergangserleichterungen für den Beginn ihres Studiums zu schaffen. Denn wer die
genannten Schwierigkeiten meistert und das Studium des Lateinischen erfolgreich
abschließt, dürfte, wenn sich die gegenwärtigen Schulverhältnisse nicht grundlegend
ändern, in den nächsten Jahren durchaus gute Berufschancen haben. Im Griechischen
liegen leider die Verhältnisse im allgemeinen weniger günstig.
Kiel, Januar 1977 (Erich Burck)
Hinweis
16. Didacta-Eurodidac - Europäische Lehrmittelmesse
Brüssel
10.-14. April 1978
16
sichten etwa folgendermaßen zu beurteilen haben, wobei man die Verhältnisse in
Bayern von denen des restlichen Bundesgebiets zu unterscheiden hat. Da in Bayern
der Rückgang wesentlich geringer war (s. o.), werden die erfolgreichen Hochschulab-
solventen in den nächsten drei bis vier Jahren in den Schuldienst aufgenommen wer-
den können. Danach wird man im Falle von gleichbleibenden Studentenzahlen vor-
aussichtlich mit einem Überschuß zu rechnen haben, dessen Ausmaß natürlich noch
nicht zu ermessen ist. In den übrigen Bundesländern ist in den nächsten drei bis vier
Jahren mit einem sich vermutlich verstärkenden Mangel an Lateinlehrern zu rechnen,
der auch nicht durch solche Kollegen abgedeckt werden dürfte, die während der Zeit
des Überschusses an Lateinlehrern auf andere Fächer übergewechselt haben. Ob von
den zahlreichen Anfängern alle „durchhalten“ werden und das Endziel erreichen, ist
noch nicht abzusehen. Die Schwierigkeiten, die sich für nicht wenige Anfänger ergeben,
sind nämlich nicht zu unterschätzen, und auf sie soll noch kurz hingewiesen werden.
Da viele Latein-Studenten das Graecum erst auf der Universität erwerben können,
liegt hier eine erste Hürde, die manchen zu Fall bringt. Dies um so mehr, wenn - bei
Einführung einer Regelstudienzeit von acht bis neun Semestern - womöglich die zwei
Semester für das Graecum auf diese Regelstudienzeit angerechnet werden. Es muß
alles unternommen werden, diese Anrechnung zu verhindern. Eine zweite Hürde
stellen die Sprachkurse (Stilübungen) mit ihren Übersetzungen ins Lateinische dar,
da diese auf der Schule nicht mehr geübt werden. Die oft sehr schlechten Anfangser-
gebnisse üben eine geradezu abschreckende Wirkung aus. Man wird daher gut tun,
solche Übersetzungsübungen nicht gleich fürs erste Semester obligatorisch zu machen
und im übrigen sie so zu gestalten, daß den Teilnehmern nicht der Mut zum weiteren
Studium genommen wird. Eine weitere Schwierigkeit ist in dem geringen Vokabel-
schatz und in der mangelnden Fähigkeit zu einer einigermassen kursorischen Lektüre
zu sehen. Und schließlich sei nicht verschwiegen, daß viele Anfänger sehr geringe
Kenntnisse in der Mythologie und in der griechischen und römischen Geschichte mit-
bringen. Man sollte erwägen, für Schüler, die Griechisch oder Latein studieren wol-
len, bereits in den Primen durch persönliche Beratung und Anleitung oder durch Ar-
beitsgemeinschaften oder durch Hinweise auf geeignete Literatur zum Selbststudium
Übergangserleichterungen für den Beginn ihres Studiums zu schaffen. Denn wer die
genannten Schwierigkeiten meistert und das Studium des Lateinischen erfolgreich
abschließt, dürfte, wenn sich die gegenwärtigen Schulverhältnisse nicht grundlegend
ändern, in den nächsten Jahren durchaus gute Berufschancen haben. Im Griechischen
liegen leider die Verhältnisse im allgemeinen weniger günstig.
Kiel, Januar 1977 (Erich Burck)
Hinweis
16. Didacta-Eurodidac - Europäische Lehrmittelmesse
Brüssel
10.-14. April 1978
16