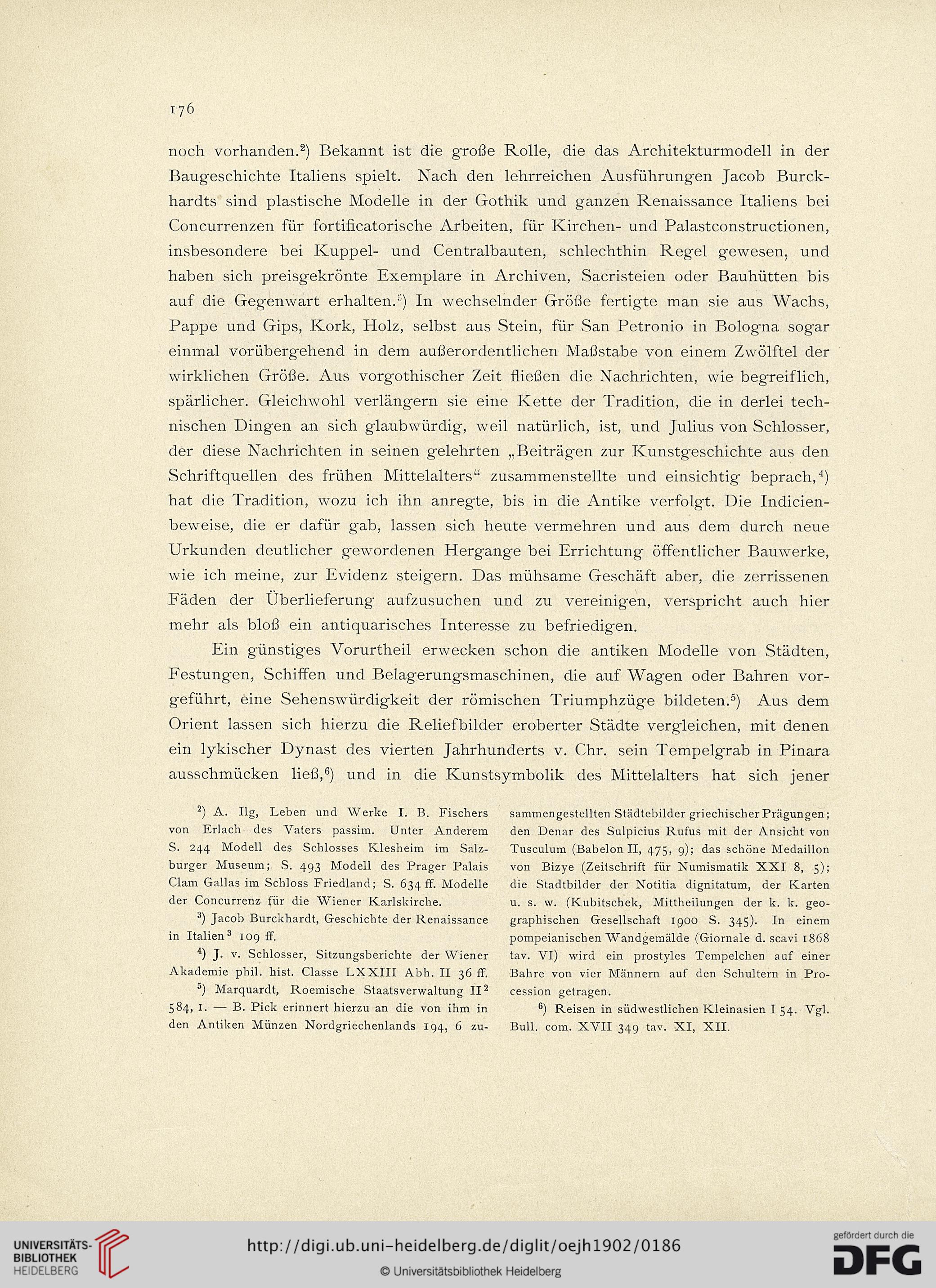176
noch vorhanden. 2) Bekannt ist die große Rolle, die das Architekturmodell in der
Baugeschichte Italiens spielt. Nach den lehrreichen Ausführungen Jacob Burck-
hardts sind plastische Modelle in der Gothik und ganzen Renaissance Italiens bei
Concurrenzen für fortificatorische Arbeiten, für Kirchen- und Palastconstructionen,
insbesondere bei Kuppel- und Centralbauten, schlechthin Regel gewesen, und
haben sich preisgekrönte Exemplare in Archiven, Sacristeien oder Bauhütten bis
auf die Gegenwart erhalten.") ln wechselnder Größe fertigte man sie aus Wachs,
Pappe und Gips, Kork, Holz, selbst aus Stein, fiir San Petronio in Bologna sogar
einmal vorübergehend in dem außerordentlichen Maßstabe von einem Zwölftel der
wirklichen Größe. Aus vorgothischer Zeit fließen die Nachrichten, wie begreiflicli,
spärlicher. Gleichwohl verlängern sie eine Kette der Tradition, die in derlei tech-
nischen Dingen an sich glaubwürdig, weil natürlich, ist, und Julius von Schlosser,
der diese Nachrichten in seinen gelehrten „Beiträgen zur Kunstgeschichte aus den
Schriftquellen des frühen Mittelalters“ zusammenstellte und einsichtig beprach, 4)
hat die Tradition, wozu ich ihn anregte, bis in die Antike verfolgt. Die Indicien-
beweise, die er dafür gab, lassen sich heute vermehren und aus dem durch neue
Urkunden deutlicher gewordenen Hergange bei Errichtung öffentlicher Bauwerke,
wie ich meine, zur Evidenz steigern. Das mühsame Geschäft aber, die zerrissenen
Fäden der Uberlieferung aufzusuchen und zu vereinigen, verspricht auch hier
mehr als bloß ein antiquarisches Jnteresse zu befriedigen.
Ein günstiges Vorurtheil erwecken schon die antiken Modelle von Städten,
Festungen, Schiffen und Belagerungsmaschinen, die auf Wagen oder Bahren vor-
geführt, eine Sehenswiirdigkeit der römischen Triumphzüge bildeten. 5) Aus dem
Orient lassen sich hierzu die Reliefbilder eroberter Städte verg'leichen, mit denen
ein lykischer Dynast des vierten Jahrhunderts v. Chr. sein Tempelgrab in Pinara
ausschmücken ließ, 6) und in die Kunstsymbolik des Mittelalters hat sich jener
2) A. Ilg, Leben und Werke I. B. Fischers
von Erlach des Vaters passim. Unter Anderem
S. 244 Modell des Schlosses Klesheim im Salz-
burger Museum; S. 493 Modell des Prager Palais
Clam Gallas im Schloss Friedland; S. 634 ff. Modelle
der Concurrenz fiir die Wiener Karlskirche.
3) Jacob Burckhardt, Geschichte der Renaissance
in Italien 3 109 ff.
4) J. v. Schlosser, Sitzungsberichte der Wiener
Akademie phil. hist. Classe LXXIII Abh. II 36 ff.
5) Marquardt, Roemische Staatsverwaltung II 2
584, I. — B. Pick erinnert hierzu an die von ihm in
den Antiken Münzen Nordgriechenlands 194, 6 zu-
sammengestellten Städtebilder griechischerPrägungen;
den Denar des Sulpicius Rufus mit der Ansicht von
Tusculum (Babelon II, 475, 9); das schöne Medaillon
von Bizye (Zeitschrift für Numismatik XXI 8, 5);
die Stadtbilder der Notitia dignitatum, der Karten
u. s. w. (Kubitschek, Mittheilungen der k. k. geo-
graphischen Gesellschaft 1900 S. 345). In einem
pompeianischen Wandgemälde (Giornale d. scavi 1868
tav. VI) wird ein prostyles Tempelchen auf einer
Bahre von vier Männern auf den Schultern in Pro-
cession getragen.
6) Reisen in südwestlichen Kleinasien I 54. Vgl.
Bull. com. XVII 349 tav. XI, XII.
noch vorhanden. 2) Bekannt ist die große Rolle, die das Architekturmodell in der
Baugeschichte Italiens spielt. Nach den lehrreichen Ausführungen Jacob Burck-
hardts sind plastische Modelle in der Gothik und ganzen Renaissance Italiens bei
Concurrenzen für fortificatorische Arbeiten, für Kirchen- und Palastconstructionen,
insbesondere bei Kuppel- und Centralbauten, schlechthin Regel gewesen, und
haben sich preisgekrönte Exemplare in Archiven, Sacristeien oder Bauhütten bis
auf die Gegenwart erhalten.") ln wechselnder Größe fertigte man sie aus Wachs,
Pappe und Gips, Kork, Holz, selbst aus Stein, fiir San Petronio in Bologna sogar
einmal vorübergehend in dem außerordentlichen Maßstabe von einem Zwölftel der
wirklichen Größe. Aus vorgothischer Zeit fließen die Nachrichten, wie begreiflicli,
spärlicher. Gleichwohl verlängern sie eine Kette der Tradition, die in derlei tech-
nischen Dingen an sich glaubwürdig, weil natürlich, ist, und Julius von Schlosser,
der diese Nachrichten in seinen gelehrten „Beiträgen zur Kunstgeschichte aus den
Schriftquellen des frühen Mittelalters“ zusammenstellte und einsichtig beprach, 4)
hat die Tradition, wozu ich ihn anregte, bis in die Antike verfolgt. Die Indicien-
beweise, die er dafür gab, lassen sich heute vermehren und aus dem durch neue
Urkunden deutlicher gewordenen Hergange bei Errichtung öffentlicher Bauwerke,
wie ich meine, zur Evidenz steigern. Das mühsame Geschäft aber, die zerrissenen
Fäden der Uberlieferung aufzusuchen und zu vereinigen, verspricht auch hier
mehr als bloß ein antiquarisches Jnteresse zu befriedigen.
Ein günstiges Vorurtheil erwecken schon die antiken Modelle von Städten,
Festungen, Schiffen und Belagerungsmaschinen, die auf Wagen oder Bahren vor-
geführt, eine Sehenswiirdigkeit der römischen Triumphzüge bildeten. 5) Aus dem
Orient lassen sich hierzu die Reliefbilder eroberter Städte verg'leichen, mit denen
ein lykischer Dynast des vierten Jahrhunderts v. Chr. sein Tempelgrab in Pinara
ausschmücken ließ, 6) und in die Kunstsymbolik des Mittelalters hat sich jener
2) A. Ilg, Leben und Werke I. B. Fischers
von Erlach des Vaters passim. Unter Anderem
S. 244 Modell des Schlosses Klesheim im Salz-
burger Museum; S. 493 Modell des Prager Palais
Clam Gallas im Schloss Friedland; S. 634 ff. Modelle
der Concurrenz fiir die Wiener Karlskirche.
3) Jacob Burckhardt, Geschichte der Renaissance
in Italien 3 109 ff.
4) J. v. Schlosser, Sitzungsberichte der Wiener
Akademie phil. hist. Classe LXXIII Abh. II 36 ff.
5) Marquardt, Roemische Staatsverwaltung II 2
584, I. — B. Pick erinnert hierzu an die von ihm in
den Antiken Münzen Nordgriechenlands 194, 6 zu-
sammengestellten Städtebilder griechischerPrägungen;
den Denar des Sulpicius Rufus mit der Ansicht von
Tusculum (Babelon II, 475, 9); das schöne Medaillon
von Bizye (Zeitschrift für Numismatik XXI 8, 5);
die Stadtbilder der Notitia dignitatum, der Karten
u. s. w. (Kubitschek, Mittheilungen der k. k. geo-
graphischen Gesellschaft 1900 S. 345). In einem
pompeianischen Wandgemälde (Giornale d. scavi 1868
tav. VI) wird ein prostyles Tempelchen auf einer
Bahre von vier Männern auf den Schultern in Pro-
cession getragen.
6) Reisen in südwestlichen Kleinasien I 54. Vgl.
Bull. com. XVII 349 tav. XI, XII.