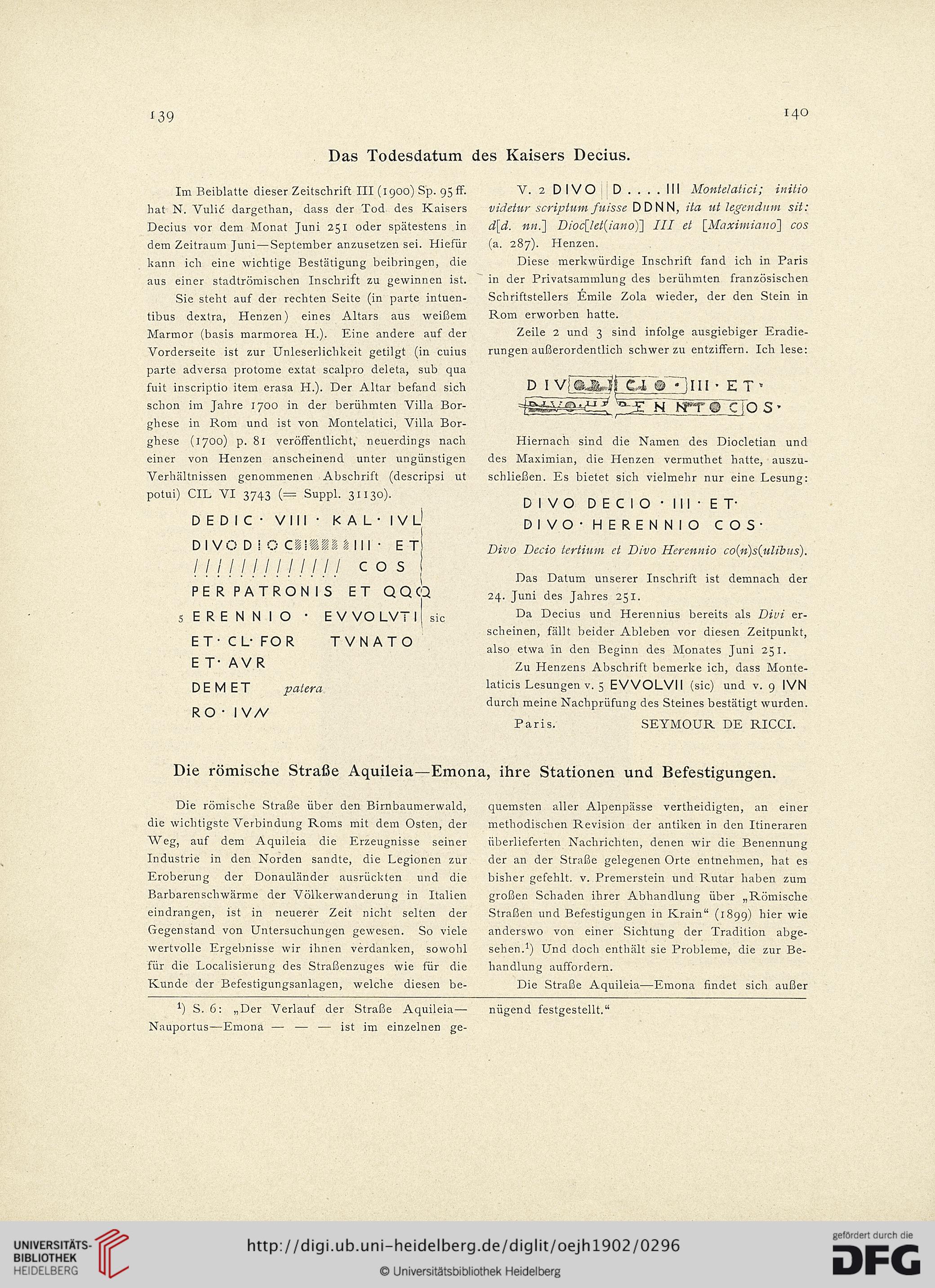139
140
Das Todesdatum des Kaisers Decius.
Xm Beiblatte dieser Zeitschrift III (1900) Sp. 95 ff.
bat N. Vulic dargetban, dass der Tod des Kaisers
Decius vor dem Monat Juni 251 oder spätestens in
dem Zeitraum Juni—September anzusetzen sei. Hiefür
kann icb eine wicbtige Bestätigung beibringen, die
aus einer stadtrömiscben Inscbrift zu gewinnen ist.
Sie steht auf der recbten Seite (in parte intuen-
tibus dextra, Henzen) eines Altars aus weißem
Marmor (basis marmorea H.). Eine andere auf der
Vorderseite ist zur Unleserlichkeit getilgt (in cuius
parte adversa protome extat scalpro deleta, sub qua
fuit inscriptio item erasa H.). Der Altar befand sich
scbon im Jahre 1700 in der berühmten Villa Bor-
gbese in Rom und ist von Montelatici, Villa Bor-
gbese (1700) p. 81 veröffentlicht, neuerdings nacli
einer von Henzen anscheinend unter ungünstigen
Verbältnissen genommenen Abschrift (descripsi ut
potui) CIL YI 3743 (= Suppl. 31130).
DEDIC • VIII- KAL-IVL 1
I
D I VO D I O CiiHÜ 1111 • E Tl
11 i I j 11 j j j j i i c o s J
PER PATRONIS E T QQCQ
s E R E N N I O • E V VOLVTlJ sic
ET-CL-FOR TVNATO
ET' AVR
D E M E T palera
R O * I V/V
V. 2 D IVO D .... III Montelatici; initio
videtur scriptum fuisse DDNN, ita ut legendum sit:
d[d. nn.~\ Dioc\_/et(iano)~\ III et ['Maximiano] cos
(a. 287). Henzen.
Diese merkwürdige Inschrift fand ich in Paris
in der Privatsammlung des berübmten französischen
Scbriftstellers Emile Zola wieder, der den Stein in
Rom erworben batte.
Zeile 2 und 3 sind infolge ausgiebiger Eradie-
rungen außerordentlich scliwer zu entziffern. Ich lese:
d i v\mjUt\ cTeTUin •et>
'©~cTq s y
Hiernach sind die Namen des Diocletian und
des Maximian, die Henzen vermuthet hatte, auszu-
schließen. Es bietet sich vielmehr nur eine Lesung:
DIVO DECIO * III* ET*
D I V O * HERENNIO COS*
Divo Decio tertium et Divo Herennio co(n)s(ulibus).
Das Datum unserer Inschrift ist demnacli der
24. Juni des Jahres 251.
Da Decius und Herennius bereits als Divi er-
scheinen, fällt beider Ableben vor diesen Zeitpunkt,
also etwa in den Beginn des Monates Juni 251.
Zu Henzens Abschrift bemerke ich, dass Monte-
laticis Lesungen v. 5 EVVOLVII (sic) und v. 9 IVN
durch meine Nachprüfung des Steines bestätigt wurden.
Paris. SEYMOUR DE RICCI.
Die römische Straße Aquileia—Emona, ihre Stationen und Befestigungen.
Die römische Straße über den Birnbaumerwald,
die wichtigste Verbindung Roms mit dem Osten, der
Weg, auf dem Aquileia die Erzeugnisse seiner
Industrie in den Norden sandte, die Legionen zur
Eroberung der Donauländer ausrückten und die
Barbarenschwärme der Völkerwanderung in Italien
eindrangen, ist in neuerer Zeit nicht selten der
Gegenstand von Untersuchungen gewesen. So viele
wertvolle Ergebnisse wir ihnen verdanken, sowohl
für die Localisierung des Straßenzuges wie für die
Kunde der Befestigungsanlagen, welche diesen be-
*) S. 6: „Der Verlauf der Straße Aquileia—
Nauportus—Emona — — — ist im einzelnen ge-
quemsten aller Alpenpässe vertheidigten, an einer
methodischen Revision der antiken in den Itineraren
iiberlieferten Nachrichten, denen wir die Benennung
der an der Straße gelegenen Orte entnehmen, hat es
bisher gefehlt. v. Premerstein und Rutar haben zum
großen Schaden ihrer Abhandlung über „Römische
Straßen und Befestigungen in Krain“ (1899) hier wie
anderswo von einer Sichtung der Tradition abge-
sehen. 1) Und doch enthält sie Probleme, die zur Be-
handlung auffordern.
Die Straße Aquileia—Emona findet sich außer
nügend festgestellt.“
140
Das Todesdatum des Kaisers Decius.
Xm Beiblatte dieser Zeitschrift III (1900) Sp. 95 ff.
bat N. Vulic dargetban, dass der Tod des Kaisers
Decius vor dem Monat Juni 251 oder spätestens in
dem Zeitraum Juni—September anzusetzen sei. Hiefür
kann icb eine wicbtige Bestätigung beibringen, die
aus einer stadtrömiscben Inscbrift zu gewinnen ist.
Sie steht auf der recbten Seite (in parte intuen-
tibus dextra, Henzen) eines Altars aus weißem
Marmor (basis marmorea H.). Eine andere auf der
Vorderseite ist zur Unleserlichkeit getilgt (in cuius
parte adversa protome extat scalpro deleta, sub qua
fuit inscriptio item erasa H.). Der Altar befand sich
scbon im Jahre 1700 in der berühmten Villa Bor-
gbese in Rom und ist von Montelatici, Villa Bor-
gbese (1700) p. 81 veröffentlicht, neuerdings nacli
einer von Henzen anscheinend unter ungünstigen
Verbältnissen genommenen Abschrift (descripsi ut
potui) CIL YI 3743 (= Suppl. 31130).
DEDIC • VIII- KAL-IVL 1
I
D I VO D I O CiiHÜ 1111 • E Tl
11 i I j 11 j j j j i i c o s J
PER PATRONIS E T QQCQ
s E R E N N I O • E V VOLVTlJ sic
ET-CL-FOR TVNATO
ET' AVR
D E M E T palera
R O * I V/V
V. 2 D IVO D .... III Montelatici; initio
videtur scriptum fuisse DDNN, ita ut legendum sit:
d[d. nn.~\ Dioc\_/et(iano)~\ III et ['Maximiano] cos
(a. 287). Henzen.
Diese merkwürdige Inschrift fand ich in Paris
in der Privatsammlung des berübmten französischen
Scbriftstellers Emile Zola wieder, der den Stein in
Rom erworben batte.
Zeile 2 und 3 sind infolge ausgiebiger Eradie-
rungen außerordentlich scliwer zu entziffern. Ich lese:
d i v\mjUt\ cTeTUin •et>
'©~cTq s y
Hiernach sind die Namen des Diocletian und
des Maximian, die Henzen vermuthet hatte, auszu-
schließen. Es bietet sich vielmehr nur eine Lesung:
DIVO DECIO * III* ET*
D I V O * HERENNIO COS*
Divo Decio tertium et Divo Herennio co(n)s(ulibus).
Das Datum unserer Inschrift ist demnacli der
24. Juni des Jahres 251.
Da Decius und Herennius bereits als Divi er-
scheinen, fällt beider Ableben vor diesen Zeitpunkt,
also etwa in den Beginn des Monates Juni 251.
Zu Henzens Abschrift bemerke ich, dass Monte-
laticis Lesungen v. 5 EVVOLVII (sic) und v. 9 IVN
durch meine Nachprüfung des Steines bestätigt wurden.
Paris. SEYMOUR DE RICCI.
Die römische Straße Aquileia—Emona, ihre Stationen und Befestigungen.
Die römische Straße über den Birnbaumerwald,
die wichtigste Verbindung Roms mit dem Osten, der
Weg, auf dem Aquileia die Erzeugnisse seiner
Industrie in den Norden sandte, die Legionen zur
Eroberung der Donauländer ausrückten und die
Barbarenschwärme der Völkerwanderung in Italien
eindrangen, ist in neuerer Zeit nicht selten der
Gegenstand von Untersuchungen gewesen. So viele
wertvolle Ergebnisse wir ihnen verdanken, sowohl
für die Localisierung des Straßenzuges wie für die
Kunde der Befestigungsanlagen, welche diesen be-
*) S. 6: „Der Verlauf der Straße Aquileia—
Nauportus—Emona — — — ist im einzelnen ge-
quemsten aller Alpenpässe vertheidigten, an einer
methodischen Revision der antiken in den Itineraren
iiberlieferten Nachrichten, denen wir die Benennung
der an der Straße gelegenen Orte entnehmen, hat es
bisher gefehlt. v. Premerstein und Rutar haben zum
großen Schaden ihrer Abhandlung über „Römische
Straßen und Befestigungen in Krain“ (1899) hier wie
anderswo von einer Sichtung der Tradition abge-
sehen. 1) Und doch enthält sie Probleme, die zur Be-
handlung auffordern.
Die Straße Aquileia—Emona findet sich außer
nügend festgestellt.“