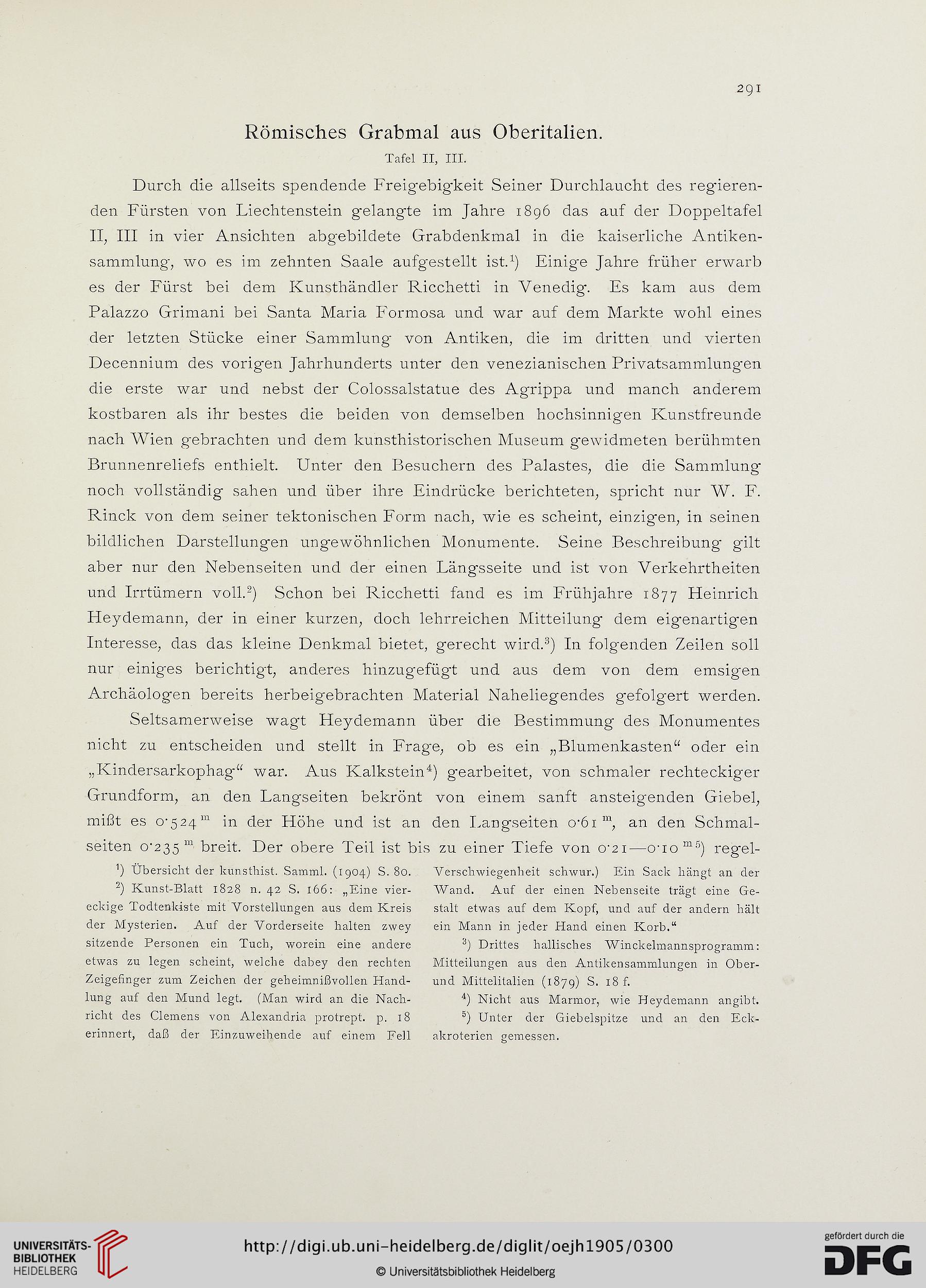Römisches Grabmal aus Oberitalien.
Tafel II, III.
Durch die allseits spendende Freigiebigkeit Seiner Durchlaucht des regieren-
den Fürsten von Liechtenstein gelangte im Jahre 1896 das auf der Doppeltafel
II, III in vier Ansichten abgebildete Grabdenkmal in die kaiserliche Antiken-
sammlung, wo es im zehnten Saale aufgestellt ist.1) Einige Jahre früher erwarb
es der Fürst bei dem Kunsthändler Ricchetti in Venedig·. Es kam aus dem
Palazzo Grimani bei Santa Maria Formosa und war auf dem Markte wohl eines
der letzten Stücke einer Sammlung von Antiken, die im dritten und vierten
Decennium des vorigen Jahrhunderts unter den venezianischen Privatsammlungen
die erste war und nebst der Colossalstatue des Agrippa und manch anderem
kostbaren als ihr bestes die beiden von demselben hochsinnigen Kunstfreunde
nach Wien gebrachten und dem kunsthistorischen Museum gewidmeten berühmten
Brunnenreliefs enthielt. Unter den Besuchern des Palastes, die die Sammlung
noch vollständig sahen und über ihre Eindrücke berichteten, spricht nur W. F.
Rinclc von dem seiner tektonischen Form nach, wie es scheint, einzigen, in seinen
bildlichen Darstellungen ungewöhnlichen Monumente. Seine Beschreibung gilt
aber nur den Nebenseiten und der einen Längsseite und ist von Verkehrtheiten
und Irrtümern voll.2) Schon bei Ricchetti fand es im Frühjahre 1877 Heinrich
Heydemann, der in einer kurzen, doch lehrreichen Mitteilung dem eigenartigen
Interesse, das das kleine Denkmal bietet, gerecht wird.3) In folgenden Zeilen soll
nur einig'es berichtigt, anderes hinzugefügt und aus dem von dem emsigen
Archäologen bereits herbeigebrachten Material Naheliegendes gefolgert werden.
Seltsamerweise wagt Heydemann über die Bestimmung des Monumentes
nicht zu entscheiden und stellt in Frage, ob es ein „Blumenkasten“ oder ein
„Kindersarkophag·“ war. Aus Kalkstein4) gearbeitet, von schmaler rechteckiger
Grundform, an den Langseiten bekrönt von einem sanft ansteigenden Giebel,
mißt es 0-524“ in der Höhe und ist an den Langseiten o*6i m, an den Schmal-
seiten o‘235 m breit. Der obere Teil ist bis zu einer Tiefe von o-2i—0'iom5) regel-
’) Übersicht der kunsthist. Samml. (1904) S. 80.
2) Kunst-Blatt 1828 n. 42 S. 166: „Eine vier-
eckige Todtenkiste mit Vorstellungen aus dem Kreis
der Mysterien. Auf der Vorderseite halten zwey
sitzende Personen ein Tuch, worein eine andere
etwas zu legen scheint, welche dabey den rechten
Zeigefinger zum Zeichen der geheimnißvollen Hand-
lung auf den Mund legt. (Man wird an die Nach-
richt des Clemens von Alexandria protrept. p. 18
erinnert, daß der Einzuweihende auf einem Fell
Verschwiegenheit schwur.) Ein Sack hängt an der
Wand. Auf der einen Nebenseite trägt eine Ge-
stalt etwas auf dem Kopf, und auf der andern hält
ein Mann in jeder Hand einen Korb.“
3) Drittes liallisches Winckelmannsprogramm:
Mitteilungen aus den Antikensammlungen in Ober-
und Mittelitalien (1879) S. 18 f.
4) Nicht aus Marmor, wie Heydemann angibt.
5) Unter der Giebelspitze und an den Eck-
akroterien gemessen.
Tafel II, III.
Durch die allseits spendende Freigiebigkeit Seiner Durchlaucht des regieren-
den Fürsten von Liechtenstein gelangte im Jahre 1896 das auf der Doppeltafel
II, III in vier Ansichten abgebildete Grabdenkmal in die kaiserliche Antiken-
sammlung, wo es im zehnten Saale aufgestellt ist.1) Einige Jahre früher erwarb
es der Fürst bei dem Kunsthändler Ricchetti in Venedig·. Es kam aus dem
Palazzo Grimani bei Santa Maria Formosa und war auf dem Markte wohl eines
der letzten Stücke einer Sammlung von Antiken, die im dritten und vierten
Decennium des vorigen Jahrhunderts unter den venezianischen Privatsammlungen
die erste war und nebst der Colossalstatue des Agrippa und manch anderem
kostbaren als ihr bestes die beiden von demselben hochsinnigen Kunstfreunde
nach Wien gebrachten und dem kunsthistorischen Museum gewidmeten berühmten
Brunnenreliefs enthielt. Unter den Besuchern des Palastes, die die Sammlung
noch vollständig sahen und über ihre Eindrücke berichteten, spricht nur W. F.
Rinclc von dem seiner tektonischen Form nach, wie es scheint, einzigen, in seinen
bildlichen Darstellungen ungewöhnlichen Monumente. Seine Beschreibung gilt
aber nur den Nebenseiten und der einen Längsseite und ist von Verkehrtheiten
und Irrtümern voll.2) Schon bei Ricchetti fand es im Frühjahre 1877 Heinrich
Heydemann, der in einer kurzen, doch lehrreichen Mitteilung dem eigenartigen
Interesse, das das kleine Denkmal bietet, gerecht wird.3) In folgenden Zeilen soll
nur einig'es berichtigt, anderes hinzugefügt und aus dem von dem emsigen
Archäologen bereits herbeigebrachten Material Naheliegendes gefolgert werden.
Seltsamerweise wagt Heydemann über die Bestimmung des Monumentes
nicht zu entscheiden und stellt in Frage, ob es ein „Blumenkasten“ oder ein
„Kindersarkophag·“ war. Aus Kalkstein4) gearbeitet, von schmaler rechteckiger
Grundform, an den Langseiten bekrönt von einem sanft ansteigenden Giebel,
mißt es 0-524“ in der Höhe und ist an den Langseiten o*6i m, an den Schmal-
seiten o‘235 m breit. Der obere Teil ist bis zu einer Tiefe von o-2i—0'iom5) regel-
’) Übersicht der kunsthist. Samml. (1904) S. 80.
2) Kunst-Blatt 1828 n. 42 S. 166: „Eine vier-
eckige Todtenkiste mit Vorstellungen aus dem Kreis
der Mysterien. Auf der Vorderseite halten zwey
sitzende Personen ein Tuch, worein eine andere
etwas zu legen scheint, welche dabey den rechten
Zeigefinger zum Zeichen der geheimnißvollen Hand-
lung auf den Mund legt. (Man wird an die Nach-
richt des Clemens von Alexandria protrept. p. 18
erinnert, daß der Einzuweihende auf einem Fell
Verschwiegenheit schwur.) Ein Sack hängt an der
Wand. Auf der einen Nebenseite trägt eine Ge-
stalt etwas auf dem Kopf, und auf der andern hält
ein Mann in jeder Hand einen Korb.“
3) Drittes liallisches Winckelmannsprogramm:
Mitteilungen aus den Antikensammlungen in Ober-
und Mittelitalien (1879) S. 18 f.
4) Nicht aus Marmor, wie Heydemann angibt.
5) Unter der Giebelspitze und an den Eck-
akroterien gemessen.