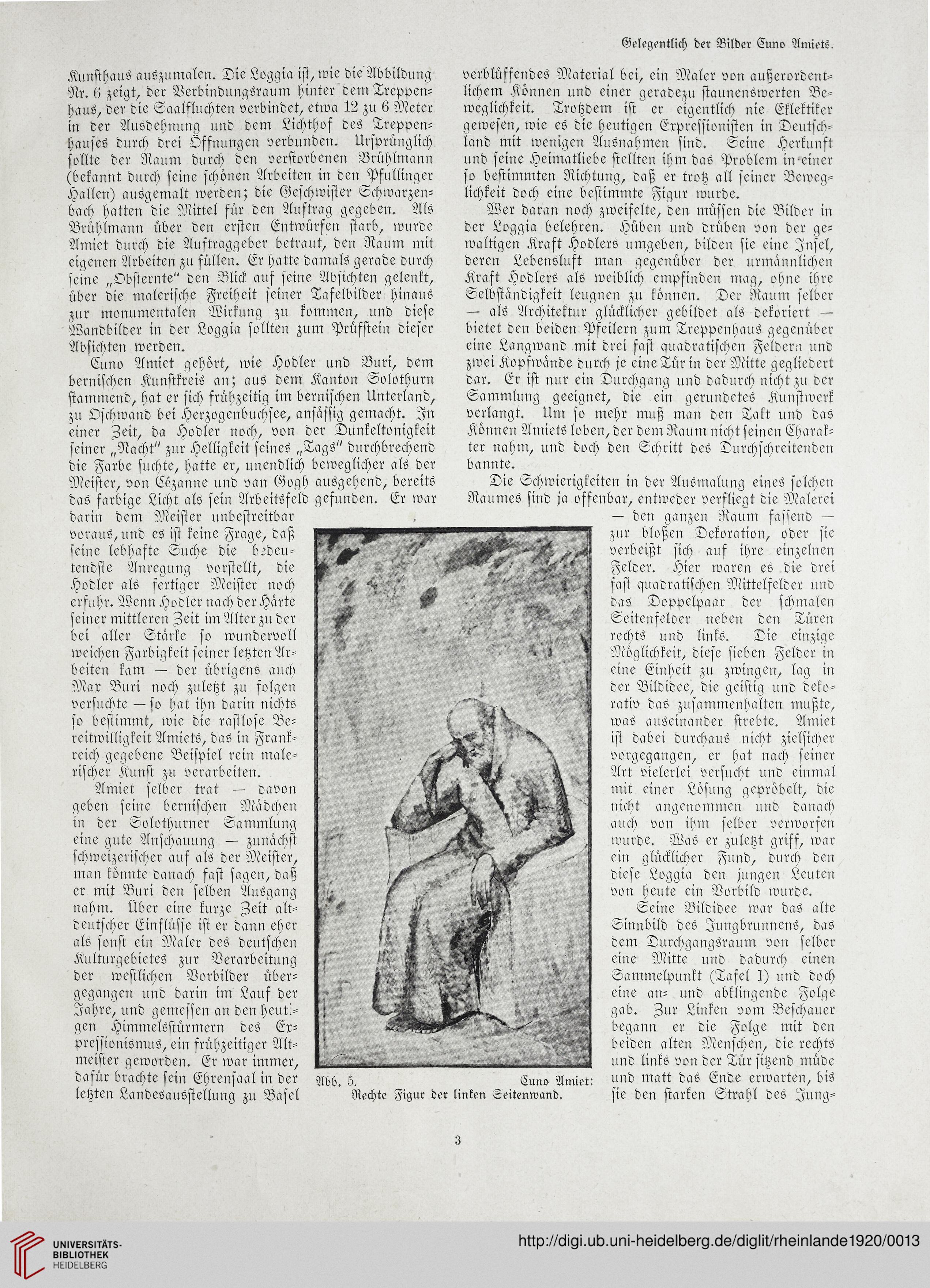Gelegentlich der Bilder Cuno Amiets.
Kunsthaus auszumalen. Die Loggia ist, wie die Abbildung
Nr. 6 zeigt, der Verbindungsraum hinter dem Treppen-
haus, der die Saalfluchten verbindet, etlva 12 zu 6 Meter
in der Ausdehnung und dem Lichthof des Treppen-
hauses durch drei Offnungen verbunden. Ursprünglich
sollte der Raum durch den verstorbenen Brühlmann
(bekannt durch seine schönen Arbeiten in den Pfullinger
Hallen) ausgemalt werden; die Geschwister Schwarzen-
bach hatten die Mittel für den Auftrag gegeben. Als
Brühlmann über den ersten Entwürfen starb, wurde
Amiet durch die Auftraggeber betraut, den Raum mit
eigenen Arbeiten zu füllen. Er hatte damals gerade durch
seine „Obsternte" den Blick auf seine Absichten gelenkt,
über die malerische Freiheit seiner Tafelbilder hinaus
zur monumentalen Wirkung zu kommen, und diese
Wandbilder in der Loggia sollten zum Prüfstein dieser
Absichten werden.
Cuno Amiet gehört, wie Hodler und Buri, dem
bernischen Kunstkreis an; aus dem Kanton Solothurn
stammend, hat er sich frühzeitig im bernischen Unterland,
zu Oschwand bei Herzogenbuchsee, ansässig gemacht. Jn
einer Aeit, da Hodler noch, von der Dunkeltonigkeit
seiner „Nacht" zur Helligkeit seines „Tags" durchbrechend
die Farbe suchte, hatte er, unendlich beweglicher als der
Meister, von Cozanne und van Gogh ausgehend, bereits
das farbige Licht als sein Arbeitsfeld gefunden. Er war
darin dem Meister unbestreitbar
voraus, und es ist keine Frage, daß
seine lebhafte Suche die bedeu-
tendste Anregung vorstellt, die
Hodler als fertiger Meister noch
erfuhr. Wenn Hodler nach derHärte
seiner mittleren Aeit im Alter zu der
bei aller Stärke so wundervoll
weichen Farbigkeit seiner letzten Ar-
beiten kam — der übrigens auch
Mar Buri noch zuletzt zu folgen
versuchte — so hat ihn darin nichts
so bestimmt, wie die rastlose Be-
reitwilligkeit Amiets, das in Frank-
reich gegebene Beispiel rein male-
rischer Kunst zu verarbeiten.
Amiet selber trat — davon
geben seine bernischen Mädchen
in der Solothurner Sammlung
eine gute Anschauung — zunächst
schweizerischer auf als der Meister,
man könnte danach fast sagen, daß
er mit Buri den selben Ausgang
nahm. Über eine kurze Aeit alt-
deutscher Einflüsse ist er dann eher
als sonst ein Maler des deutschen
Kulturgebietes zur Verarbeitung
der westlichen Vorbilder über-
gegangen und darin im Lauf der
Jahre, und gemessen an den heut^-
gen Himmelsstürmern des Er-
pressionismus, ein frühzeitiger Alt-
meister geworden. Er war immer,
dafür brachte sein Ehrensaal in der
letzten Landesausstellung zu Basel
verblüffendes Material bei, ein Maler von außerordent-
lichem Können und einer geradezu staunenswerten Be-
weglichkeit. Trotzdem ist er eigentlich nie Eklektiker
gewesen, wie es die heutigen Erpressionisten in Deutsch-
land mit wenigen Ausnahmen sind. Seine Herkunft
und seine Heimatliebe stellten ihm das Problem in-einer
so bestimmten Richtung, daß er trotz all seiner Beweg-
lichkeit doch eine bestimmte Figur wurde.
Wer daran noch zweifelte, den müssen die Bilder in
der Loggia belehren. Hüben und drüben von der ge-
waltigen Kraft Hodlers umgeben, bilden sie eine Jnsel,
deren Lebensluft man gegenüber der urmännlichen
Kraft Hodlers als weiblich empfinden mag, ohne ihre
Selbständigkeit leugnen zu können. Der Raum selber
— als Architektur glücklicher gebildet als dekoriert —
bietet den beiden Pfeilern zum Treppenhaus gegenüber
eine Langwand mit drei fast quadratischen Feldern und
zwei Kopfwände durch je eine Tür in der Mitte gegliedert
dar. Er ist nur ein Durchgang und dadurch nicht zu der
Sammlung geeignet, die ein gerundetes Kunstwerk
verlangt. Um so mehr muß man den Takt und das
Können Amiets loben, der dem Naum nicht seinen Charak-
ter nahm, und doch den Schritt des Durchschreitenden
bannte.
Die Schwierigkeiten in der Ausmalung eines solchen
Raumes sind ja offenbar, entweder verfliegt die Malerei
— den ganzen Raum fassend —
zur bloßen Dekoration, oder sie
verbeißt sich auf ihre einzelnen
Felder. Hier waren es die drei
fast quadratischen Mittelfelder und
das Doppelpaar der schmalen
Seitenfeloer neben den Türen
rechts und links. Die einzige
Möglichkeit, diese sieben Felder in
eine Einheit zu zwingen, lag in
der Bildidee, die geistig und deko-
rativ das zusammenhalten mußte,
was auseinander strebte. Amiet
ist dabei durchaus nicht zielsicher
vorgegangen, er hat nach seiner
Art vielerlei versucht und einmal
mit einer Lösung gepröbelt, die
nicht angenommen und danach
auch von ihm selber verworfen
wurde. Was er zuletzt griff, war
ein glücklicher Fund, durch den
diese Loggia den jungen Leuten
von heute ein Vorbild wurde.
Seine Bildidee war das alte
Sinnbild des Jungbrunnens, das
dem Durchgangsraum von selber
eine Mitte und dadurch einen
Sammelpunkt (Tafel i) und doch
eine an- und abklingende Folge
gab. Aur Linken vom Beschauer
begann er die Folge mit den
beiden alten Menschen, die rechts
und links von der Tür sitzend müde
und matt das Ende erwarten, bis
sie den starken Strahl des Jung-
Abb. 5. ^ Cuno Amiet:
Rechte Figur der linken Seitenwand.
3
Kunsthaus auszumalen. Die Loggia ist, wie die Abbildung
Nr. 6 zeigt, der Verbindungsraum hinter dem Treppen-
haus, der die Saalfluchten verbindet, etlva 12 zu 6 Meter
in der Ausdehnung und dem Lichthof des Treppen-
hauses durch drei Offnungen verbunden. Ursprünglich
sollte der Raum durch den verstorbenen Brühlmann
(bekannt durch seine schönen Arbeiten in den Pfullinger
Hallen) ausgemalt werden; die Geschwister Schwarzen-
bach hatten die Mittel für den Auftrag gegeben. Als
Brühlmann über den ersten Entwürfen starb, wurde
Amiet durch die Auftraggeber betraut, den Raum mit
eigenen Arbeiten zu füllen. Er hatte damals gerade durch
seine „Obsternte" den Blick auf seine Absichten gelenkt,
über die malerische Freiheit seiner Tafelbilder hinaus
zur monumentalen Wirkung zu kommen, und diese
Wandbilder in der Loggia sollten zum Prüfstein dieser
Absichten werden.
Cuno Amiet gehört, wie Hodler und Buri, dem
bernischen Kunstkreis an; aus dem Kanton Solothurn
stammend, hat er sich frühzeitig im bernischen Unterland,
zu Oschwand bei Herzogenbuchsee, ansässig gemacht. Jn
einer Aeit, da Hodler noch, von der Dunkeltonigkeit
seiner „Nacht" zur Helligkeit seines „Tags" durchbrechend
die Farbe suchte, hatte er, unendlich beweglicher als der
Meister, von Cozanne und van Gogh ausgehend, bereits
das farbige Licht als sein Arbeitsfeld gefunden. Er war
darin dem Meister unbestreitbar
voraus, und es ist keine Frage, daß
seine lebhafte Suche die bedeu-
tendste Anregung vorstellt, die
Hodler als fertiger Meister noch
erfuhr. Wenn Hodler nach derHärte
seiner mittleren Aeit im Alter zu der
bei aller Stärke so wundervoll
weichen Farbigkeit seiner letzten Ar-
beiten kam — der übrigens auch
Mar Buri noch zuletzt zu folgen
versuchte — so hat ihn darin nichts
so bestimmt, wie die rastlose Be-
reitwilligkeit Amiets, das in Frank-
reich gegebene Beispiel rein male-
rischer Kunst zu verarbeiten.
Amiet selber trat — davon
geben seine bernischen Mädchen
in der Solothurner Sammlung
eine gute Anschauung — zunächst
schweizerischer auf als der Meister,
man könnte danach fast sagen, daß
er mit Buri den selben Ausgang
nahm. Über eine kurze Aeit alt-
deutscher Einflüsse ist er dann eher
als sonst ein Maler des deutschen
Kulturgebietes zur Verarbeitung
der westlichen Vorbilder über-
gegangen und darin im Lauf der
Jahre, und gemessen an den heut^-
gen Himmelsstürmern des Er-
pressionismus, ein frühzeitiger Alt-
meister geworden. Er war immer,
dafür brachte sein Ehrensaal in der
letzten Landesausstellung zu Basel
verblüffendes Material bei, ein Maler von außerordent-
lichem Können und einer geradezu staunenswerten Be-
weglichkeit. Trotzdem ist er eigentlich nie Eklektiker
gewesen, wie es die heutigen Erpressionisten in Deutsch-
land mit wenigen Ausnahmen sind. Seine Herkunft
und seine Heimatliebe stellten ihm das Problem in-einer
so bestimmten Richtung, daß er trotz all seiner Beweg-
lichkeit doch eine bestimmte Figur wurde.
Wer daran noch zweifelte, den müssen die Bilder in
der Loggia belehren. Hüben und drüben von der ge-
waltigen Kraft Hodlers umgeben, bilden sie eine Jnsel,
deren Lebensluft man gegenüber der urmännlichen
Kraft Hodlers als weiblich empfinden mag, ohne ihre
Selbständigkeit leugnen zu können. Der Raum selber
— als Architektur glücklicher gebildet als dekoriert —
bietet den beiden Pfeilern zum Treppenhaus gegenüber
eine Langwand mit drei fast quadratischen Feldern und
zwei Kopfwände durch je eine Tür in der Mitte gegliedert
dar. Er ist nur ein Durchgang und dadurch nicht zu der
Sammlung geeignet, die ein gerundetes Kunstwerk
verlangt. Um so mehr muß man den Takt und das
Können Amiets loben, der dem Naum nicht seinen Charak-
ter nahm, und doch den Schritt des Durchschreitenden
bannte.
Die Schwierigkeiten in der Ausmalung eines solchen
Raumes sind ja offenbar, entweder verfliegt die Malerei
— den ganzen Raum fassend —
zur bloßen Dekoration, oder sie
verbeißt sich auf ihre einzelnen
Felder. Hier waren es die drei
fast quadratischen Mittelfelder und
das Doppelpaar der schmalen
Seitenfeloer neben den Türen
rechts und links. Die einzige
Möglichkeit, diese sieben Felder in
eine Einheit zu zwingen, lag in
der Bildidee, die geistig und deko-
rativ das zusammenhalten mußte,
was auseinander strebte. Amiet
ist dabei durchaus nicht zielsicher
vorgegangen, er hat nach seiner
Art vielerlei versucht und einmal
mit einer Lösung gepröbelt, die
nicht angenommen und danach
auch von ihm selber verworfen
wurde. Was er zuletzt griff, war
ein glücklicher Fund, durch den
diese Loggia den jungen Leuten
von heute ein Vorbild wurde.
Seine Bildidee war das alte
Sinnbild des Jungbrunnens, das
dem Durchgangsraum von selber
eine Mitte und dadurch einen
Sammelpunkt (Tafel i) und doch
eine an- und abklingende Folge
gab. Aur Linken vom Beschauer
begann er die Folge mit den
beiden alten Menschen, die rechts
und links von der Tür sitzend müde
und matt das Ende erwarten, bis
sie den starken Strahl des Jung-
Abb. 5. ^ Cuno Amiet:
Rechte Figur der linken Seitenwand.
3