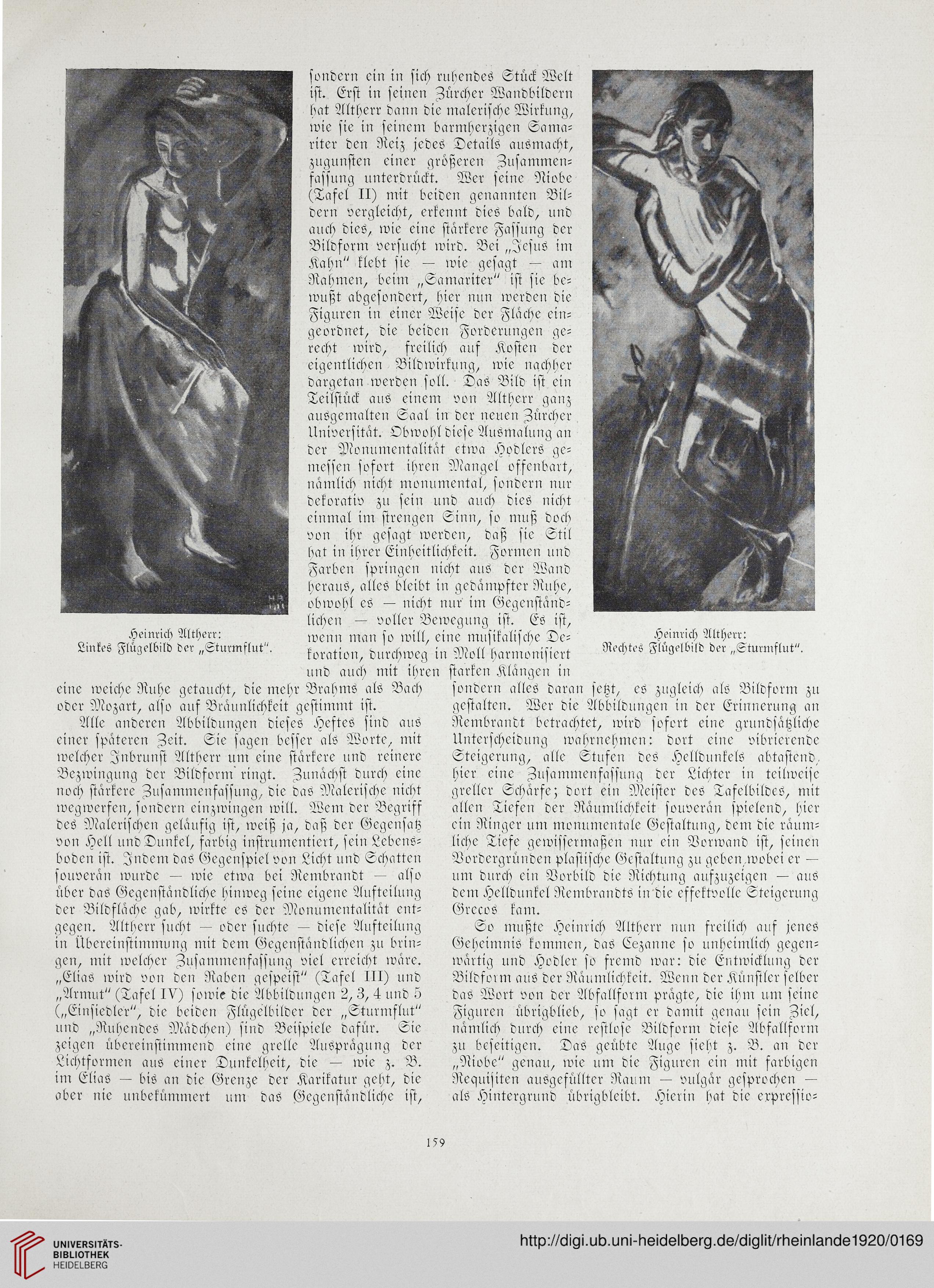Heinrich Altherr:
Linkes Flügelbild der „Sturmflut"'
eine weiche Ruhe getaucht, die mehr Brahms als Bach
oder Mozarch also atlf Bräuulichkeit gestimmt ist.
Alle audereu Abbildtingeu dieses Hestes siud aus
eiuer späteren Aeit. Sie sagen besser als Worte,, mit
ivelcher Jnbrunst Altherr um eiue stärkere und reinere
Bezwingung der Bildform ringt. Aunächst durch eine
noch stärkere Ausammenfassung, die das Malerische nicht
wegwerfen, sondern einzwingen will. Wem der Begriff
des Malerischen geläufig ist, weiß ja, daß der Gegensatz
von Hell und Dunkel, farbig instrumcntiert, sein Lebens-
boden ist. Jndem das Gegenspiel von Licht und Schatten
souverän wurde — wie etwa bei Rembrandt — also
über das Gegenständliche hinweg seine eigene Aufteilung
der Bildfläche gab, wirkte es der Monumentalität ent-
gegen. Altherr sucht — oder suchte — diese Aufteilung
in Übereinstimmung mit dem Gegenständlichen zu brin-
gen, mit welcher Ausammenfassung viel erreicht wäre.
„Elias wird von den Raben gespeist" (Tafel III) und
„Armut" (Tafel IV) sowie die Äbbildungen 2, 3, 4 und 5
(„Einsiedler", die beiden Flügelbilder der „Sturmflut"
und „Ruhendes Mädchen) sind Beispiele dafür. Sie
zeigen übereinstimmend eine grelle Ausprägung der
Lichtformen aus einer Dunkelheit, die — uüe z. B.
im Elias — bis an die Grenze der Karikatur geht, die
aber nie unbekümmert um das Gegenständliche ist,
sondern ein in sich ruhendes Stück Welt
ist. Erst in seinen Aürcher Wandbildern
hat Altherr dann die malerische Wirkung,
wie sie in seinem barmherzigen Sama-
riter den Reiz jedes Details ausmacht,
zugunsten einer größeren Ausammen-
fassung unterdrückt. Wer seine Niobe
(Tafel II) mit beiden genannten Bil-
dern vergleicht, erkennt dies bald, und
arich dies, wie eiue stärkere Fassung der
Bildform versucht wird. Bei „Jesus im
Kahn" klebt sie — wie gesagt — am
Rahmen, beim „Samariter" ist sie be-
wußt abgesondert, hier nun werden die
Figuren in einer Weise der Fläche ein-
geordnet, die beiden Forderungen ge-
recht wird, freilich auf Kosten der
eigentlichen Bildwirkung, wie nachher
dargetan werden soll. Das Bild ist ein
Teilstück aus einem von Altherr ganz
ausgemalten Saal in der neuen Aürcher
Ilniversität. Obwohl diese Ausmalung an
der Monumentalität etwa Hodlers ge-
messen sofort ihren Mangel offenbart,
nämlich nicht nionumental, sondern nur
dekorativ zu sein rind auch dies nicht
einmal im strengen Sinn, so muß doch
von ihr gesagt werden, daß sie Stil
hat in ihrer Einheitlichkeit. Formen und
Farben springen nicht aus der Wand
heraus, alles bleibt in gedämpfter Ruhe,
obivohl es — nicht nur im Gegenständ-
lichen — voller Bewegung ist. Es ist,
wenn man so will, eine musikalische De-
koration, durchweg in Moll harmonisiert
und auch mit ihren starken Klängen in
sonderu alles daran
Heinnch Altherr:
Rechtes Flügelbild der „Sturmflut",
etzt, es zugleich als Bildform zu
gestalten. Wer die Abbildungen in der Erinnerung an
Rembrandt betrachtet, wird sofort eine grundsätzliche
Unterscheidung wahrnehmen: dort eine vibrierende
Steigerung, alle Stufen des Helldunkels abtastend,
hier eine Ausammenfassung der Lichter in teilweise
grellcr Schärfe; dort ein Meister des Tafelbildes, mit
allen Tiefen der Räumlichkeit souverän spielend, hier
ein Ringer um monumentale Gestaltung, dem die räum-
liche Tiefe gewisserniaßen nur ein Vorwand ist, seinen
Vordergründen plastische Gestaltung zu gebenavobei er —
um durch ein Vorbild die Richtung aufzuzeigen — aus
dem Helldunkel Rembrandts in die effektvolle Steigerung
Grecos kam.
So mußte Heinrich Altherr nun freilich auf jenes
Geheinmis kommen, das Cezanne so unheimlich gegen-
wärtig und Hodler so fremd war: die Entwicklung der
Bildfoi ni aus der Räumlichkcit. Wenn der Künstler selber
das Wort von der Abfallform prägte, die ihni um seine
Figuren übrigblieb, so sagt er damit genau sein Aiel,
nämlich durch eine restlose Bildform diese Abfallforni
zu beseitigen. Das geübte Auge sieht z. B. an der
„Niobe" genau, wie um die Figuren ein mit farbigen
Requijiten ausgefüllter Raum — vulgär gesprochen —
als Hintergrund übrigbleibt. Hierin hat die erpressio-
159
Linkes Flügelbild der „Sturmflut"'
eine weiche Ruhe getaucht, die mehr Brahms als Bach
oder Mozarch also atlf Bräuulichkeit gestimmt ist.
Alle audereu Abbildtingeu dieses Hestes siud aus
eiuer späteren Aeit. Sie sagen besser als Worte,, mit
ivelcher Jnbrunst Altherr um eiue stärkere und reinere
Bezwingung der Bildform ringt. Aunächst durch eine
noch stärkere Ausammenfassung, die das Malerische nicht
wegwerfen, sondern einzwingen will. Wem der Begriff
des Malerischen geläufig ist, weiß ja, daß der Gegensatz
von Hell und Dunkel, farbig instrumcntiert, sein Lebens-
boden ist. Jndem das Gegenspiel von Licht und Schatten
souverän wurde — wie etwa bei Rembrandt — also
über das Gegenständliche hinweg seine eigene Aufteilung
der Bildfläche gab, wirkte es der Monumentalität ent-
gegen. Altherr sucht — oder suchte — diese Aufteilung
in Übereinstimmung mit dem Gegenständlichen zu brin-
gen, mit welcher Ausammenfassung viel erreicht wäre.
„Elias wird von den Raben gespeist" (Tafel III) und
„Armut" (Tafel IV) sowie die Äbbildungen 2, 3, 4 und 5
(„Einsiedler", die beiden Flügelbilder der „Sturmflut"
und „Ruhendes Mädchen) sind Beispiele dafür. Sie
zeigen übereinstimmend eine grelle Ausprägung der
Lichtformen aus einer Dunkelheit, die — uüe z. B.
im Elias — bis an die Grenze der Karikatur geht, die
aber nie unbekümmert um das Gegenständliche ist,
sondern ein in sich ruhendes Stück Welt
ist. Erst in seinen Aürcher Wandbildern
hat Altherr dann die malerische Wirkung,
wie sie in seinem barmherzigen Sama-
riter den Reiz jedes Details ausmacht,
zugunsten einer größeren Ausammen-
fassung unterdrückt. Wer seine Niobe
(Tafel II) mit beiden genannten Bil-
dern vergleicht, erkennt dies bald, und
arich dies, wie eiue stärkere Fassung der
Bildform versucht wird. Bei „Jesus im
Kahn" klebt sie — wie gesagt — am
Rahmen, beim „Samariter" ist sie be-
wußt abgesondert, hier nun werden die
Figuren in einer Weise der Fläche ein-
geordnet, die beiden Forderungen ge-
recht wird, freilich auf Kosten der
eigentlichen Bildwirkung, wie nachher
dargetan werden soll. Das Bild ist ein
Teilstück aus einem von Altherr ganz
ausgemalten Saal in der neuen Aürcher
Ilniversität. Obwohl diese Ausmalung an
der Monumentalität etwa Hodlers ge-
messen sofort ihren Mangel offenbart,
nämlich nicht nionumental, sondern nur
dekorativ zu sein rind auch dies nicht
einmal im strengen Sinn, so muß doch
von ihr gesagt werden, daß sie Stil
hat in ihrer Einheitlichkeit. Formen und
Farben springen nicht aus der Wand
heraus, alles bleibt in gedämpfter Ruhe,
obivohl es — nicht nur im Gegenständ-
lichen — voller Bewegung ist. Es ist,
wenn man so will, eine musikalische De-
koration, durchweg in Moll harmonisiert
und auch mit ihren starken Klängen in
sonderu alles daran
Heinnch Altherr:
Rechtes Flügelbild der „Sturmflut",
etzt, es zugleich als Bildform zu
gestalten. Wer die Abbildungen in der Erinnerung an
Rembrandt betrachtet, wird sofort eine grundsätzliche
Unterscheidung wahrnehmen: dort eine vibrierende
Steigerung, alle Stufen des Helldunkels abtastend,
hier eine Ausammenfassung der Lichter in teilweise
grellcr Schärfe; dort ein Meister des Tafelbildes, mit
allen Tiefen der Räumlichkeit souverän spielend, hier
ein Ringer um monumentale Gestaltung, dem die räum-
liche Tiefe gewisserniaßen nur ein Vorwand ist, seinen
Vordergründen plastische Gestaltung zu gebenavobei er —
um durch ein Vorbild die Richtung aufzuzeigen — aus
dem Helldunkel Rembrandts in die effektvolle Steigerung
Grecos kam.
So mußte Heinrich Altherr nun freilich auf jenes
Geheinmis kommen, das Cezanne so unheimlich gegen-
wärtig und Hodler so fremd war: die Entwicklung der
Bildfoi ni aus der Räumlichkcit. Wenn der Künstler selber
das Wort von der Abfallform prägte, die ihni um seine
Figuren übrigblieb, so sagt er damit genau sein Aiel,
nämlich durch eine restlose Bildform diese Abfallforni
zu beseitigen. Das geübte Auge sieht z. B. an der
„Niobe" genau, wie um die Figuren ein mit farbigen
Requijiten ausgefüllter Raum — vulgär gesprochen —
als Hintergrund übrigbleibt. Hierin hat die erpressio-
159