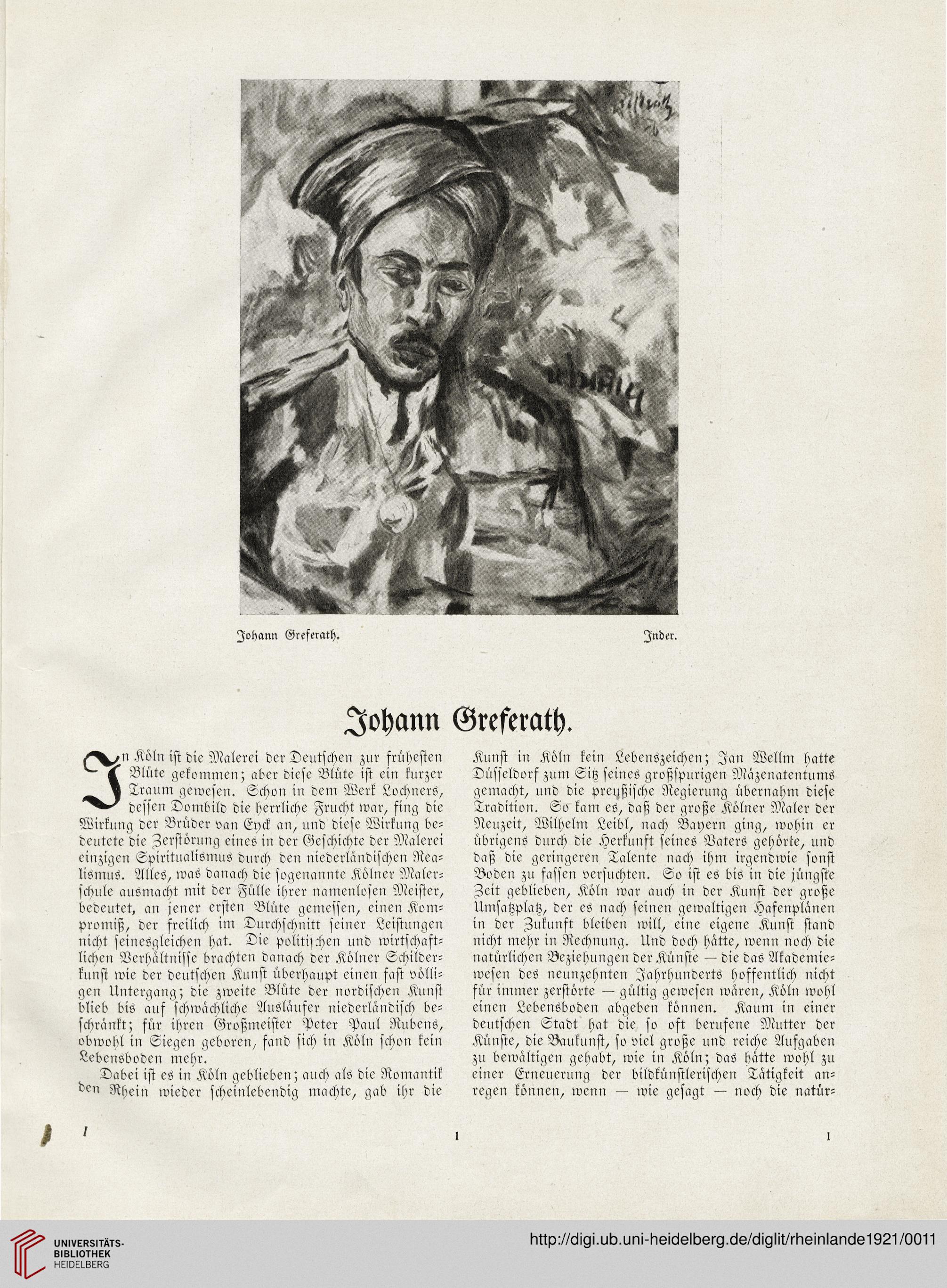Johann Greferath.
n Köln ist die Malerei der Deutschen zur frühesten
Blüte gekommen; aber diese Blüte ist ein kurzer
Traum gewesen. Schon in dem Werk Lochners,
dessen Dombild die herrliche Frucht war, fing die
Wirkung der Brüder van Eyck an, und diese Wirkung be-
deutete die Zerstörung eines in der Geschichte der Malerei
einzigen Spiritualismus durch den niederländischen Rea-
lismus. Alles, was danach die sogenannte Kölner Maler-
schule ausmacht mit der Fülle ihrer namenlosen Meister,
bedeutet, an jener ersten Blüte gemessen, einen Kom-
promiß, der freilich im Durchschnitt seiner Leistungen
nicht seinesgleichen hat. Die politischen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse brachten danach der Kölner Schilder-
kunst wie der deutschen Kunst überhaupt einen fast völli-
gen Untergang; die zweite Blüte der nordischen Kunst
blieb bis auf schwächliche Ausläufer niederländisch be-
schränkt; für ihren Großmeister Peter Paul Rubens,
obwohl in Siegen geboren, fand sich in Köln schon kein
Lebensboden mehr.
Dabei ist es in Köln geblieben; auch als die Romantik
den Rhein wieder scheinlebendig machte, gab ihr die
Kunst in Köln kein Lebenszeichen; Jan Wellm hatte
Düsseldorf zum Sitz seines großspurigen Mäzenatentums
gemacht, und die preußische Regierung übernahm diese
Tradition. So kam es, daß der große Kölner Maler der
Neuzeit, Wilhelm Leibl, nach Bayern ging, wohin er-
übrigens durch die Herkunft seines Vaters gehörte, und
daß die geringeren Talente nach ihm irgendwie sonst
Boden zu fassen versuchten. So ist es bis in die jüngste
Zeit geblieben, Köln war auch in der Kunst der große
Umsatzplatz, der es nach seinen gewaltigen Hafenplänen
in der Ankunft bleiben will, eine eigene Kunst stand
nicht mehr in Rechnung. Und doch hätte, wenn noch die
natürlichen Beziehungen der Künste — die das Akademie-
wesen des neunzehnten Jahrhunderts hoffentlich nicht
für immer zerstörte — gültig gewesen wären, Köln wohl
einen Lebensboden abgeben können. Kaum in einer
deutschen Stadt hat die so oft berufene Mutter der
Künste, die Baukunst, so viel große und reiche Aufgaben
zu bewältigen gehabt, wie in Köln; das hätte wohl zu
einer Erneuerung der bildkünstlerischen Tätigkeit an-
regen können, wenn — wie gesagt — noch die natür-
i