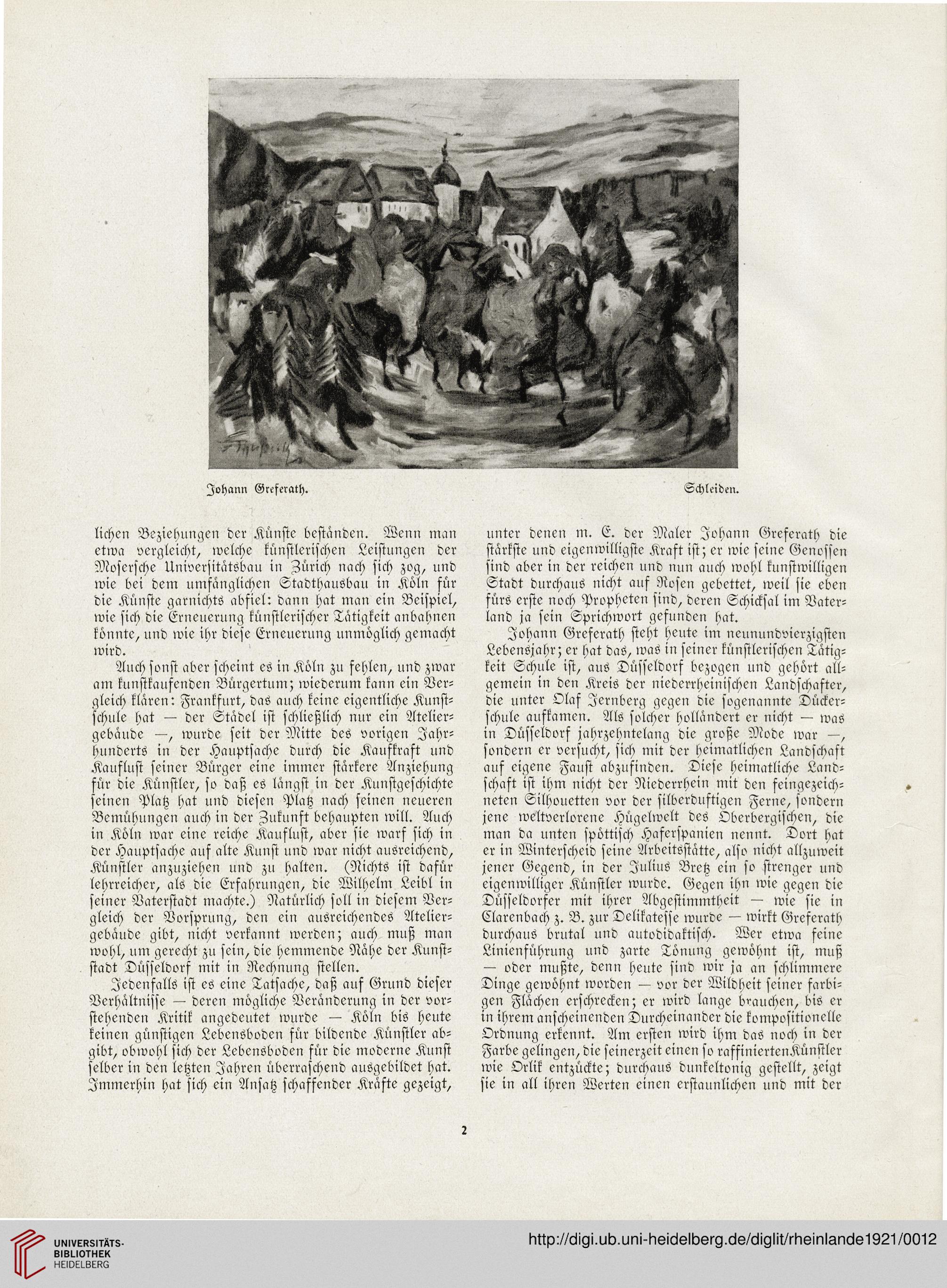Johann Greferath. Schleiden.
lichen Beziehungen der Künste beständen. Wenn man
etwa vergleicht, welche künstlerischen Leistungen der
Mosersche Universitätsbau in Zürich nach sich zog, und
wie bei dem umfänglichen Stadthallsbau in Köln für
die Künste garnichts abfiel: dann hat man ein Beispiel,
wie sich die Erneuerung künstlerischer Tätigkeit anbahnen
könnte, und wie ihr diese Erneuerung unmöglich gemacht
wird.
Auch sonst aber scheint es in Köln zu fehlen, und zwar
am kunstkaufenden Bürgertum; wiederum kann ein Ver-
gleich klären: Frankflirt, das auch keine eigentliche Kunst-
schule hat — der Städel ist schließlich nur ein Atelier-
gebäude —, wurde seit der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts in der Hauptsache durch die Kaufkraft und
Kauflust seiner Bürger eine immer stärkere Anziehung
für die Künstler, so daß es längst in der Kunstgeschichte
seinen Platz hat und diesen Platz nach seinen neueren
Bemühungen auch in der Zukunft behaupten will. Auch
in Köln war eine reiche Kauflust, aber sie warf sich in
der Hauptsache auf alte Kunst und war nicht ausreichend,
Künstler anzuziehen und zu halten. (Nichts ist dafür
lehrreicher, als die Erfahrungen, die Wilhelm Leibl in
seiner Vaterstadt machte.) Natürlich soll in diesem Ver-
gleich der Vorsprung, den ein ausreichendes Atelier-
gebäude gibt, nicht verkannt werden; auch muß man
wohl, um gerecht zu sein, die hemmende Nähe der Kunst-
stadt Düsseldorf mit in Rechnung stellen.
Jedenfalls ist es eine Tatsache, daß auf Grund dieser
Verhältnisse — deren mögliche Veränderung in der vor-
stehenden Kritik angedeutet wurde — Köln bis heute
keinen günstigen Lebensboden für bildende Künstler ab-
gibt, obwohl sich der Lebensboden für die moderne Kunst
selber in den letzten Jahren überraschend ausgebildet hat.
Immerhin hat sich ein Ansatz schaffender Kräfte gezeigt.
unter denen m. E. der Maler Johann Greferath die
stärkste und eigenwilligste Kraft ist; er wie seine Genossen
sind aber in der reichen und nun auch wohl kunstwilligen
Stadt durchaus nicht auf Rosen gebettet, weil sie eben
fürs erste noch Propheten sind, deren Schicksal im Vater-
land ja sein Sprichwort gefunden hat.
Johann Greferath steht heute im neunundvierzigsten
Lebensjahr; er hat das, was in seiner künstlerischen Tätig-
keit Schule ist, aus Düsseldorf bezogen und gehört all-
gemein in den Kreis der niederrheinischen Landschafter,
die unter Olaf Jernberg gegen die sogenannte Dücker-
schule aufkamen. Als solcher holländert er nicht — was
in Düsseldorf jahrzehntelang die große Mode war —,
sondern er versucht, sich mit der heimatlichen Landschaft
auf eigene Faust abzufinden. Diese heimatliche Land-
schaft ist ihm nicht der Niederrhein mit den feingezeich-
neten Silhouetten vor der silberduftigen Ferne, sondern
jene weltverlorene Hügelwelt des Oberbergischen, die
man da unten spöttisch Haferspanien nennt. Dort hat
er in Winterscheid seine Arbeitsstätte, also nicht allzuweit
jener Gegend, in der Julius Bretz ein so strenger und
eigenwilliger Künstler wurde. Gegen ihn wie gegen die
Düsseldorfer mit ihrer Abgestimmtheit — wie sie in
Clarenbach z. B. zur Delikatesse wurde — wirkt Greferath
durchaus brutal und autodidaktisch. Wer etwa feine
Linienführung und zarte Tönung gewöhnt ist, muß
— oder mußte, denn heute sind wir ja an schlimmere
Dinge gewöhnt worden — vor der Wildheit seiner farbi-
gen Flächen erschrecken; er wird lange brauchen, bis er
in ihrem anscheinenden Durcheinander die kompositionelle
Ordnung erkennt. Am ersten wird ihm das noch in der
Farbe gelingen, die seinerzeit einen so raffiniertenKünstler
wie Orlik entzückte; durchaus dunkeltonig gestellt, zeigt
sie in all ihren Werten einen erstaunlichen und mit der
2
lichen Beziehungen der Künste beständen. Wenn man
etwa vergleicht, welche künstlerischen Leistungen der
Mosersche Universitätsbau in Zürich nach sich zog, und
wie bei dem umfänglichen Stadthallsbau in Köln für
die Künste garnichts abfiel: dann hat man ein Beispiel,
wie sich die Erneuerung künstlerischer Tätigkeit anbahnen
könnte, und wie ihr diese Erneuerung unmöglich gemacht
wird.
Auch sonst aber scheint es in Köln zu fehlen, und zwar
am kunstkaufenden Bürgertum; wiederum kann ein Ver-
gleich klären: Frankflirt, das auch keine eigentliche Kunst-
schule hat — der Städel ist schließlich nur ein Atelier-
gebäude —, wurde seit der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts in der Hauptsache durch die Kaufkraft und
Kauflust seiner Bürger eine immer stärkere Anziehung
für die Künstler, so daß es längst in der Kunstgeschichte
seinen Platz hat und diesen Platz nach seinen neueren
Bemühungen auch in der Zukunft behaupten will. Auch
in Köln war eine reiche Kauflust, aber sie warf sich in
der Hauptsache auf alte Kunst und war nicht ausreichend,
Künstler anzuziehen und zu halten. (Nichts ist dafür
lehrreicher, als die Erfahrungen, die Wilhelm Leibl in
seiner Vaterstadt machte.) Natürlich soll in diesem Ver-
gleich der Vorsprung, den ein ausreichendes Atelier-
gebäude gibt, nicht verkannt werden; auch muß man
wohl, um gerecht zu sein, die hemmende Nähe der Kunst-
stadt Düsseldorf mit in Rechnung stellen.
Jedenfalls ist es eine Tatsache, daß auf Grund dieser
Verhältnisse — deren mögliche Veränderung in der vor-
stehenden Kritik angedeutet wurde — Köln bis heute
keinen günstigen Lebensboden für bildende Künstler ab-
gibt, obwohl sich der Lebensboden für die moderne Kunst
selber in den letzten Jahren überraschend ausgebildet hat.
Immerhin hat sich ein Ansatz schaffender Kräfte gezeigt.
unter denen m. E. der Maler Johann Greferath die
stärkste und eigenwilligste Kraft ist; er wie seine Genossen
sind aber in der reichen und nun auch wohl kunstwilligen
Stadt durchaus nicht auf Rosen gebettet, weil sie eben
fürs erste noch Propheten sind, deren Schicksal im Vater-
land ja sein Sprichwort gefunden hat.
Johann Greferath steht heute im neunundvierzigsten
Lebensjahr; er hat das, was in seiner künstlerischen Tätig-
keit Schule ist, aus Düsseldorf bezogen und gehört all-
gemein in den Kreis der niederrheinischen Landschafter,
die unter Olaf Jernberg gegen die sogenannte Dücker-
schule aufkamen. Als solcher holländert er nicht — was
in Düsseldorf jahrzehntelang die große Mode war —,
sondern er versucht, sich mit der heimatlichen Landschaft
auf eigene Faust abzufinden. Diese heimatliche Land-
schaft ist ihm nicht der Niederrhein mit den feingezeich-
neten Silhouetten vor der silberduftigen Ferne, sondern
jene weltverlorene Hügelwelt des Oberbergischen, die
man da unten spöttisch Haferspanien nennt. Dort hat
er in Winterscheid seine Arbeitsstätte, also nicht allzuweit
jener Gegend, in der Julius Bretz ein so strenger und
eigenwilliger Künstler wurde. Gegen ihn wie gegen die
Düsseldorfer mit ihrer Abgestimmtheit — wie sie in
Clarenbach z. B. zur Delikatesse wurde — wirkt Greferath
durchaus brutal und autodidaktisch. Wer etwa feine
Linienführung und zarte Tönung gewöhnt ist, muß
— oder mußte, denn heute sind wir ja an schlimmere
Dinge gewöhnt worden — vor der Wildheit seiner farbi-
gen Flächen erschrecken; er wird lange brauchen, bis er
in ihrem anscheinenden Durcheinander die kompositionelle
Ordnung erkennt. Am ersten wird ihm das noch in der
Farbe gelingen, die seinerzeit einen so raffiniertenKünstler
wie Orlik entzückte; durchaus dunkeltonig gestellt, zeigt
sie in all ihren Werten einen erstaunlichen und mit der
2