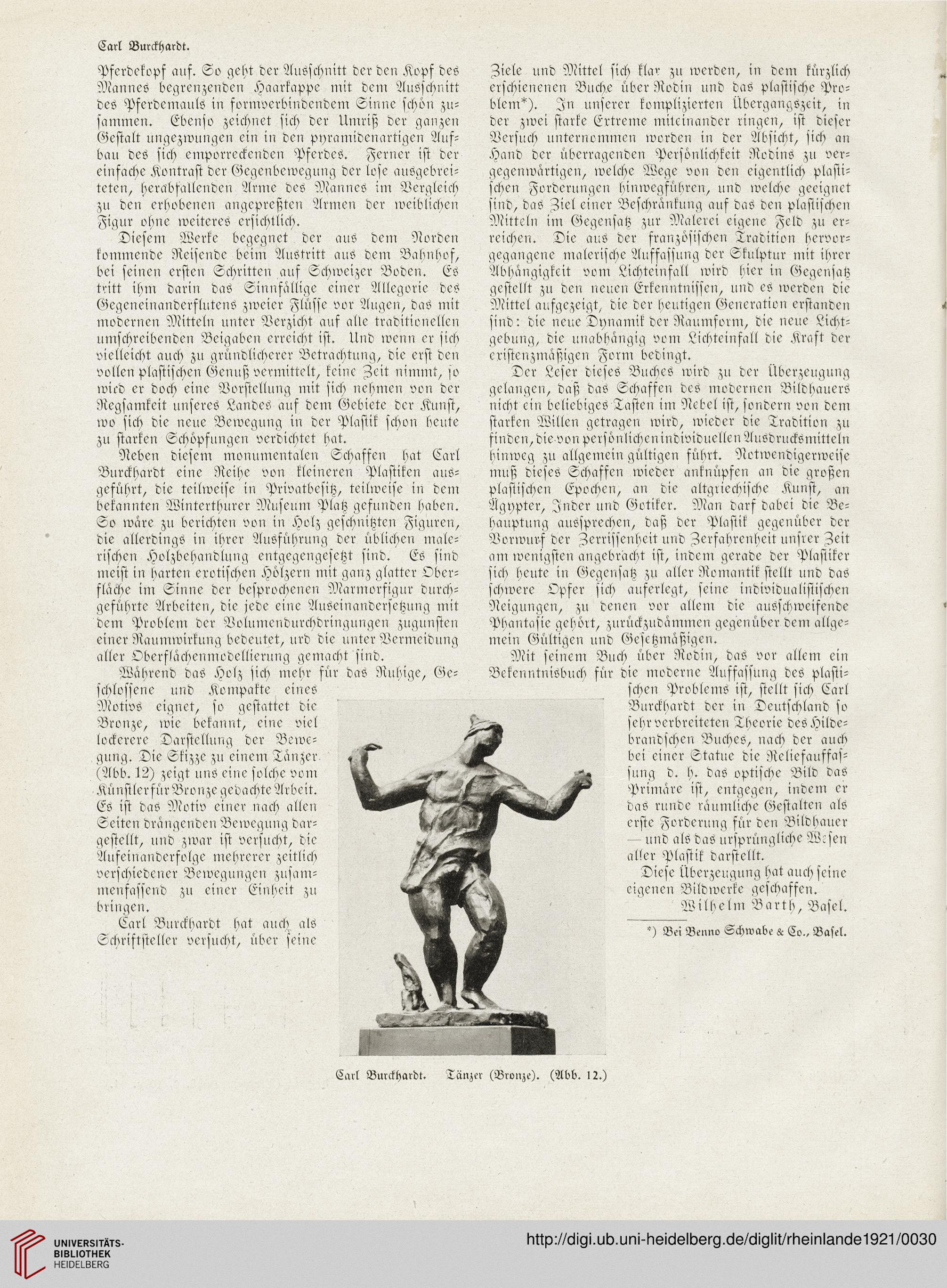Carl Burckhardt.
Pferdekopf auf. So geht der Ausschnitt der den Kopf des
Mannes begrenzenden Haarkappe mit deni Ausschnitt
des Pfcrdemauls in formoerbindendem Sinne schön zu-
sammen. Ebenso zeichnet sich der Umriß der ganzen
Gestalt ungezwungen ein in den pyramidenartigen Auf-
bau des sich emporreckenden Pferdes. Ferner ist der
einfache Kontrast der Gegenbewegung der lose ausgebrei-
teten, herabfallenden Arme des Mannes im Vergleich
zu den erhobenen angepreßten Armen der weiblichen
Figur ohne weiteres ersichtlich.
Diesem Werke begegnet der aus dem Norden
kommende Reisende beim Austritt aus dem Bahnhof,
bei seinen ersten Schritten auf Schweizer Boden. Es
tritt ihm darin das Sinnfällige einer Allegorie des
Gegeneinanderflutens zweier Flüsse vor Augen, das mit
modernen Mitteln unter Verzicht auf alle traditionellen
umschreibenden Beigaben erreicht ist. Und wenn er sich
vielleicht auch zu gründlicherer Betrachtung, die erst den
vollen plastischen Genuß vermittelt, keine Zeit nimmt, so
wicd er doch eine Vorstellung mit sich nehmen von der
Regsamkeit unseres Landes auf dem Gebiete der Kunst,
wo sich die neue Bewegung in der Plastik schon beute
zu starken Schöpfungen verdichtet hat.
Neben diesem monumentalen Schaffen hat Carl
Burckhardt eine Reihe von kleineren Plastiken aus-
geführt, die teilweise in Privatbesitz, teilweise in dem
bekannten Winterthurer Museum Platz gefunden baben.
So wäre zu berichten von in Holz geschnitzten Figuren,
die allerdings in ihrer Ausführung der üblichen male-
rischen Holzbehandlung entgegengesetzt sind. Es sind
meist in harten erotischen Hölzern mit ganz glatter Ober-
fläche im Sinne der besprochenen Marmorfigur durch-
geführte Arbeiten, die jede eine Auseinandersetzung mit
dem Problem der Volumendurchdringungen zugunsten
einer Raumwirkung bedeutet, urd die unter Vermeidung
aller Oberflächenmodellierung gemacht sind.
Wäbrend das Holz sich mehr für das Ruhige, Ge-
schlossene und Kompakte eines
Motivs eignet, so gestattet die
Bronze, wie bekannt, eine viel
leckerere Darstellung der Bewe¬
gung. Die Skizze zu einem Tänzer
(Abb. 12) zeigt uns eine solche vom
Künstlerfür Bronze gedachte Arbeit.
Es ist das Motiv einer nach allen
Seiten drängenden Bewegung dar-
gestellt, und zwar ist versucht, die
Aufeinanderfolge mehrerer zeitlich
verschiedener Bewegungen zusam-
menfasscnd zu einer Einheit zu
bringen.
Carl Burckhardt hat auch als
Schriftsteller versucht, über seine
Ziele und Mittel sich klar zu werden, in dem kürzlich
erschienenen Buche über Rodin und das plastische Pro-
blem*). In unserer komplizierten Übergangszeit, in
der zwei starke Ertreme miteinander ringen, ist dieser
Versuch unternommen worden in der Absicht, sich an
Hand der überragenden Persönlichkeit Rodins zu ver-
gegenwärtigen, welche Wege von den eigentlich plasti-
schen Forderungen hinwegführen, und welche geeignet
sind, das Ziel einer Beschränkung auf das deu plastischen
Mitteln im Gegensatz zur Malerei eigene Feld zu er-
reichen. Die aus der französischen Tradition hervor-
gegangene malerische Auffassung der Skulptur mit ihrer
Abhängigkeit vorn Lichteirifall wird hier in Gegensatz
gestellt zu den neuen Erkenntnissen, und es werden die
Nüttel aufgezeigt, die der heutigen Generation erstanden
sind: die neue Dynamik der Raumform, die neue Licht-
gebung, die unabhängig vom Lichteinfall die Kraft der
eristenzmaßigen Form bedingt.
Der Leser dieses Buches wird zu der Überzeugung
gelangen, daß das Schaffen des modernen Bildhauers
nicht ein beliebiges Tasten im Nebel ist, sondern von dem
starken Willen getragen wird, wieder die Tradition zu
finden, die von persönlichcnindividuellen Ausdrucksmitteln
hinweg zu allgemein gültigen fübrt. Notwendigerweise
muß dieses Schaffen wieder anknüpfen an die großen
plastischen Epochen, an die altgriechische Kunst, an
Ägypter, Inder und Gotikcr. Man darf dabei die Be-
hauptung aussprechen, daß der Plastik gegenüber der
Vorwurf der Zerrissenheit und Zerfahrenheit unsrer Zeit
am wenigsten angebracht ist, indem gerade der Plastiker
sich heute in Gegensatz zu aller Romantik stellt und das
schwere Opfer sich auferlegt, seine individualistischen
Neigungen, zu denen vor allem die ausschweifende
Phantasie gehört, zurückzudammcn gegenüber dem allge-
mein Gültigen und Gesetzmäßigen.
Mit seinem Buch über Rodin, das vor allem ein
Bekenntnisbuch für die moderne Auffassung des plasti-
schen Problems ist, stellt sich Carl
Burckhardt der in Deutschland so
sehr verbreiteten Theorie desHilde-
brandschen Buches, nach der aucb
bei einer Statue die Reliefauffas-
sung d. h. das optische Bild das
Primäre ist, entgegen, indem er
das runde räumliche Gestalten als
erste Forderung für den Bildhauer
— und als das ursprüngliche Wcsen
aller Plastik darstellt.
Diese Überzeugung hat auch seine
eigenen Bildwerke geschaffen.
Wilhelm Barth, Basel.
") Bei Benno Schwabe Si Co., Basel.
Carl Burckhardt. Tänzer (Bronze). (Abb. 12.)
Pferdekopf auf. So geht der Ausschnitt der den Kopf des
Mannes begrenzenden Haarkappe mit deni Ausschnitt
des Pfcrdemauls in formoerbindendem Sinne schön zu-
sammen. Ebenso zeichnet sich der Umriß der ganzen
Gestalt ungezwungen ein in den pyramidenartigen Auf-
bau des sich emporreckenden Pferdes. Ferner ist der
einfache Kontrast der Gegenbewegung der lose ausgebrei-
teten, herabfallenden Arme des Mannes im Vergleich
zu den erhobenen angepreßten Armen der weiblichen
Figur ohne weiteres ersichtlich.
Diesem Werke begegnet der aus dem Norden
kommende Reisende beim Austritt aus dem Bahnhof,
bei seinen ersten Schritten auf Schweizer Boden. Es
tritt ihm darin das Sinnfällige einer Allegorie des
Gegeneinanderflutens zweier Flüsse vor Augen, das mit
modernen Mitteln unter Verzicht auf alle traditionellen
umschreibenden Beigaben erreicht ist. Und wenn er sich
vielleicht auch zu gründlicherer Betrachtung, die erst den
vollen plastischen Genuß vermittelt, keine Zeit nimmt, so
wicd er doch eine Vorstellung mit sich nehmen von der
Regsamkeit unseres Landes auf dem Gebiete der Kunst,
wo sich die neue Bewegung in der Plastik schon beute
zu starken Schöpfungen verdichtet hat.
Neben diesem monumentalen Schaffen hat Carl
Burckhardt eine Reihe von kleineren Plastiken aus-
geführt, die teilweise in Privatbesitz, teilweise in dem
bekannten Winterthurer Museum Platz gefunden baben.
So wäre zu berichten von in Holz geschnitzten Figuren,
die allerdings in ihrer Ausführung der üblichen male-
rischen Holzbehandlung entgegengesetzt sind. Es sind
meist in harten erotischen Hölzern mit ganz glatter Ober-
fläche im Sinne der besprochenen Marmorfigur durch-
geführte Arbeiten, die jede eine Auseinandersetzung mit
dem Problem der Volumendurchdringungen zugunsten
einer Raumwirkung bedeutet, urd die unter Vermeidung
aller Oberflächenmodellierung gemacht sind.
Wäbrend das Holz sich mehr für das Ruhige, Ge-
schlossene und Kompakte eines
Motivs eignet, so gestattet die
Bronze, wie bekannt, eine viel
leckerere Darstellung der Bewe¬
gung. Die Skizze zu einem Tänzer
(Abb. 12) zeigt uns eine solche vom
Künstlerfür Bronze gedachte Arbeit.
Es ist das Motiv einer nach allen
Seiten drängenden Bewegung dar-
gestellt, und zwar ist versucht, die
Aufeinanderfolge mehrerer zeitlich
verschiedener Bewegungen zusam-
menfasscnd zu einer Einheit zu
bringen.
Carl Burckhardt hat auch als
Schriftsteller versucht, über seine
Ziele und Mittel sich klar zu werden, in dem kürzlich
erschienenen Buche über Rodin und das plastische Pro-
blem*). In unserer komplizierten Übergangszeit, in
der zwei starke Ertreme miteinander ringen, ist dieser
Versuch unternommen worden in der Absicht, sich an
Hand der überragenden Persönlichkeit Rodins zu ver-
gegenwärtigen, welche Wege von den eigentlich plasti-
schen Forderungen hinwegführen, und welche geeignet
sind, das Ziel einer Beschränkung auf das deu plastischen
Mitteln im Gegensatz zur Malerei eigene Feld zu er-
reichen. Die aus der französischen Tradition hervor-
gegangene malerische Auffassung der Skulptur mit ihrer
Abhängigkeit vorn Lichteirifall wird hier in Gegensatz
gestellt zu den neuen Erkenntnissen, und es werden die
Nüttel aufgezeigt, die der heutigen Generation erstanden
sind: die neue Dynamik der Raumform, die neue Licht-
gebung, die unabhängig vom Lichteinfall die Kraft der
eristenzmaßigen Form bedingt.
Der Leser dieses Buches wird zu der Überzeugung
gelangen, daß das Schaffen des modernen Bildhauers
nicht ein beliebiges Tasten im Nebel ist, sondern von dem
starken Willen getragen wird, wieder die Tradition zu
finden, die von persönlichcnindividuellen Ausdrucksmitteln
hinweg zu allgemein gültigen fübrt. Notwendigerweise
muß dieses Schaffen wieder anknüpfen an die großen
plastischen Epochen, an die altgriechische Kunst, an
Ägypter, Inder und Gotikcr. Man darf dabei die Be-
hauptung aussprechen, daß der Plastik gegenüber der
Vorwurf der Zerrissenheit und Zerfahrenheit unsrer Zeit
am wenigsten angebracht ist, indem gerade der Plastiker
sich heute in Gegensatz zu aller Romantik stellt und das
schwere Opfer sich auferlegt, seine individualistischen
Neigungen, zu denen vor allem die ausschweifende
Phantasie gehört, zurückzudammcn gegenüber dem allge-
mein Gültigen und Gesetzmäßigen.
Mit seinem Buch über Rodin, das vor allem ein
Bekenntnisbuch für die moderne Auffassung des plasti-
schen Problems ist, stellt sich Carl
Burckhardt der in Deutschland so
sehr verbreiteten Theorie desHilde-
brandschen Buches, nach der aucb
bei einer Statue die Reliefauffas-
sung d. h. das optische Bild das
Primäre ist, entgegen, indem er
das runde räumliche Gestalten als
erste Forderung für den Bildhauer
— und als das ursprüngliche Wcsen
aller Plastik darstellt.
Diese Überzeugung hat auch seine
eigenen Bildwerke geschaffen.
Wilhelm Barth, Basel.
") Bei Benno Schwabe Si Co., Basel.
Carl Burckhardt. Tänzer (Bronze). (Abb. 12.)