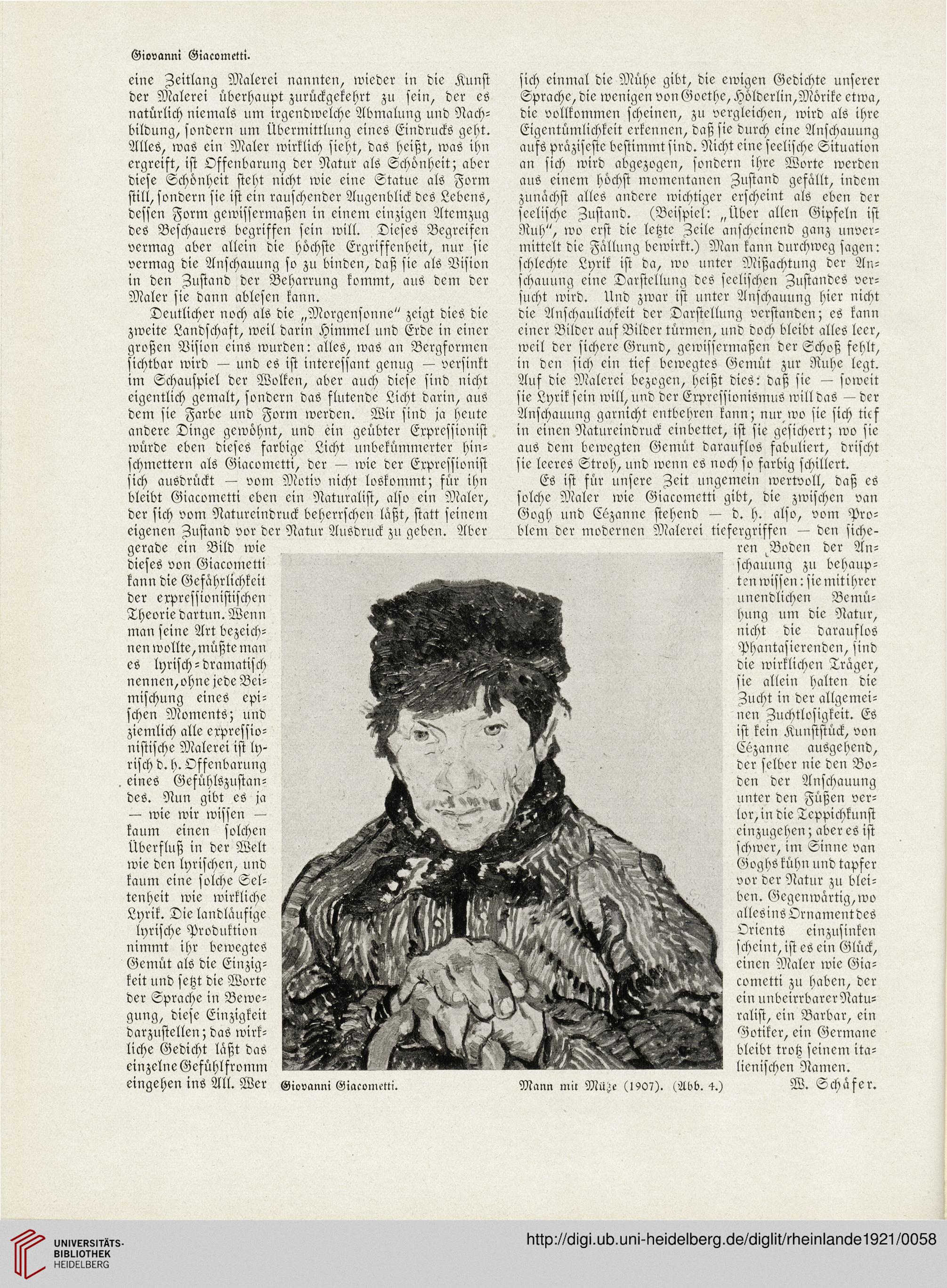Giovanni Giacometti.
eine Zeitlang Malerei nannten, wieder in die Kunst
der Malerei überhaupt zurückgekehrt zu sein, der es
natürlich niemals um irgendwelche Abmalung und Nach-
bildung, sondern um Übermittlung eines Eindrucks geht.
Alles, was ein Maler wirklich sieht, das heißt, was ihn
ergreift, ist Offenbarung der Natur als Schönheit; aber
diese Schönheit steht nicht wie eine Statue als Form
still, sondern sie ist ein rauschender Augenblick des Lebens,
dessen Form gewissermaßen in einem einzigen Atemzug
des Beschauers begriffen sein will. Dieses Begreifen
vermag aber allein die höchste Ergriffenheit, nur sie
vermag die Anschauung so zu binden, daß sie als Vision
in den Zustand der Beharrung kommt, aus dem der
Maler sie dann ablesen kann.
Deutlicher noch als die „Morgensonne" zeigt dies die
zweite Landschaft, weil darin Himmel und Erde in einer
großen Vision eins wurden: alles, was an Bergformen
sichtbar wird — und es ist interessant genug — versinkt
im Schauspiel der Wolken, aber auch diese sind nicht
eigentlich gemalt, sondern das flutende Licht darin, aus
dem sie Farbe und Form werden. Wir sind ja heute
andere Dinge gewöhnt, und ein geübter Expressionist
würde eben dieses farbige Licht unbekümmerter hin-
schmettern als Giacometti, der — wie der Expressionist
sich ausdrückt — vom Motiv nicht loskommt; für ihn
bleibt Giacometti eben ein Naturalist, also ein Maler,
der sich vom Natureindruck beherrschen laßt, statt seinem
eigenen Zustand vor der Natur Ausdruck zu geben. Aber
gerade ein Bild wie
dieses von Giacometti
kann die Gefährlichkeit
der expressionistischen
Theorie dartun. Wenn
man seine Art bezeich-
nen wollte, müßte man
es lyrisch-dramatisch
nennen,ohnejede Bei¬
mischung eines epi¬
schen Moments; und
ziemlich alle expressio-
nistische Malerei ist ly-
risch d. h. Offenbarung
eines Gefühlszustan¬
des. Nun gibt es ja
— wie wir wissen —
kaum einen solchen
Überfluß in der Welt
wie den lyrischen, und
kaum eine solche Sel-
tenheit wie wirkliche
Lyrik. Die landläufige
lyrische Produktion
nimmt ihr bewegtes
Gemüt als die Einzig-
keit und setzt die Worte
der Sprache in Bewe¬
gung, diese Einzigkeit
darzustellen; das wirk¬
liche Gedicht laßt das
einzelne Gcfühlfromm
eingehen ins All. Wer
sich einmal die Mühe gibt, die ewigen Gedichte unserer
Sprache, die wenigen von Goethe, Hölderlin,Mörike etwa,
die vollkommen scheinen, zu vergleichen, wird als ihre
Eigentümlichkeit erkennen, daß sie durch eine Anschauung
aufs präziseste bestimmt sind. Nicht eine seelische Situation
an sich wird abgezogen, sondern ihre Worte werden
aus einem höchst momentanen Zustand gefallt, indem
zunächst alles andere wichtiger erscheint als eben der
seelische Zustand. (Beispiel: „Über allen Gipfeln ist
Ruh", wo erst die letzte Zeile anscheinend ganz unver-
mittelt die Fällung bewirkt.) Man kann durchweg sagen:
schlechte Lyrik ist da, wo unter Mißachtung der An-
schauung eine Darstellung des seelischen Zustandes ver-
sucht wird. Und zwar ist unter Anschauung hier nicht
die Anschaulichkeit der Darstellung verstanden; es kann
einer Bilder auf Bilder türmen, und doch bleibt alles leer,
weil der sichere Grund, gewissermaßen der Schoß fehlt,
in den sich ein tief bewegtes Gemüt zur Ruhe legt.
Auf die Malerei bezogen, heißt dies: daß sie — soweit
sie Lyrik sein will, und der Expressionismus will das — der
Anschauung garnicht entbehren kann; nur,wo sie sich ticf
in einen Natureindruck cinbettet, ist sie gesichert; wo sie
aus dem bewegten Gemüt darauflos fabuliert, drischt
sie leeres Stroh, und wenn es noch so farbig schillert.
Es ist für unsere Zeit ungemein wertvoll, daß es
solche Maler wie Giacometti gibt, die zwischen van
Gogh und Cezanne stehend — d. h. also, vom Pro-
blem der modernen Malerei tiefergriffen — den siche-
ren ^Boden der An-
schauung zu behaup-
ten wissen: siemitihrer
unendlichen Bemü-
hung um die Natur,
nicht die darauflos
Phantasierenden, sind
die wirklichen Träger,
sie allein halten die
Jucht in der allgemei-
nen Zuchtlosigkeit. Es
ist kein Kunststück, von
Cezanne ausgehend,
der selber nie den Bo-
den der Anschauung
unter den Füßen ver-
loren die Teppichkunst
einzugehen; aber es ist
schwer, im Sinne van
Goghs kühn und tapfer
vor der Natur zu blei-
ben. Gegenwärtig, wo
allesins Ornamentdes
Orients einzusinken
scheint, ist es ein Glück,
einen Maler wie Gia-
cometti zu haben, der
ein unbeirrbarer Natu-
ralist, ein Barbar, ein
Gotiker, ein Germane
bleibt trotz seinem ita-
lienischen Namen.
W. Schäfer.
Giovanni Giacomotli.
eine Zeitlang Malerei nannten, wieder in die Kunst
der Malerei überhaupt zurückgekehrt zu sein, der es
natürlich niemals um irgendwelche Abmalung und Nach-
bildung, sondern um Übermittlung eines Eindrucks geht.
Alles, was ein Maler wirklich sieht, das heißt, was ihn
ergreift, ist Offenbarung der Natur als Schönheit; aber
diese Schönheit steht nicht wie eine Statue als Form
still, sondern sie ist ein rauschender Augenblick des Lebens,
dessen Form gewissermaßen in einem einzigen Atemzug
des Beschauers begriffen sein will. Dieses Begreifen
vermag aber allein die höchste Ergriffenheit, nur sie
vermag die Anschauung so zu binden, daß sie als Vision
in den Zustand der Beharrung kommt, aus dem der
Maler sie dann ablesen kann.
Deutlicher noch als die „Morgensonne" zeigt dies die
zweite Landschaft, weil darin Himmel und Erde in einer
großen Vision eins wurden: alles, was an Bergformen
sichtbar wird — und es ist interessant genug — versinkt
im Schauspiel der Wolken, aber auch diese sind nicht
eigentlich gemalt, sondern das flutende Licht darin, aus
dem sie Farbe und Form werden. Wir sind ja heute
andere Dinge gewöhnt, und ein geübter Expressionist
würde eben dieses farbige Licht unbekümmerter hin-
schmettern als Giacometti, der — wie der Expressionist
sich ausdrückt — vom Motiv nicht loskommt; für ihn
bleibt Giacometti eben ein Naturalist, also ein Maler,
der sich vom Natureindruck beherrschen laßt, statt seinem
eigenen Zustand vor der Natur Ausdruck zu geben. Aber
gerade ein Bild wie
dieses von Giacometti
kann die Gefährlichkeit
der expressionistischen
Theorie dartun. Wenn
man seine Art bezeich-
nen wollte, müßte man
es lyrisch-dramatisch
nennen,ohnejede Bei¬
mischung eines epi¬
schen Moments; und
ziemlich alle expressio-
nistische Malerei ist ly-
risch d. h. Offenbarung
eines Gefühlszustan¬
des. Nun gibt es ja
— wie wir wissen —
kaum einen solchen
Überfluß in der Welt
wie den lyrischen, und
kaum eine solche Sel-
tenheit wie wirkliche
Lyrik. Die landläufige
lyrische Produktion
nimmt ihr bewegtes
Gemüt als die Einzig-
keit und setzt die Worte
der Sprache in Bewe¬
gung, diese Einzigkeit
darzustellen; das wirk¬
liche Gedicht laßt das
einzelne Gcfühlfromm
eingehen ins All. Wer
sich einmal die Mühe gibt, die ewigen Gedichte unserer
Sprache, die wenigen von Goethe, Hölderlin,Mörike etwa,
die vollkommen scheinen, zu vergleichen, wird als ihre
Eigentümlichkeit erkennen, daß sie durch eine Anschauung
aufs präziseste bestimmt sind. Nicht eine seelische Situation
an sich wird abgezogen, sondern ihre Worte werden
aus einem höchst momentanen Zustand gefallt, indem
zunächst alles andere wichtiger erscheint als eben der
seelische Zustand. (Beispiel: „Über allen Gipfeln ist
Ruh", wo erst die letzte Zeile anscheinend ganz unver-
mittelt die Fällung bewirkt.) Man kann durchweg sagen:
schlechte Lyrik ist da, wo unter Mißachtung der An-
schauung eine Darstellung des seelischen Zustandes ver-
sucht wird. Und zwar ist unter Anschauung hier nicht
die Anschaulichkeit der Darstellung verstanden; es kann
einer Bilder auf Bilder türmen, und doch bleibt alles leer,
weil der sichere Grund, gewissermaßen der Schoß fehlt,
in den sich ein tief bewegtes Gemüt zur Ruhe legt.
Auf die Malerei bezogen, heißt dies: daß sie — soweit
sie Lyrik sein will, und der Expressionismus will das — der
Anschauung garnicht entbehren kann; nur,wo sie sich ticf
in einen Natureindruck cinbettet, ist sie gesichert; wo sie
aus dem bewegten Gemüt darauflos fabuliert, drischt
sie leeres Stroh, und wenn es noch so farbig schillert.
Es ist für unsere Zeit ungemein wertvoll, daß es
solche Maler wie Giacometti gibt, die zwischen van
Gogh und Cezanne stehend — d. h. also, vom Pro-
blem der modernen Malerei tiefergriffen — den siche-
ren ^Boden der An-
schauung zu behaup-
ten wissen: siemitihrer
unendlichen Bemü-
hung um die Natur,
nicht die darauflos
Phantasierenden, sind
die wirklichen Träger,
sie allein halten die
Jucht in der allgemei-
nen Zuchtlosigkeit. Es
ist kein Kunststück, von
Cezanne ausgehend,
der selber nie den Bo-
den der Anschauung
unter den Füßen ver-
loren die Teppichkunst
einzugehen; aber es ist
schwer, im Sinne van
Goghs kühn und tapfer
vor der Natur zu blei-
ben. Gegenwärtig, wo
allesins Ornamentdes
Orients einzusinken
scheint, ist es ein Glück,
einen Maler wie Gia-
cometti zu haben, der
ein unbeirrbarer Natu-
ralist, ein Barbar, ein
Gotiker, ein Germane
bleibt trotz seinem ita-
lienischen Namen.
W. Schäfer.
Giovanni Giacomotli.