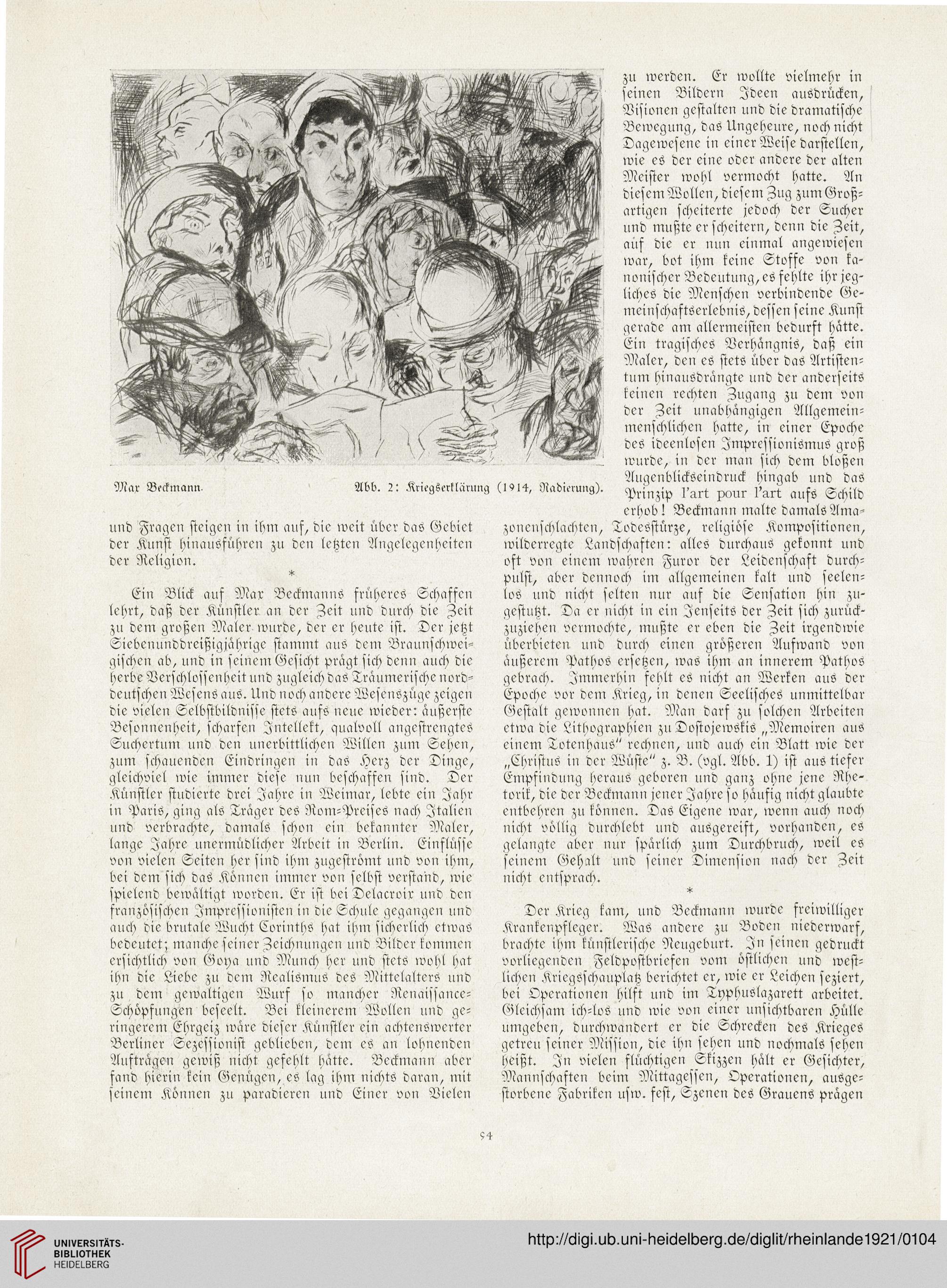Max Beckmann. Abb. 2: Kriegserklärung (I»I4, Radierung).
und Fragen steigen in ihm auf, die weit über das Gebiet
der Kunst hinaussühren zu den letzten Angelegenheiten
der Religion.
*
Ein Blick auf Mar Beckmanns früheres Schaffen
lehrt, daß der Künstler an der Zeit und durch die Zeit
zu dem großen Maler wurde, der er heute ist. Der jetzt
Siebcnunddreißigjährige stammt aus dem Braunschwei-
gischen ab, und in seinem Gesicht prägt sich denn auch die
herbe Verschlossenheit und zugleich das Träumerische nord-
deutschen Wesens aus. Und noch andere Wesenszüge zeigen
die vielen Selbstbildnisse stets aufs neue wieder: äußerste
Besonnenheit, scharfen Intellekt, qualvoll angestrengtes
Suchertum und den unerbittlichen Willen zum Sehen,
zum schauenden Eindringen in das Herz der Dinge,
gleichviel wie immer diese nun beschaffen sind. Der
Künstler studierte drei Jahre in Weimar, lebte ein Jahr
in Paris, ging als Träger des Rom-Preises nach Italien
und verbrachte, damals schon ein bekannter Maler,
lange Jahre unermüdlicher Arbeit in Berlin. Einflüsse
von vielen Seiten her sind ihm zugeströmt und von ihm,
bei dem sich das Können immer von selbst verstand, wie
spielend bewältigt worden. Er ist bei Delacroix und den
französischen Impressionisten in die Schule gegangen und
auch die brutale Wucht Corinths hat ihm sicherlich etwas
bedeutet; manche seiner Zeichnungen und Bilder kommen
ersichtlich von Goya und Munch her und stets wohl hat
ihn die Liebe zu dem Realismus des Mittelalters und
zu dem gewaltigen Wurf so mancher Renaissance-
Schöpfungen beseelt. Bei kleinerem Wollen und ge-
ringerem Ehrgeiz wäre dieser Künstler ein achtenswerter
Berliner Sezessionist geblieben, dem es an lohnenden
Aufträgen gewiß nicht gefehlt hätte. Beckmann aber
fand hierin kein Genügen, es lag ihm nichts daran, mit
seinem Können zu paradieren und Einer von Vielen
zu werden. Er wollte vielmehr in
seinen Bildern Ideen ausdrücken,
Visionen gestalten und die dramatische
Bewegung, das Ungeheure, noch nicht
Dagewesene in einer Weise darstellen,
wie es der eine oder andere der alten
Meister wohl vermocht hatte. An
diesem Wollen, diesem Zug zum Groß-
artigen scheiterte jedoch der Sucher
und mußte er scheitern, denn die Zeit,
aüf die er nun einmal angewiesen
war, bot ihm keine Stoffe von ka-
nonischer Bedeutung, es fehlte ihr jeg-
liches die Menschen verbindende Ge-
meinschaftserlebnis, dessen seine Kunst
gerade am allermeisten bedurft hätte.
Ein tragisches Verhängnis, daß ein
Maler, den es stets über das Artisten-
tum hinausdrängte rmd der anderseits
keinen rechten Zugang zu dem von
der Zeit unabhängigen Allgemein-
menschlichen hatte, in einer Epoche
des ideenlosen Impressionismus groß
wurde, in der man sich dem bloßen
Augenblickseindruck hingab und das
Prinzip I'art xour I'art aufs Schild
erhob! Beckmann malte damals Ama-
zonenschlachten, Todesstürze, religiöse Kompositionen,
wilderregte Landschaften: alles durchaus gekonnt und
oft von einem wahren Furor der Leidenschaft durch-
pulst, aber dennoch im allgemeinen kalt und seelen-
los und nicht selten nur auf die Sensation hin zu-
gestutzt. Da er nicht in ein Jenseits der Zeit sich zurück-
zuziehen vermochte, mußte er eben die Zeit irgendwie
überbieten und durch einen größeren Aufwand von
äußerem Pathos ersetzen, was ihm an innerem Pathos
gebrach. Immerhin fehlt es nicht an Werken aus der
Epoche vor dem Krieg, in denen Seelisches unmittelbar
Gestalt gewonnen hat. Man darf zu solchen Arbeiten
etwa die Lithographien zu Dostojewskis „Memoiren aus
einem Totenhaus" rechnen, und auch ein Blatt wie der
„Christus in der Wüste" z. B. (vgl. Abb. 1) ist aus tiefer
Empfindung heraus geboren und ganz ohne jene Rhe-
torik, die der Beckmann jener Jahre so häufig nicht glaubte
entbehren zu können. Das Eigene war, wenn auch noch
nicht völlig durchlebt und ausgereift, vorhanden, es
gelangte aber nur spärlich zum Durchbruch, weil es
seinem Gehalt und seiner Dimension nach der Zeit
nicht entsprach.
-i-
Der Krieg kam, und Beckmann wurde freiwilliger
Krankenpfleger. Was andere zu Boden niederwarf,
brachte ihm künstlerische Neugeburt. In seinen gedruckt
vorliegenden Feldpostbriefen vom östlichen und west-
lichen Kriegsschallplatz berichtet er, wie er Leichen seziert,
bei Operationen hilft und im Typhuslazarett arbeitet.
Gleichsam ich-los und wie von einer unsichtbaren Hülle
umgeben, durchwandert er die Schrecken des Krieges
getreu seiner Mission, die ihn sehen und nochmals sehen
heißt. In vielen flüchtigen Skizzen hält er Gesichter,
Mannschaften beim Mittagessen, Operationen, ausge-
storbene Fabriken usw. fest, Szenen des Grauens prägen
und Fragen steigen in ihm auf, die weit über das Gebiet
der Kunst hinaussühren zu den letzten Angelegenheiten
der Religion.
*
Ein Blick auf Mar Beckmanns früheres Schaffen
lehrt, daß der Künstler an der Zeit und durch die Zeit
zu dem großen Maler wurde, der er heute ist. Der jetzt
Siebcnunddreißigjährige stammt aus dem Braunschwei-
gischen ab, und in seinem Gesicht prägt sich denn auch die
herbe Verschlossenheit und zugleich das Träumerische nord-
deutschen Wesens aus. Und noch andere Wesenszüge zeigen
die vielen Selbstbildnisse stets aufs neue wieder: äußerste
Besonnenheit, scharfen Intellekt, qualvoll angestrengtes
Suchertum und den unerbittlichen Willen zum Sehen,
zum schauenden Eindringen in das Herz der Dinge,
gleichviel wie immer diese nun beschaffen sind. Der
Künstler studierte drei Jahre in Weimar, lebte ein Jahr
in Paris, ging als Träger des Rom-Preises nach Italien
und verbrachte, damals schon ein bekannter Maler,
lange Jahre unermüdlicher Arbeit in Berlin. Einflüsse
von vielen Seiten her sind ihm zugeströmt und von ihm,
bei dem sich das Können immer von selbst verstand, wie
spielend bewältigt worden. Er ist bei Delacroix und den
französischen Impressionisten in die Schule gegangen und
auch die brutale Wucht Corinths hat ihm sicherlich etwas
bedeutet; manche seiner Zeichnungen und Bilder kommen
ersichtlich von Goya und Munch her und stets wohl hat
ihn die Liebe zu dem Realismus des Mittelalters und
zu dem gewaltigen Wurf so mancher Renaissance-
Schöpfungen beseelt. Bei kleinerem Wollen und ge-
ringerem Ehrgeiz wäre dieser Künstler ein achtenswerter
Berliner Sezessionist geblieben, dem es an lohnenden
Aufträgen gewiß nicht gefehlt hätte. Beckmann aber
fand hierin kein Genügen, es lag ihm nichts daran, mit
seinem Können zu paradieren und Einer von Vielen
zu werden. Er wollte vielmehr in
seinen Bildern Ideen ausdrücken,
Visionen gestalten und die dramatische
Bewegung, das Ungeheure, noch nicht
Dagewesene in einer Weise darstellen,
wie es der eine oder andere der alten
Meister wohl vermocht hatte. An
diesem Wollen, diesem Zug zum Groß-
artigen scheiterte jedoch der Sucher
und mußte er scheitern, denn die Zeit,
aüf die er nun einmal angewiesen
war, bot ihm keine Stoffe von ka-
nonischer Bedeutung, es fehlte ihr jeg-
liches die Menschen verbindende Ge-
meinschaftserlebnis, dessen seine Kunst
gerade am allermeisten bedurft hätte.
Ein tragisches Verhängnis, daß ein
Maler, den es stets über das Artisten-
tum hinausdrängte rmd der anderseits
keinen rechten Zugang zu dem von
der Zeit unabhängigen Allgemein-
menschlichen hatte, in einer Epoche
des ideenlosen Impressionismus groß
wurde, in der man sich dem bloßen
Augenblickseindruck hingab und das
Prinzip I'art xour I'art aufs Schild
erhob! Beckmann malte damals Ama-
zonenschlachten, Todesstürze, religiöse Kompositionen,
wilderregte Landschaften: alles durchaus gekonnt und
oft von einem wahren Furor der Leidenschaft durch-
pulst, aber dennoch im allgemeinen kalt und seelen-
los und nicht selten nur auf die Sensation hin zu-
gestutzt. Da er nicht in ein Jenseits der Zeit sich zurück-
zuziehen vermochte, mußte er eben die Zeit irgendwie
überbieten und durch einen größeren Aufwand von
äußerem Pathos ersetzen, was ihm an innerem Pathos
gebrach. Immerhin fehlt es nicht an Werken aus der
Epoche vor dem Krieg, in denen Seelisches unmittelbar
Gestalt gewonnen hat. Man darf zu solchen Arbeiten
etwa die Lithographien zu Dostojewskis „Memoiren aus
einem Totenhaus" rechnen, und auch ein Blatt wie der
„Christus in der Wüste" z. B. (vgl. Abb. 1) ist aus tiefer
Empfindung heraus geboren und ganz ohne jene Rhe-
torik, die der Beckmann jener Jahre so häufig nicht glaubte
entbehren zu können. Das Eigene war, wenn auch noch
nicht völlig durchlebt und ausgereift, vorhanden, es
gelangte aber nur spärlich zum Durchbruch, weil es
seinem Gehalt und seiner Dimension nach der Zeit
nicht entsprach.
-i-
Der Krieg kam, und Beckmann wurde freiwilliger
Krankenpfleger. Was andere zu Boden niederwarf,
brachte ihm künstlerische Neugeburt. In seinen gedruckt
vorliegenden Feldpostbriefen vom östlichen und west-
lichen Kriegsschallplatz berichtet er, wie er Leichen seziert,
bei Operationen hilft und im Typhuslazarett arbeitet.
Gleichsam ich-los und wie von einer unsichtbaren Hülle
umgeben, durchwandert er die Schrecken des Krieges
getreu seiner Mission, die ihn sehen und nochmals sehen
heißt. In vielen flüchtigen Skizzen hält er Gesichter,
Mannschaften beim Mittagessen, Operationen, ausge-
storbene Fabriken usw. fest, Szenen des Grauens prägen