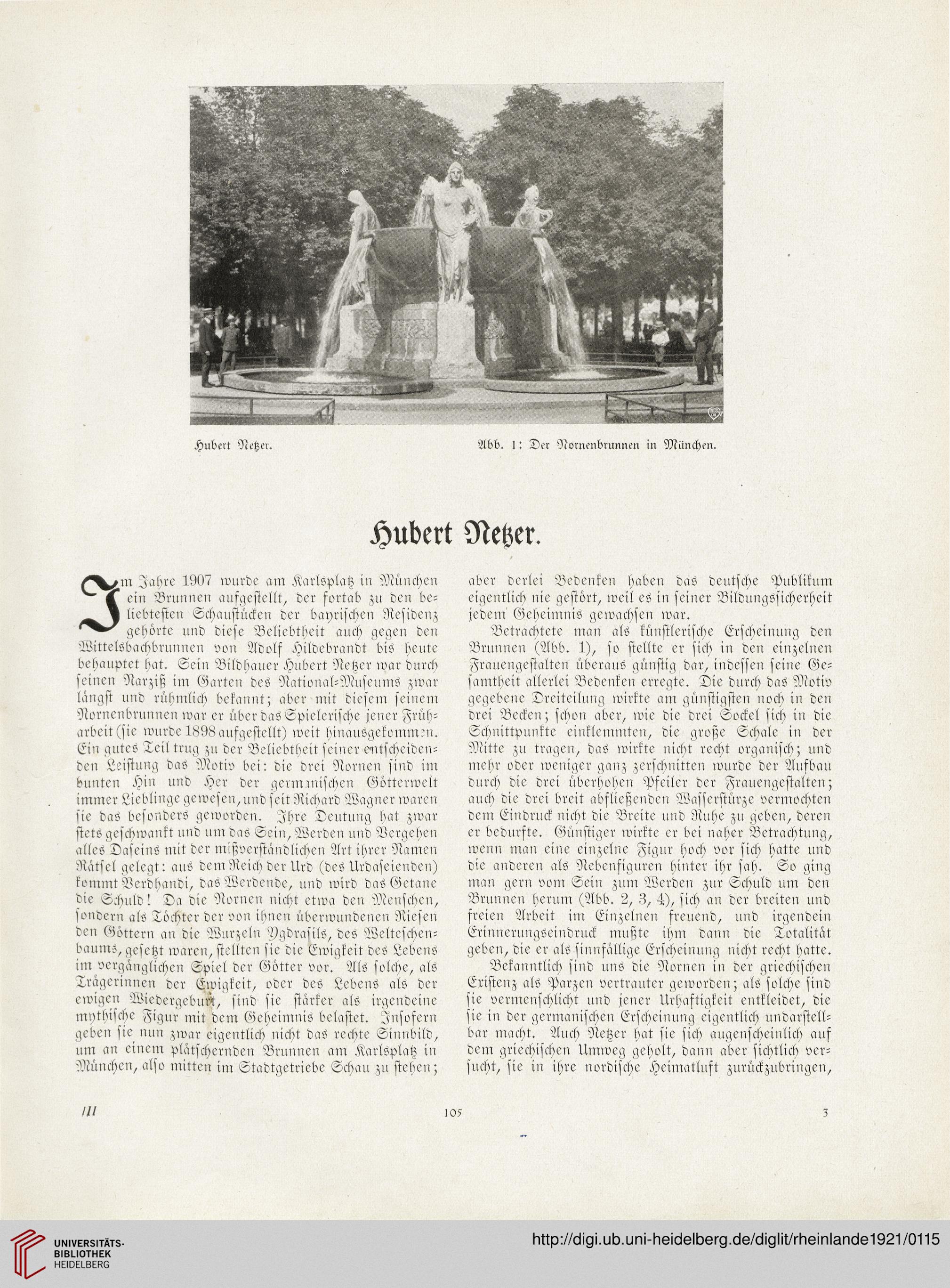Hubert Netzer. Abb. I: Der Nornenbrrmnen in München.
Hubert Netzer.
m Jahre 1907 wurde am Karlsplatz in München
ein Brunnen aufgestellt, der fortab zu den be-
liebtesten Schaustücken der bayrischen Residenz
gehörte und diese Beliebtheit auch gegen den
Wittelsbachbrunnen von Adolf Hildebrandt bis heute
behauptet hat. Sein Bildhauer Hubert Netzer war durch
seinen Narziß im Garten des National-Museums zwar
langst und rühmlich bekannt; aber mit diesem seinem
Nornenbrunnen war er über das Spielerische jener Früh-
arbeit (sie wurde 1898 aufgestellt) weit hinausgekommm.
Ein gutes Teil trug zu der Beliebtheit seiner entscheiden-
den Leistung das Motiv bei: die drei Nomen sind im
bunten Hin und Her der germanischen Götterwelt
immer Lieblinge gewesen, und seit Richard Wagner waren
sie das besonders geworden. Ihre Deutung hat zwar
stets geschwankt und um das Sein, Werden und Vergehen
alles Daseins mit der mißverständlichen Art ihrer Namen
Rätsel gelegt: aus dem Reich der Urd (des Urdaseienden)
kommt Verdhandi, das Werdende, und wird das Getane
die Schuld! Da die Normen nicht etwa den Menschen,
sondern als Töchter der von ihnen überwundenen Riesen
den Göttern an die Wurzeln Pgdrasils, des Welteschen-
baums, gesetzt waren, stellten sie die Ewigkeit des Lebens
im vergänglichen Spiel der Götter vor. Als solche, als
Trägerinnen der Ewigkeit, oder des Lebens als der
ewigen Wiedergeburt, sind sie stärker als irgendeine
mythische Figur mit dem Geheimnis belastet. Insofern
geben sie nun zwar eigentlich nicht das rechte Sinnbild,
um an einem plätschernden Brunnen am Karlsplatz in
München, also mitten im Stadtgetriebe Schau zu stehen;
aber derlei Bedenken haben das deutsche Publikum
eigentlich nie gestört, weil es in seiner Bildungssicherheit
jedem Geheimnis gewachsen war.
Betrachtete man als künstlerische Erscheinung den
Brunnen (Abb. 1), so stellte er sich in den einzelnen
Frauengestalten überaus günstig dar, indessen seine Ge-
samtheit allerlei Bedenken erregte. Die durch das Motiv
gegebene Dreiteilung wirkte am günstigsten noch in den
drei Becken; schon aber, wie die drei Sockel sich in die
Schnittpunkte einklemmten, die große Schale in der
Mitte zu tragen, das wirkte nicht recht organisch; und
mehr oder weniger ganz zerschnitten wurde der Aufbau
durch die drei überhohen Pfeiler der Frauengestalten;
auch die drei breit abfließenden Wasserstürze vermochten
dem Eindruck nicht die Breite und Ruhe zu geben, deren
er bedurfte. Günstiger wirkte er bei naher Betrachtung,
wenn man eine einzelne Figur hoch vor sich hatte und
die anderen als Nebenfiguren hinter ihr sah. So ging
inan gern vom Sein zum Werden zur Schuld um den
Brunnen herum (Abb. 2, 3, 4), sich an der breiten und
freien Arbeit im Einzelnen freuend, und irgendein
Erinnerungseindruck mußte ihm dann die Totalität
geben, die er als sinnfällige Erscheinung nicht recht hatte.
Bekanntlich sind uns die Nornen in der griechischen
Eristenz als Parzen vertrauter geworden; als solche sind
sie vermenschlicht und jener Urhaftigkeit entkleidet, die
sie in der germanischen Erscheinung eigentlich undarstell-
bar macht. Auch Netzer hat sie sich augenscheinlich auf
dem griechischen Umweg geholt, dann aber sichtlich ver-
sucht, sie in ihre nordische Heimatluft zurückzubringen,
///
105
Hubert Netzer.
m Jahre 1907 wurde am Karlsplatz in München
ein Brunnen aufgestellt, der fortab zu den be-
liebtesten Schaustücken der bayrischen Residenz
gehörte und diese Beliebtheit auch gegen den
Wittelsbachbrunnen von Adolf Hildebrandt bis heute
behauptet hat. Sein Bildhauer Hubert Netzer war durch
seinen Narziß im Garten des National-Museums zwar
langst und rühmlich bekannt; aber mit diesem seinem
Nornenbrunnen war er über das Spielerische jener Früh-
arbeit (sie wurde 1898 aufgestellt) weit hinausgekommm.
Ein gutes Teil trug zu der Beliebtheit seiner entscheiden-
den Leistung das Motiv bei: die drei Nomen sind im
bunten Hin und Her der germanischen Götterwelt
immer Lieblinge gewesen, und seit Richard Wagner waren
sie das besonders geworden. Ihre Deutung hat zwar
stets geschwankt und um das Sein, Werden und Vergehen
alles Daseins mit der mißverständlichen Art ihrer Namen
Rätsel gelegt: aus dem Reich der Urd (des Urdaseienden)
kommt Verdhandi, das Werdende, und wird das Getane
die Schuld! Da die Normen nicht etwa den Menschen,
sondern als Töchter der von ihnen überwundenen Riesen
den Göttern an die Wurzeln Pgdrasils, des Welteschen-
baums, gesetzt waren, stellten sie die Ewigkeit des Lebens
im vergänglichen Spiel der Götter vor. Als solche, als
Trägerinnen der Ewigkeit, oder des Lebens als der
ewigen Wiedergeburt, sind sie stärker als irgendeine
mythische Figur mit dem Geheimnis belastet. Insofern
geben sie nun zwar eigentlich nicht das rechte Sinnbild,
um an einem plätschernden Brunnen am Karlsplatz in
München, also mitten im Stadtgetriebe Schau zu stehen;
aber derlei Bedenken haben das deutsche Publikum
eigentlich nie gestört, weil es in seiner Bildungssicherheit
jedem Geheimnis gewachsen war.
Betrachtete man als künstlerische Erscheinung den
Brunnen (Abb. 1), so stellte er sich in den einzelnen
Frauengestalten überaus günstig dar, indessen seine Ge-
samtheit allerlei Bedenken erregte. Die durch das Motiv
gegebene Dreiteilung wirkte am günstigsten noch in den
drei Becken; schon aber, wie die drei Sockel sich in die
Schnittpunkte einklemmten, die große Schale in der
Mitte zu tragen, das wirkte nicht recht organisch; und
mehr oder weniger ganz zerschnitten wurde der Aufbau
durch die drei überhohen Pfeiler der Frauengestalten;
auch die drei breit abfließenden Wasserstürze vermochten
dem Eindruck nicht die Breite und Ruhe zu geben, deren
er bedurfte. Günstiger wirkte er bei naher Betrachtung,
wenn man eine einzelne Figur hoch vor sich hatte und
die anderen als Nebenfiguren hinter ihr sah. So ging
inan gern vom Sein zum Werden zur Schuld um den
Brunnen herum (Abb. 2, 3, 4), sich an der breiten und
freien Arbeit im Einzelnen freuend, und irgendein
Erinnerungseindruck mußte ihm dann die Totalität
geben, die er als sinnfällige Erscheinung nicht recht hatte.
Bekanntlich sind uns die Nornen in der griechischen
Eristenz als Parzen vertrauter geworden; als solche sind
sie vermenschlicht und jener Urhaftigkeit entkleidet, die
sie in der germanischen Erscheinung eigentlich undarstell-
bar macht. Auch Netzer hat sie sich augenscheinlich auf
dem griechischen Umweg geholt, dann aber sichtlich ver-
sucht, sie in ihre nordische Heimatluft zurückzubringen,
///
105