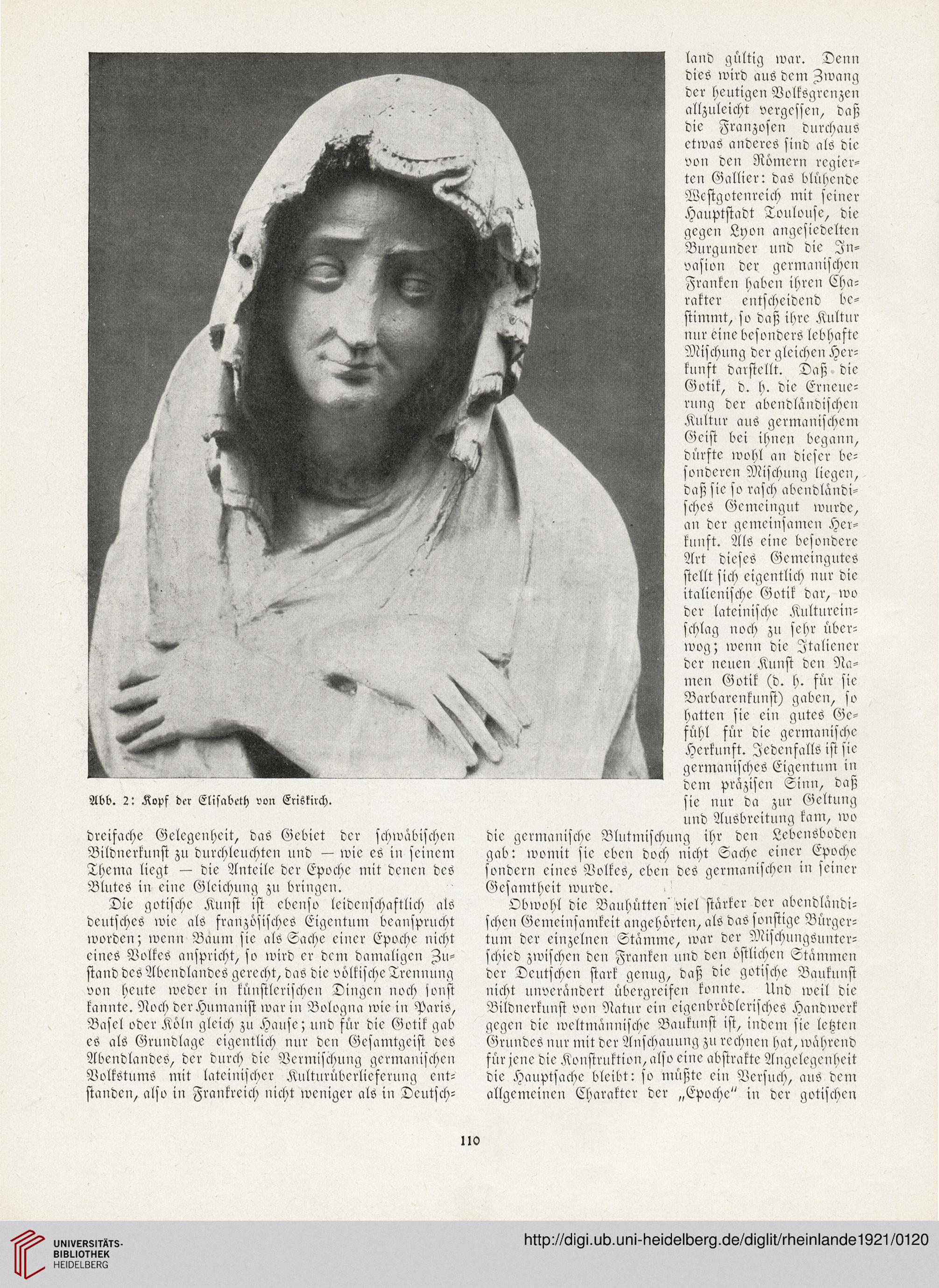Abb. 2! Kopf der Elisabeth von Eriskirch.
dreifache Gelegenheit, das Gebiet der schwäbischen
Bildnerkunst zu durchleuchten und — wie es in seinem
Thema liegt — die Anteile der Epoche mit denen des
Blutes in eine Gleichung zu bringen.
Die gotische Kunst ist ebenso leidenschaftlich als
deutsches wie als französisches Eigentum beansprucht
worden; wenn Baum sie als Sache einer Epoche nicht
eines Volkes anspricht, so wird er dem damaligen Zu-
stand des Abendlandes gerecht, das die völkische Trennung
von heute weder in künstlerischen Dingen noch sonst
kannte. Noch der Humanist war in Bologna wie in Paris,
Basel oder Köln gleich zu Hause; und für die Gotik gab
es als Grundlage eigentlich nur den Gesamtgeist des
Abendlandes, der durch die Vermischung germanischen
Volkstums mit lateinischer Kulturüberlieferung ent-
standen, also in Frankreich nicht weniger als in Deutsch-
land gültig war. Denn
dies wird aus dem Zwang
der heutigen Volksgrenzen
allzuleicht vergessen, daß
die Franzosen durchaus
etwas anderes sind als die
von den Römern regier-
ten Gallier: das blühende
Westgotenreich mit seiner
Hauptstadt Toulouse, die
gegen Lyon angesiedelten
Burgunder und die In-
vasion der germanischen
Franken haben ihren Cha-
rakter entscheidend be-
stimmt, so daß ihre Kultur
nur eine besonders lebhafte
Mischung der gleichen Her-
kunft darstellt. Daß die
Gotik, d. h. die Erneue-
rung der abendländischen
Kultur aus germanischem
Geist bei ihnen begann,
dürfte wohl an dieser be-
sonderen Mischung liegen,
daß sie so rasch abendländi-
sches Gemeingut wurde,
an der gemeinsamen Her-
kunft. Als eine besondere
Art dieses Gemeingutes
stellt sich eigentlich nur die
italienische Gotik dar, wo
der lateinische Kulturein-
schlag noch zu sehr über-
wog; wenn die Italiener
der neuen Kunst den Na-
men Gotik (d. h. für sie
Barbarenkunst) gaben, so
halten sie ein gutes Ge-
fühl für die germanische
Herkunft. Jedenfalls ist sie
germanisches Eigentum in
dem präzisen Sinn, daß
sie nur da zur Geltung
und Ausbreitung kam, wo
die germanische Blutmischung ihr den Lebensboden
gab: womit sie eben doch nicht Sache einer Epoche
sondern eines Volkes, eben des germanischen in seiner
Gesamtheit wurde.
Obwohl die Bauhütten viel starker der abendländi-
schen Gemeinsamkeit angehörtcn, als das sonstige Bürger-
tum der einzelnen Stämme, war der Mischungsunter-
schied zwischen den Franken und den östlichen Stämmen
der Deutschen stark genug, daß die gotische Baukunst
nicht unverändert übergreifen konnte. Und weil die
Bildnerkunst von Natur ein cigenbrödlerisches Handwerk
gegen die weltmännische Baukunst ist, indem sie letzten
Grundes nur mit der Anschauung zu rechnen hat, während
für jene die Konstruktion, also eine abstrakte Angelegenheit
die Hauptsache bleibt: so müßte ein Versuch, aus dem
allgemeinen Charakter der „Epoche" in der gotischen
no
dreifache Gelegenheit, das Gebiet der schwäbischen
Bildnerkunst zu durchleuchten und — wie es in seinem
Thema liegt — die Anteile der Epoche mit denen des
Blutes in eine Gleichung zu bringen.
Die gotische Kunst ist ebenso leidenschaftlich als
deutsches wie als französisches Eigentum beansprucht
worden; wenn Baum sie als Sache einer Epoche nicht
eines Volkes anspricht, so wird er dem damaligen Zu-
stand des Abendlandes gerecht, das die völkische Trennung
von heute weder in künstlerischen Dingen noch sonst
kannte. Noch der Humanist war in Bologna wie in Paris,
Basel oder Köln gleich zu Hause; und für die Gotik gab
es als Grundlage eigentlich nur den Gesamtgeist des
Abendlandes, der durch die Vermischung germanischen
Volkstums mit lateinischer Kulturüberlieferung ent-
standen, also in Frankreich nicht weniger als in Deutsch-
land gültig war. Denn
dies wird aus dem Zwang
der heutigen Volksgrenzen
allzuleicht vergessen, daß
die Franzosen durchaus
etwas anderes sind als die
von den Römern regier-
ten Gallier: das blühende
Westgotenreich mit seiner
Hauptstadt Toulouse, die
gegen Lyon angesiedelten
Burgunder und die In-
vasion der germanischen
Franken haben ihren Cha-
rakter entscheidend be-
stimmt, so daß ihre Kultur
nur eine besonders lebhafte
Mischung der gleichen Her-
kunft darstellt. Daß die
Gotik, d. h. die Erneue-
rung der abendländischen
Kultur aus germanischem
Geist bei ihnen begann,
dürfte wohl an dieser be-
sonderen Mischung liegen,
daß sie so rasch abendländi-
sches Gemeingut wurde,
an der gemeinsamen Her-
kunft. Als eine besondere
Art dieses Gemeingutes
stellt sich eigentlich nur die
italienische Gotik dar, wo
der lateinische Kulturein-
schlag noch zu sehr über-
wog; wenn die Italiener
der neuen Kunst den Na-
men Gotik (d. h. für sie
Barbarenkunst) gaben, so
halten sie ein gutes Ge-
fühl für die germanische
Herkunft. Jedenfalls ist sie
germanisches Eigentum in
dem präzisen Sinn, daß
sie nur da zur Geltung
und Ausbreitung kam, wo
die germanische Blutmischung ihr den Lebensboden
gab: womit sie eben doch nicht Sache einer Epoche
sondern eines Volkes, eben des germanischen in seiner
Gesamtheit wurde.
Obwohl die Bauhütten viel starker der abendländi-
schen Gemeinsamkeit angehörtcn, als das sonstige Bürger-
tum der einzelnen Stämme, war der Mischungsunter-
schied zwischen den Franken und den östlichen Stämmen
der Deutschen stark genug, daß die gotische Baukunst
nicht unverändert übergreifen konnte. Und weil die
Bildnerkunst von Natur ein cigenbrödlerisches Handwerk
gegen die weltmännische Baukunst ist, indem sie letzten
Grundes nur mit der Anschauung zu rechnen hat, während
für jene die Konstruktion, also eine abstrakte Angelegenheit
die Hauptsache bleibt: so müßte ein Versuch, aus dem
allgemeinen Charakter der „Epoche" in der gotischen
no