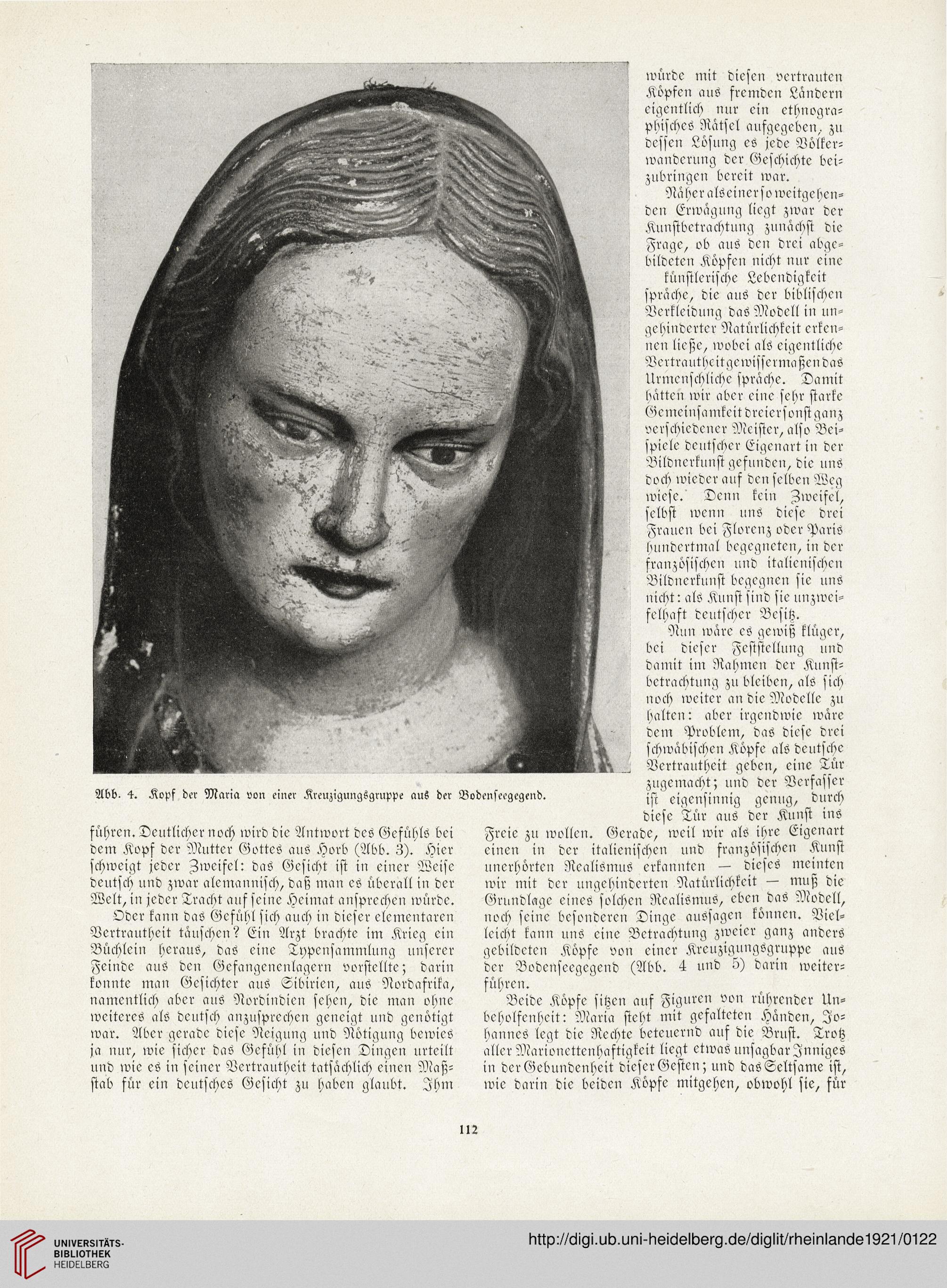Abb. 4. Kopf der Maria von einer Kreuzigungsgruppe aus der
führen. Deutlicher noch wird die Antwort des Gefühls bei
dem Kopf der Mutter Gottes aus Horb (Abb. 3). Hier
schweigt jeder Aweifel: das Gesicht ist in einer Weise
deutsch und zwar alemannisch, daß man es überall in der
Welt, in jeder Tracht auf seine Heimat ansprechen würde.
Oder kann das Gefühl sich auch in dieser elementaren
Vertrautheit täuschen? Ein Arzt brachte im Krieg ein
Büchlein heraus, das eine Typensammlung unserer
Feinde aus den Gefangenenlagern vorstellte; darin
konnte man Gesichter aus Sibirien, aus Nordafrika,
namentlich aber aus Nordindien sehen, die man ohne
weiteres als deutsch anzusprechen geneigt und genötigt
war. Aber gerade diese Neigung und Nötigung bewies
ja nur, wie sicher das Gefühl in diesen Dingen urteilt
und wie es in seiner Vertrautheit tatsächlich einen Maß-
stab für ein deutsches Gesicht zu haben glaubt. Ihm
würde mit diesen vertrauten
Köpfen aus fremden Ländern
eigentlich nur ein ethnogra-
phisches Rätsel aufgegeben, zu
dessen Lösung es jede Völker-
wanderung der Geschichte bei-
zubringen bereit war.
Näher alseinerso weitgehen-
den Erwägung liegt zwar der
Kunstbetrachtung zunächst die
Frage, ob aus den drei abge-
bildeten Köpfen nicht nur eine
künstlerische Lebendigkeit
spräche, die aus der biblischen
Verkleidung das Modell in un-
gehinderter Natürlichkeit erken-
nen ließe, wobei als eigentliche
Vcrtrauthcitgewisscrmaßcndas
Urmenschliche spräche. Damit
hätten wir aber eine sehr starke
Gemeinsamkeit dreiersonst ganz
verschiedener Meister, also Bei-
! spiele deutscher Eigenart in der
Bildnerkunst gefunden, die uns
doch wieder auf den selben Weg
wiese. Denn kein Zweifel,
selbst wenn uns diese drei
Frauen bei Florenz oder Paris
hundertmal begegneten, in der
französischen und italienischen
Bildnerkunst begegnen sie uns
nicht: als Kunst sind sie unzwei-
felhaft deutscher Besitz.
Nun wäre cs gewiß klüger,
bei dieser Feststellung und
damit im Rahmen der Kunst-
betrachtung zu bleiben, als sich
noch weiter an die Modelle zu
halten: aber irgendwie wäre
dem Problem, das diese drei
schwäbischen Köpfe als deutsche
Vertrautheit geben, eine Tür
zugemacht; und der Verfasser
denseegcgend. ist eigensinnig genug, durch
diese Tür aus der Kunst ins
Freie zu wollen. Gerade, weil wir als ihre Eigenart
einen in der italienischen und französischen Kunst
unerhörten Realismus erkannten — dieses meinten
wir mit der ungehinderten Natürlichkeit — muß die
Grundlage eines solchen Realismus, eben das Modell,
noch seine besonderen Dinge aussagen können. Viel-
leicht kann uns eine Betrachtung zweier ganz anders
gebildeten Köpfe von einer Kreuzigungsgruppe aus
der Bodenseegegend (Abb. 4 und 5) darin weiter-
führen.
Beide Köpfe sitzen auf Figuren von rührender Un-
beholfenheit: Maria steht mit gefalteten Händen, Jo-
hannes legt die Rechte beteuernd auf die Brust. Trotz
aller Marionettenhaftigkeit liegt etwas unsagbar Inniges
in der Gebundenheit dieser Gesten; und das Seltsame ist,
wie darin die beiden Köpfe mitgehen, obwohl sie, für
lir