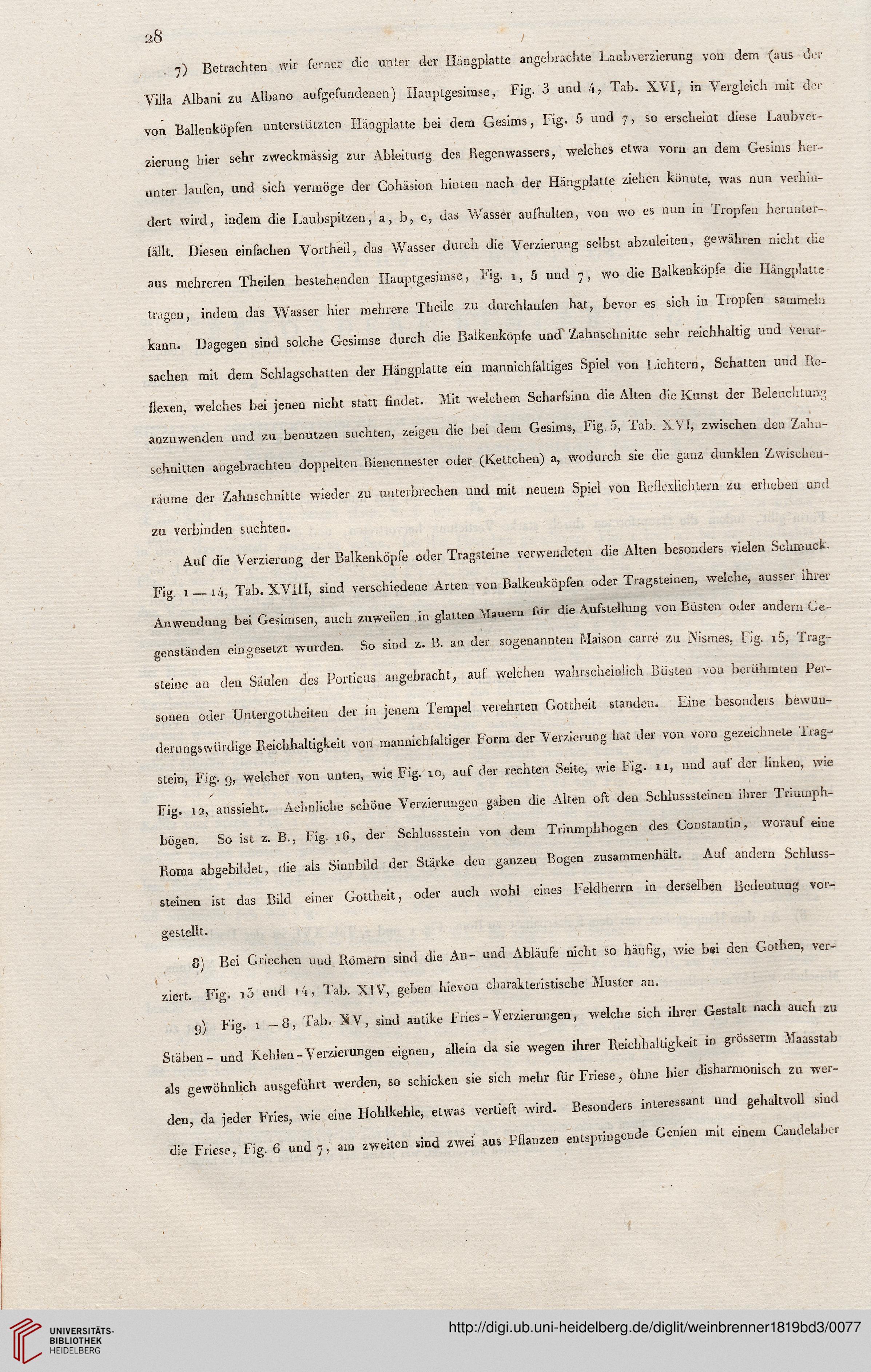7) Betrachten wir ferner die unter der Hängplattc angebrachte Laubverzierung von dem (aus der
Villa Albani zu Albane- aufgefundenen) Hauptgesimse, Fig. 3 und 4, Tab. XVI, in Vergleich mit der
von Ballenköpfen unterstützten Hangplatte bei dem Gesims, Fig. 5 und 7, so erscheint diese Laubver-
zierung hier sehr zweckmässig zur Ableitung des Regenwassers, welches etwa vorn an dem Gesims her-
unter laufen, und sich vermöge der Cohäsion hinten nach der Hängplatte ziehen könnte, was nun verhin-
dert wird, indem die Laubspitzen, a, b, c, das Wasser aufhalten, von wo es nun in Tropfen herunter-
fällt. Diesen einfachen Vortheil, das AVasser durch die Verzierung selbst abzuleiten, gewähren nicht die
aus mehreren Theilen bestehenden Hauptgesimse, Fig. 1, 5 und 7, wo die Balkenköpfe die Hängplattc
tragen, indem das Wasser hier mehrere Theile zu durchlaufen hat, bevor es sich in Tropfen sammeln
kann. Dagegen sind solche Gesimse durch die Balkenköpfe und" Zahnschnittc sehr reichhaltig und verur-
sachen mit dem Schlagschatten der Hängplatte ein mannichfaltiges Spiel von Lichtern, Schatten und Re-
flexen, welches bei jenen nicht statt findet. Mit welchem Scharfsinn die Alten die Kunst der Beleuchtung
anzuwenden und zu benutzen suchten, zeigen die bei dem Gesims, Fig. 5, Tab. XVI, zwischen den Zahn-
schnitten angebrachten doppelten Bienennester oder (Kettchen) a, wodurch sie die ganz dunklen Zwischen-
räume der Zahnschnitte wieder zu unterbrechen und mit neuem Spiel von ReÜexiiehtera zu erheben und
zu verbinden suchten.
Auf die Verzierung der Balkenköpfe oder Tragsteine verwendeten die Alten besonders vielen Schmuck.
Fig. 1 — i4, Tab. XVJ.II, sind verschiedene Arten von Balkenköpfen oder Tragsteinen, welche, ausser ihrer
Anwendung bei Gesimsen, auch zuweilen in glatten Mauern für die Aufstellung von Büsten oder andern Ge-
genständen eingesetzt wurden. So sind z. B. an der sogenannten Maison carre zu jXismes, Fig. i5, Trag-
steine an den Säulen des Porticus angebracht, auf welchen wahrscheinlich Büsteu von berühmten Per-
sonen oder Unlergottheilen der in jenem Tempel verehrten Gottheit standen. Line besonders bewun-
derungswürdige Reichhaltigkeit von mannichfaltiger Form der Verzierung hat der von vorn gezeichnete Trag-
stein, Fig. 9, welcher von unten, wie Fig. 10, auf der rechten Seite, wie Fig. 11, und auf der linken, wie
Fig. 12, aussieht. Aehniiche schöne Verzierungen gaben die Alten oft den Schlusssteinen ihrer Triumph-
bögen. So ist z. B., Fig. 16, der Schlussslein von dem Triumphbogen des Constantin, worauf eine
Roma abgebildet, die als Sinnbild der Stärke den ganzen Bogen zusammenhält. Auf andern Schluss-
steinen ist das Bild einer Gottheit, oder auch wohl eines Fcldherrn in derselben Bedeutung vor-
gestellt.
8) Bei Griechen und Römern sind die An- und Abläufe nicht so häufig, wie bei den Gothen, ver-
ziert. Fig. i5 und i4, Tab. XIV, geben hievon charakteristische Muster an.
9) Fig. 1 — C, Tab. XV, sind antike Fries - Verzierungen, welche sich ihrer Gestalt nach auch zu
Stäben - und Kehlen - Verzierungen eignen, allein da sie wegen ihrer Reichhaltigkeit in grosserm Maasstab
als gewöhnlich ausgeführt werden, so schicken sie sich mehr für Friese, ohne hier disharmonisch zu wer-
den, da jeder Fries, wie eine Hohlkehle, etwas vertieft wird. Besonders interessant und gehaltvoll sind
die Friese, Fig. 6 und 7, am zweiten sind zwei aus Pflanzen entspringende Genien mit einem Candelaber
Villa Albani zu Albane- aufgefundenen) Hauptgesimse, Fig. 3 und 4, Tab. XVI, in Vergleich mit der
von Ballenköpfen unterstützten Hangplatte bei dem Gesims, Fig. 5 und 7, so erscheint diese Laubver-
zierung hier sehr zweckmässig zur Ableitung des Regenwassers, welches etwa vorn an dem Gesims her-
unter laufen, und sich vermöge der Cohäsion hinten nach der Hängplatte ziehen könnte, was nun verhin-
dert wird, indem die Laubspitzen, a, b, c, das Wasser aufhalten, von wo es nun in Tropfen herunter-
fällt. Diesen einfachen Vortheil, das AVasser durch die Verzierung selbst abzuleiten, gewähren nicht die
aus mehreren Theilen bestehenden Hauptgesimse, Fig. 1, 5 und 7, wo die Balkenköpfe die Hängplattc
tragen, indem das Wasser hier mehrere Theile zu durchlaufen hat, bevor es sich in Tropfen sammeln
kann. Dagegen sind solche Gesimse durch die Balkenköpfe und" Zahnschnittc sehr reichhaltig und verur-
sachen mit dem Schlagschatten der Hängplatte ein mannichfaltiges Spiel von Lichtern, Schatten und Re-
flexen, welches bei jenen nicht statt findet. Mit welchem Scharfsinn die Alten die Kunst der Beleuchtung
anzuwenden und zu benutzen suchten, zeigen die bei dem Gesims, Fig. 5, Tab. XVI, zwischen den Zahn-
schnitten angebrachten doppelten Bienennester oder (Kettchen) a, wodurch sie die ganz dunklen Zwischen-
räume der Zahnschnitte wieder zu unterbrechen und mit neuem Spiel von ReÜexiiehtera zu erheben und
zu verbinden suchten.
Auf die Verzierung der Balkenköpfe oder Tragsteine verwendeten die Alten besonders vielen Schmuck.
Fig. 1 — i4, Tab. XVJ.II, sind verschiedene Arten von Balkenköpfen oder Tragsteinen, welche, ausser ihrer
Anwendung bei Gesimsen, auch zuweilen in glatten Mauern für die Aufstellung von Büsten oder andern Ge-
genständen eingesetzt wurden. So sind z. B. an der sogenannten Maison carre zu jXismes, Fig. i5, Trag-
steine an den Säulen des Porticus angebracht, auf welchen wahrscheinlich Büsteu von berühmten Per-
sonen oder Unlergottheilen der in jenem Tempel verehrten Gottheit standen. Line besonders bewun-
derungswürdige Reichhaltigkeit von mannichfaltiger Form der Verzierung hat der von vorn gezeichnete Trag-
stein, Fig. 9, welcher von unten, wie Fig. 10, auf der rechten Seite, wie Fig. 11, und auf der linken, wie
Fig. 12, aussieht. Aehniiche schöne Verzierungen gaben die Alten oft den Schlusssteinen ihrer Triumph-
bögen. So ist z. B., Fig. 16, der Schlussslein von dem Triumphbogen des Constantin, worauf eine
Roma abgebildet, die als Sinnbild der Stärke den ganzen Bogen zusammenhält. Auf andern Schluss-
steinen ist das Bild einer Gottheit, oder auch wohl eines Fcldherrn in derselben Bedeutung vor-
gestellt.
8) Bei Griechen und Römern sind die An- und Abläufe nicht so häufig, wie bei den Gothen, ver-
ziert. Fig. i5 und i4, Tab. XIV, geben hievon charakteristische Muster an.
9) Fig. 1 — C, Tab. XV, sind antike Fries - Verzierungen, welche sich ihrer Gestalt nach auch zu
Stäben - und Kehlen - Verzierungen eignen, allein da sie wegen ihrer Reichhaltigkeit in grosserm Maasstab
als gewöhnlich ausgeführt werden, so schicken sie sich mehr für Friese, ohne hier disharmonisch zu wer-
den, da jeder Fries, wie eine Hohlkehle, etwas vertieft wird. Besonders interessant und gehaltvoll sind
die Friese, Fig. 6 und 7, am zweiten sind zwei aus Pflanzen entspringende Genien mit einem Candelaber