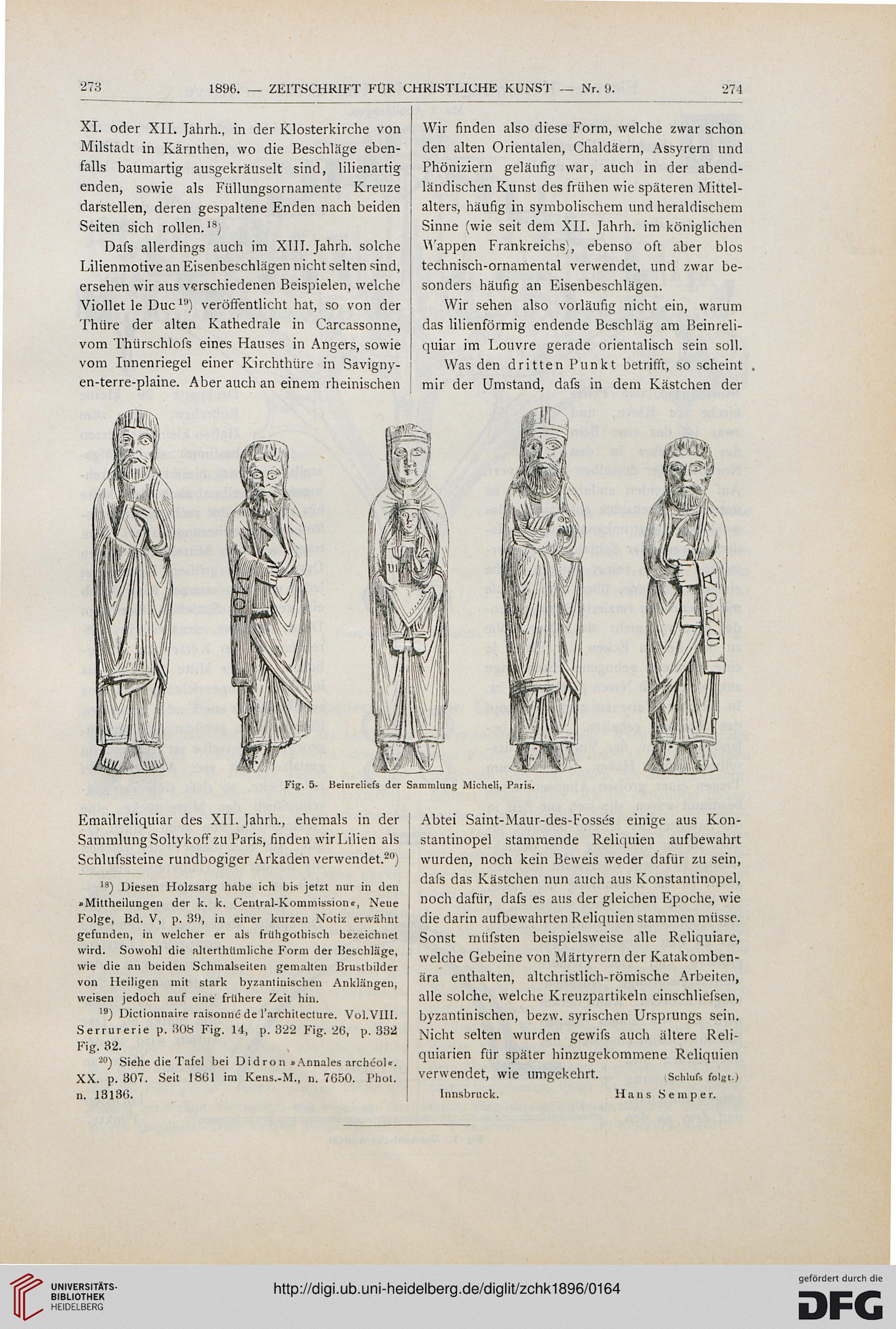273
1896.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
274
XI. oder XII. Jahrh., in der Klosterkirche von
Milstadt in Kärnthen, wo die Beschläge eben-
falls baumartig ausgekräuselt sind, lilienartig
enden, sowie als Füllungsornamente Kreuze
darstellen, deren gespaltene Enden nach beiden
Seiten sich rollen.18)
Dafs allerdings auch im XIII. Jahrh. solche
Lilienmotive an Eisenbeschlägen nicht selten sind,
ersehen wir aus verschiedenen Beispielen, welche
Viollet le Duc19) veröffentlicht hat, so von der
Thüre der alten Kathedrale in Carcassonne,
vom Thürschlofs eines Hauses in Angers, sowie
vom Innenriegel einer Kirchthüre in Savigny-
en-terre-plaine. Aber auch an einem rheinischen
Wir finden also diese Form, welche zwar schon
den alten Orientalen, Chaldäern, Assyrern und
Phöniziern geläufig war, auch in der abend-
ländischen Kunst des frühen wie späteren Mittel-
alters, häufig in symbolischem und heraldischem
Sinne (wie seit dem XII. Jahrh. im königlichen
Wappen Frankreichs1, ebenso oft aber blos
technisch-ornamental verwendet, und zwar be-
sonders häufig an Eisenbeschlägen.
Wir sehen also vorläufig nicht ein, warum
das lilienförmig endende Beschlag am Beinreli-
quiar im Louvre gerade orientalisch sein soll.
Was den dritten Punkt betrifft, so scheint
mir der Umstand, dafs in dem Kästchen der
Hb
v ; :
Fig. 5- Beinreliefs der Sammlung Micheli, Paris.
Emailreliquiar des XII. Jahrh., ehemals in der
Sammlung Soltykoff zu Paris, finden wir Lilien als
Schlufssteine rundbogiger Arkaden verwendet.20)
18) Diesen Holzsarg habe ich bis jetzt nur in den
»Mittheilungen der k. k. Central-Kommission«, Neue
Folge, Bd. V, p. 39, in einer kurzen Notiz erwähnt
gefunden, in welcher er als frühgothisch bezeichnet
wird. Sowohl die alterthiimliche Form der lieschläge,
wie die an beiden Schmalseilen gemalten Brustbilder
von Heiligen mit stark byzantinischen Anklängen,
weisen jedoch auf eine frühere Zeit hin.
19) Dictionnaire raisonnede l'archilecture. Vol. VIII.
Serrurerie p. BOÖ Fig. 14, p. 822 Fig. 26, p. 332
Fig. 32.
20) Siehe die Tafel bei Didro n »Annales archcoU.
XX. p. 307. Seit 1861 im Kens.-M., n. 7650. Phot.
n. 13136.
Abtei Saint-Maur-des-Fosse's einige aus Kon-
stantinopel stammende Reliquien aufbewahrt
wurden, noch kein Beweis weder dafür zu sein,
dafs das Kästchen nun auch aus Konstantinopel,
noch dafür, dafs es aus der gleichen Epoche, wie
die darin aufbewahrten Reliquien stammen müsse.
Sonst müfsten beispielsweise alle Reliquiare,
welche Gebeine von Märtyrern der Katakomben-
ära enthalten, altchristlich-römische Arbeiten,
alle solche, welche Kreuzpartikeln einschliefsen,
byzantinischen, bezw. syrischen Ursprungs sein.
Nicht selten wurden gewifs auch ältere Reli-
quiarien für später hinzugekommene Reliquien
verwendet, wie umgekehrt. LSchlufi folgt.;
Innsbruck. Hans S e in p e r.
1896.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
274
XI. oder XII. Jahrh., in der Klosterkirche von
Milstadt in Kärnthen, wo die Beschläge eben-
falls baumartig ausgekräuselt sind, lilienartig
enden, sowie als Füllungsornamente Kreuze
darstellen, deren gespaltene Enden nach beiden
Seiten sich rollen.18)
Dafs allerdings auch im XIII. Jahrh. solche
Lilienmotive an Eisenbeschlägen nicht selten sind,
ersehen wir aus verschiedenen Beispielen, welche
Viollet le Duc19) veröffentlicht hat, so von der
Thüre der alten Kathedrale in Carcassonne,
vom Thürschlofs eines Hauses in Angers, sowie
vom Innenriegel einer Kirchthüre in Savigny-
en-terre-plaine. Aber auch an einem rheinischen
Wir finden also diese Form, welche zwar schon
den alten Orientalen, Chaldäern, Assyrern und
Phöniziern geläufig war, auch in der abend-
ländischen Kunst des frühen wie späteren Mittel-
alters, häufig in symbolischem und heraldischem
Sinne (wie seit dem XII. Jahrh. im königlichen
Wappen Frankreichs1, ebenso oft aber blos
technisch-ornamental verwendet, und zwar be-
sonders häufig an Eisenbeschlägen.
Wir sehen also vorläufig nicht ein, warum
das lilienförmig endende Beschlag am Beinreli-
quiar im Louvre gerade orientalisch sein soll.
Was den dritten Punkt betrifft, so scheint
mir der Umstand, dafs in dem Kästchen der
Hb
v ; :
Fig. 5- Beinreliefs der Sammlung Micheli, Paris.
Emailreliquiar des XII. Jahrh., ehemals in der
Sammlung Soltykoff zu Paris, finden wir Lilien als
Schlufssteine rundbogiger Arkaden verwendet.20)
18) Diesen Holzsarg habe ich bis jetzt nur in den
»Mittheilungen der k. k. Central-Kommission«, Neue
Folge, Bd. V, p. 39, in einer kurzen Notiz erwähnt
gefunden, in welcher er als frühgothisch bezeichnet
wird. Sowohl die alterthiimliche Form der lieschläge,
wie die an beiden Schmalseilen gemalten Brustbilder
von Heiligen mit stark byzantinischen Anklängen,
weisen jedoch auf eine frühere Zeit hin.
19) Dictionnaire raisonnede l'archilecture. Vol. VIII.
Serrurerie p. BOÖ Fig. 14, p. 822 Fig. 26, p. 332
Fig. 32.
20) Siehe die Tafel bei Didro n »Annales archcoU.
XX. p. 307. Seit 1861 im Kens.-M., n. 7650. Phot.
n. 13136.
Abtei Saint-Maur-des-Fosse's einige aus Kon-
stantinopel stammende Reliquien aufbewahrt
wurden, noch kein Beweis weder dafür zu sein,
dafs das Kästchen nun auch aus Konstantinopel,
noch dafür, dafs es aus der gleichen Epoche, wie
die darin aufbewahrten Reliquien stammen müsse.
Sonst müfsten beispielsweise alle Reliquiare,
welche Gebeine von Märtyrern der Katakomben-
ära enthalten, altchristlich-römische Arbeiten,
alle solche, welche Kreuzpartikeln einschliefsen,
byzantinischen, bezw. syrischen Ursprungs sein.
Nicht selten wurden gewifs auch ältere Reli-
quiarien für später hinzugekommene Reliquien
verwendet, wie umgekehrt. LSchlufi folgt.;
Innsbruck. Hans S e in p e r.