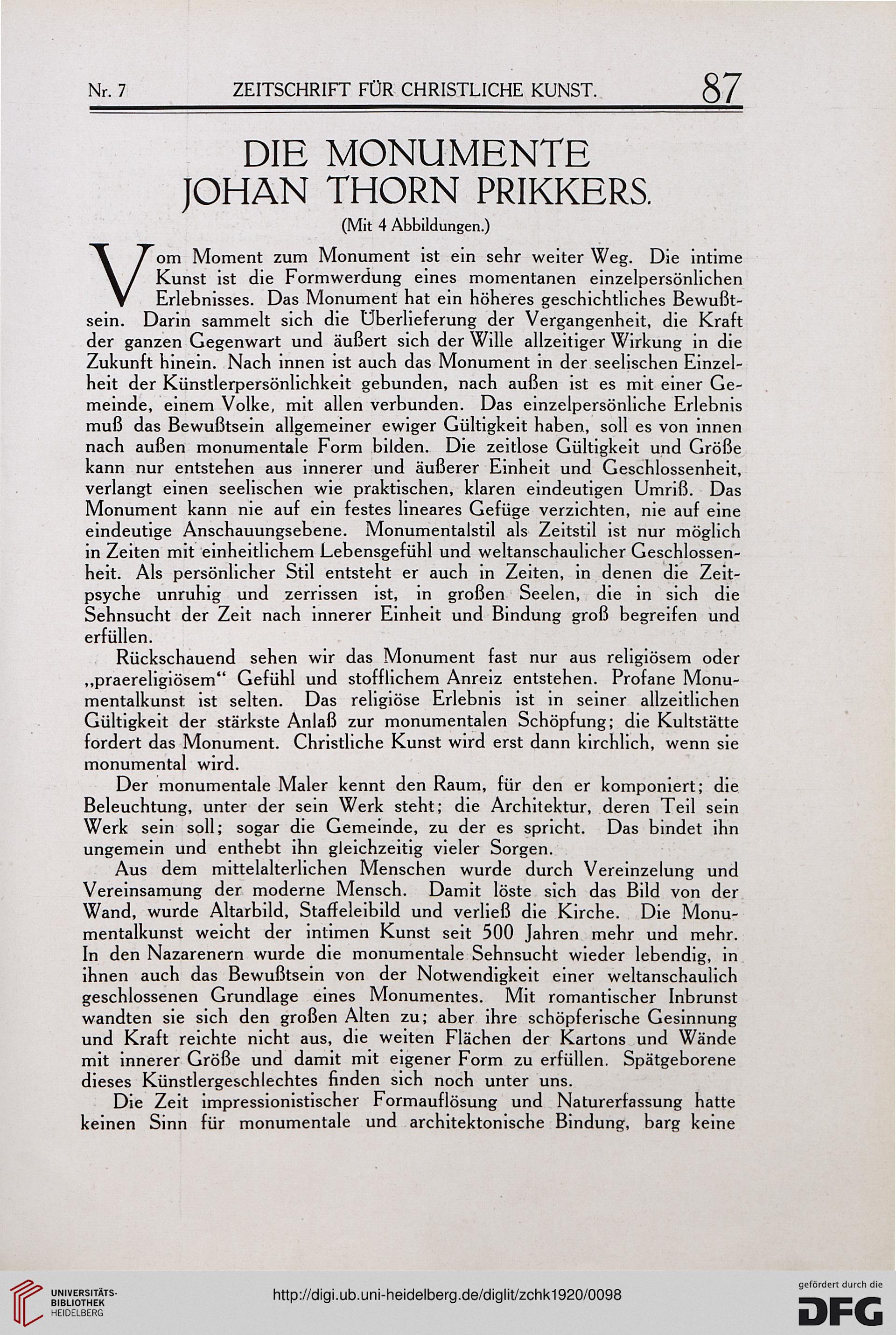Nr. 7 ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. 87
DIE MONUMENTE
JOHAN THORN PRIKKERS.
(Mit 4 Abbildungen.)
Vom Moment zum Monument ist ein sehr weiter Weg. Die intime
Kunst ist die Formwerdung eines momentanen einzelpersönlichen
Erlebnisses. Das Monument hat ein höheres geschichtliches Bewußt-
sein. Darin sammelt sich die Überlieferung der Vergangenheit, die Kraft
der ganzen Gegenwart und äußert sich der Wille allzeitiger Wirkung in die
Zukunft hinein. Nach innen ist auch das Monument in der seelischen Einzel-
heit der Künstlerpersönlichkeit gebunden, nach außen ist es mit einer Ge-
meinde, einem Volke, mit allen verbunden. Das einzelpersönliche Erlebnis
muß das Bewußtsein allgemeiner ewiger Gültigkeit haben, soll es von innen
nach außen monumentale Form bilden. Die zeitlose Gültigkeit und Größe
kann nur entstehen aus innerer und äußerer Einheit und Geschlossenheit,
verlangt einen seelischen wie praktischen, klaren eindeutigen Umriß. Das
Monument kann nie auf ein festes lineares Gefüge verzichten, nie auf eine
eindeutige Anschauungsebene. Monumentalstil als Zeitstil ist nur möglich
in Zeiten mit einheitlichem Lebensgefühl und weltanschaulicher Geschlossen-
heit. Als persönlicher Stil entsteht er auch in Zeiten, in denen die Zeit-
psyche unruhig und zerrissen ist, in großen Seelen, die in sich die
Sehnsucht der Zeit nach innerer Einheit und Bindung groß begreifen und
erfüllen.
Rückschauend sehen wir das Monument fast nur aus religiösem oder
„praereligiösem" Gefühl und stofflichem Anreiz entstehen. Profane Monu-
mentalkunst ist selten. Das religiöse Erlebnis ist in seiner allzeitlichen
Gültigkeit der stärkste Anlaß zur monumentalen Schöpfung; die Kultstätte
fordert das Monument. Christliche Kunst wird erst dann kirchlich, wenn sie
monumental wird.
Der monumentale Maler kennt den Raum, für den er komponiert; die
Beleuchtung, unter der sein Werk steht; die Architektur, deren Teil sein
Werk sein soll; sogar die Gemeinde, zu der es spricht. Das bindet ihn
ungemein und enthebt ihn gleichzeitig vieler Sorgen.
Aus dem mittelalterlichen Menschen wurde durch Vereinzelung und
Vereinsamung der moderne Mensch. Damit löste sich das Bild von der
Wand, wurde Altarbild, Staffeleibild und verließ die Kirche. Die Monu-
mentalkunst weicht der intimen Kunst seit 500 Jahren mehr und mehr.
In den Nazarenern wurde die monumentale Sehnsucht wieder lebendig, in
ihnen auch das Bewußtsein von der Notwendigkeit einer weltanschaulich
geschlossenen Grundlage eines Monumentes. Mit romantischer Inbrunst
wandten sie sich den großen Alten zu; aber ihre schöpferische Gesinnung
und Kraft reichte nicht aus, die weiten Flächen der Kartons und Wände
mit innerer Größe und damit mit eigener Form zu erfüllen. Spätgeborene
dieses Künstlergeschlechtes finden sich noch unter uns.
Die Zeit impressionistischer Formauflösung und Naturerfassung hatte
keinen Sinn für monumentale und architektonische Bindung, barg keine
DIE MONUMENTE
JOHAN THORN PRIKKERS.
(Mit 4 Abbildungen.)
Vom Moment zum Monument ist ein sehr weiter Weg. Die intime
Kunst ist die Formwerdung eines momentanen einzelpersönlichen
Erlebnisses. Das Monument hat ein höheres geschichtliches Bewußt-
sein. Darin sammelt sich die Überlieferung der Vergangenheit, die Kraft
der ganzen Gegenwart und äußert sich der Wille allzeitiger Wirkung in die
Zukunft hinein. Nach innen ist auch das Monument in der seelischen Einzel-
heit der Künstlerpersönlichkeit gebunden, nach außen ist es mit einer Ge-
meinde, einem Volke, mit allen verbunden. Das einzelpersönliche Erlebnis
muß das Bewußtsein allgemeiner ewiger Gültigkeit haben, soll es von innen
nach außen monumentale Form bilden. Die zeitlose Gültigkeit und Größe
kann nur entstehen aus innerer und äußerer Einheit und Geschlossenheit,
verlangt einen seelischen wie praktischen, klaren eindeutigen Umriß. Das
Monument kann nie auf ein festes lineares Gefüge verzichten, nie auf eine
eindeutige Anschauungsebene. Monumentalstil als Zeitstil ist nur möglich
in Zeiten mit einheitlichem Lebensgefühl und weltanschaulicher Geschlossen-
heit. Als persönlicher Stil entsteht er auch in Zeiten, in denen die Zeit-
psyche unruhig und zerrissen ist, in großen Seelen, die in sich die
Sehnsucht der Zeit nach innerer Einheit und Bindung groß begreifen und
erfüllen.
Rückschauend sehen wir das Monument fast nur aus religiösem oder
„praereligiösem" Gefühl und stofflichem Anreiz entstehen. Profane Monu-
mentalkunst ist selten. Das religiöse Erlebnis ist in seiner allzeitlichen
Gültigkeit der stärkste Anlaß zur monumentalen Schöpfung; die Kultstätte
fordert das Monument. Christliche Kunst wird erst dann kirchlich, wenn sie
monumental wird.
Der monumentale Maler kennt den Raum, für den er komponiert; die
Beleuchtung, unter der sein Werk steht; die Architektur, deren Teil sein
Werk sein soll; sogar die Gemeinde, zu der es spricht. Das bindet ihn
ungemein und enthebt ihn gleichzeitig vieler Sorgen.
Aus dem mittelalterlichen Menschen wurde durch Vereinzelung und
Vereinsamung der moderne Mensch. Damit löste sich das Bild von der
Wand, wurde Altarbild, Staffeleibild und verließ die Kirche. Die Monu-
mentalkunst weicht der intimen Kunst seit 500 Jahren mehr und mehr.
In den Nazarenern wurde die monumentale Sehnsucht wieder lebendig, in
ihnen auch das Bewußtsein von der Notwendigkeit einer weltanschaulich
geschlossenen Grundlage eines Monumentes. Mit romantischer Inbrunst
wandten sie sich den großen Alten zu; aber ihre schöpferische Gesinnung
und Kraft reichte nicht aus, die weiten Flächen der Kartons und Wände
mit innerer Größe und damit mit eigener Form zu erfüllen. Spätgeborene
dieses Künstlergeschlechtes finden sich noch unter uns.
Die Zeit impressionistischer Formauflösung und Naturerfassung hatte
keinen Sinn für monumentale und architektonische Bindung, barg keine