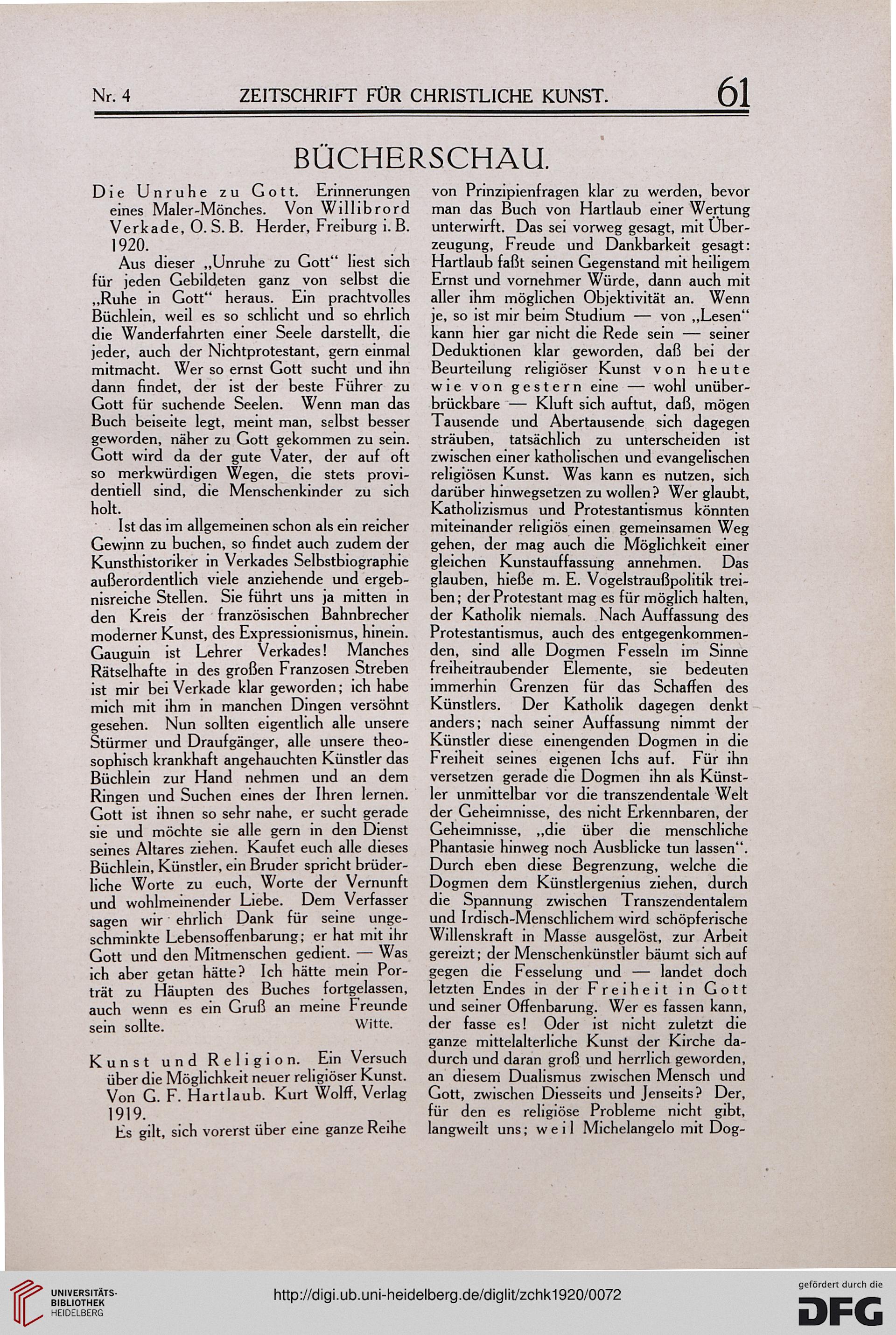Nr. 4
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
61
BÜCHERSCHAU.
Die Unruhe zu Gott. Erinnerungen
eines Maler-Mönches. Von Willibrord
Verkade, 0. S. B. Herder, Freiburg i. B.
1920.
Aus dieser „Unruhe zu Gott" liest sich
für jeden Gebildeten ganz von selbst die
„Ruhe in Gott" heraus. Ein prachtvolles
Büchlein, weil es so schlicht und so ehrlich
die Wanderfahrten einer Seele darstellt, die
jeder, auch der Nichtprotestant, gern einmal
mitmacht. Wer so ernst Gott sucht und ihn
dann findet, der ist der beste Führer zu
Gott für suchende Seelen. Wenn man das
Buch beiseite legt, meint man, selbst besser
geworden, näher zu Gott gekommen zu sein.
Gott wird da der gute Vater, der auf oft
so merkwürdigen Wegen, die stets provi-
dentiell sind, die Menschenkinder zu sich
holt.
Ist das im allgemeinen schon als ein reicher
Gewinn zu buchen, so findet auch zudem der
Kunsthistoriker in Verkades Selbstbiographie
außerordentlich viele anziehende und ergeb-
nisreiche Stellen. Sie führt uns ja mitten in
den Kreis der französischen Bahnbrecher
moderner Kunst, des Expressionismus, hinein.
Gauguin ist Lehrer Verkades! Manches
Rätselhafte in des großen Franzosen Streben
ist mir bei Verkade klar geworden; ich habe
mich mit ihm in manchen Dingen versöhnt
gesehen. Nun sollten eigentlich alle unsere
Stürmer und Draufgänger, alle unsere theo-
sophisch krankhaft angehauchten Künstler das
Büchlein zur Hand nehmen und an dem
Ringen und Suchen eines der Ihren lernen.
Gott ist ihnen so sehr nahe, er sucht gerade
sie und möchte sie alle gern in den Dienst
seines Altares ziehen. Kaufet euch alle dieses
Büchlein, Künstler, ein Bruder spricht brüder-
liche Worte zu euch, Worte der Vernunft
und wohlmeinender Liebe. Dem Verfasser
sagen wir ehrlich Dank für seine unge-
schminkte Lebensoffenbarung; er hat mit ihr
Gott und den Mitmenschen gedient. — Was
ich aber getan hätte? Ich hätte mein Por-
trät zu Häupten des Buches fortgelassen,
auch wenn es ein Gruß an meine Freunde
sein sollte. Witte.
Kunst und Religion. Ein Versuch
über die Möglichkeit neuer religiöser Kunst.
Von G. F. Hartlaub. Kurt Wolff, Verlag
1919.
Es gilt, sich vorerst über eine ganze Reihe
von Prinzipienfragen klar zu werden, bevor
man das Buch von Hartlaub einer Wertung
unterwirft. Das sei vorweg gesagt, mit Über-
zeugung, Freude und Dankbarkeit gesagt:
Hartlaub faßt seinen Gegenstand mit heiligem
Ernst und vornehmer Würde, dann auch mit
aller ihm möglichen Objektivität an. Wenn
je, so ist mir beim Studium — von „Lesen"
kann hier gar nicht die Rede sein — seiner
Deduktionen klar geworden, daß bei der
Beurteilung religiöser Kunst von heute
wie von gestern eine — wohl unüber-
brückbare — Kluft sich auftut, daß, mögen
Tausende und Abertausende sich dagegen
sträuben, tatsächlich zu unterscheiden ist
zwischen einer katholischen und evangelischen
religiösen Kunst. Was kann es nutzen, sich
darüber hinwegsetzen zu wollen? Wer glaubt,
Katholizismus und Protestantismus könnten
miteinander religiös einen gemeinsamen Weg
gehen, der mag auch die Möglichkeit einer
gleichen Kunstauffassung annehmen. Das
glauben, hieße m. E. Vogelstraußpolitik trei-
ben ; der Protestant mag es für möglich halten,
der Katholik niemals. Nach Auffassung des
Protestantismus, auch des entgegenkommen-
den, sind alle Dogmen Fesseln im Sinne
freiheitraubender Elemente, sie bedeuten
immerhin Grenzen für das Schaffen des
Künstlers. Der Katholik dagegen denkt
anders; nach seiner Auffassung nimmt der
Künstler diese einengenden Dogmen in die
Freiheit seines eigenen Ichs auf. Für ihn
versetzen gerade die Dogmen ihn als Künst-
ler unmittelbar vor die transzendentale Welt
der Geheimnisse, des nicht Erkennbaren, der
Geheimnisse, „die über die menschliche
Phantasie hinweg noch Ausblicke tun lassen".
Durch eben diese Begrenzung, welche die
Dogmen dem Künstlergenius ziehen, durch
die Spannung zwischen Transzendentalem
und Irdisch-Menschlichem wird schöpferische
Willenskraft in Masse ausgelöst, zur Arbeit
gereizt; der Menschenkünstler bäumt sich auf
gegen die Fesselung und — landet doch
letzten Endes in der Freiheit in Gott
und seiner Offenbarung. Wer es fassen kann,
der fasse es! Oder ist nicht zuletzt die
ganze mittelalterliche Kunst der Kirche da-
durch und daran groß und herrlich geworden,
an diesem Dualismus zwischen Mensch und
Gott, zwischen Diesseits und Jenseits? Der,
für den es religiöse Probleme nicht gibt,
langweilt uns; weil Michelangelo mit Dog-
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
61
BÜCHERSCHAU.
Die Unruhe zu Gott. Erinnerungen
eines Maler-Mönches. Von Willibrord
Verkade, 0. S. B. Herder, Freiburg i. B.
1920.
Aus dieser „Unruhe zu Gott" liest sich
für jeden Gebildeten ganz von selbst die
„Ruhe in Gott" heraus. Ein prachtvolles
Büchlein, weil es so schlicht und so ehrlich
die Wanderfahrten einer Seele darstellt, die
jeder, auch der Nichtprotestant, gern einmal
mitmacht. Wer so ernst Gott sucht und ihn
dann findet, der ist der beste Führer zu
Gott für suchende Seelen. Wenn man das
Buch beiseite legt, meint man, selbst besser
geworden, näher zu Gott gekommen zu sein.
Gott wird da der gute Vater, der auf oft
so merkwürdigen Wegen, die stets provi-
dentiell sind, die Menschenkinder zu sich
holt.
Ist das im allgemeinen schon als ein reicher
Gewinn zu buchen, so findet auch zudem der
Kunsthistoriker in Verkades Selbstbiographie
außerordentlich viele anziehende und ergeb-
nisreiche Stellen. Sie führt uns ja mitten in
den Kreis der französischen Bahnbrecher
moderner Kunst, des Expressionismus, hinein.
Gauguin ist Lehrer Verkades! Manches
Rätselhafte in des großen Franzosen Streben
ist mir bei Verkade klar geworden; ich habe
mich mit ihm in manchen Dingen versöhnt
gesehen. Nun sollten eigentlich alle unsere
Stürmer und Draufgänger, alle unsere theo-
sophisch krankhaft angehauchten Künstler das
Büchlein zur Hand nehmen und an dem
Ringen und Suchen eines der Ihren lernen.
Gott ist ihnen so sehr nahe, er sucht gerade
sie und möchte sie alle gern in den Dienst
seines Altares ziehen. Kaufet euch alle dieses
Büchlein, Künstler, ein Bruder spricht brüder-
liche Worte zu euch, Worte der Vernunft
und wohlmeinender Liebe. Dem Verfasser
sagen wir ehrlich Dank für seine unge-
schminkte Lebensoffenbarung; er hat mit ihr
Gott und den Mitmenschen gedient. — Was
ich aber getan hätte? Ich hätte mein Por-
trät zu Häupten des Buches fortgelassen,
auch wenn es ein Gruß an meine Freunde
sein sollte. Witte.
Kunst und Religion. Ein Versuch
über die Möglichkeit neuer religiöser Kunst.
Von G. F. Hartlaub. Kurt Wolff, Verlag
1919.
Es gilt, sich vorerst über eine ganze Reihe
von Prinzipienfragen klar zu werden, bevor
man das Buch von Hartlaub einer Wertung
unterwirft. Das sei vorweg gesagt, mit Über-
zeugung, Freude und Dankbarkeit gesagt:
Hartlaub faßt seinen Gegenstand mit heiligem
Ernst und vornehmer Würde, dann auch mit
aller ihm möglichen Objektivität an. Wenn
je, so ist mir beim Studium — von „Lesen"
kann hier gar nicht die Rede sein — seiner
Deduktionen klar geworden, daß bei der
Beurteilung religiöser Kunst von heute
wie von gestern eine — wohl unüber-
brückbare — Kluft sich auftut, daß, mögen
Tausende und Abertausende sich dagegen
sträuben, tatsächlich zu unterscheiden ist
zwischen einer katholischen und evangelischen
religiösen Kunst. Was kann es nutzen, sich
darüber hinwegsetzen zu wollen? Wer glaubt,
Katholizismus und Protestantismus könnten
miteinander religiös einen gemeinsamen Weg
gehen, der mag auch die Möglichkeit einer
gleichen Kunstauffassung annehmen. Das
glauben, hieße m. E. Vogelstraußpolitik trei-
ben ; der Protestant mag es für möglich halten,
der Katholik niemals. Nach Auffassung des
Protestantismus, auch des entgegenkommen-
den, sind alle Dogmen Fesseln im Sinne
freiheitraubender Elemente, sie bedeuten
immerhin Grenzen für das Schaffen des
Künstlers. Der Katholik dagegen denkt
anders; nach seiner Auffassung nimmt der
Künstler diese einengenden Dogmen in die
Freiheit seines eigenen Ichs auf. Für ihn
versetzen gerade die Dogmen ihn als Künst-
ler unmittelbar vor die transzendentale Welt
der Geheimnisse, des nicht Erkennbaren, der
Geheimnisse, „die über die menschliche
Phantasie hinweg noch Ausblicke tun lassen".
Durch eben diese Begrenzung, welche die
Dogmen dem Künstlergenius ziehen, durch
die Spannung zwischen Transzendentalem
und Irdisch-Menschlichem wird schöpferische
Willenskraft in Masse ausgelöst, zur Arbeit
gereizt; der Menschenkünstler bäumt sich auf
gegen die Fesselung und — landet doch
letzten Endes in der Freiheit in Gott
und seiner Offenbarung. Wer es fassen kann,
der fasse es! Oder ist nicht zuletzt die
ganze mittelalterliche Kunst der Kirche da-
durch und daran groß und herrlich geworden,
an diesem Dualismus zwischen Mensch und
Gott, zwischen Diesseits und Jenseits? Der,
für den es religiöse Probleme nicht gibt,
langweilt uns; weil Michelangelo mit Dog-