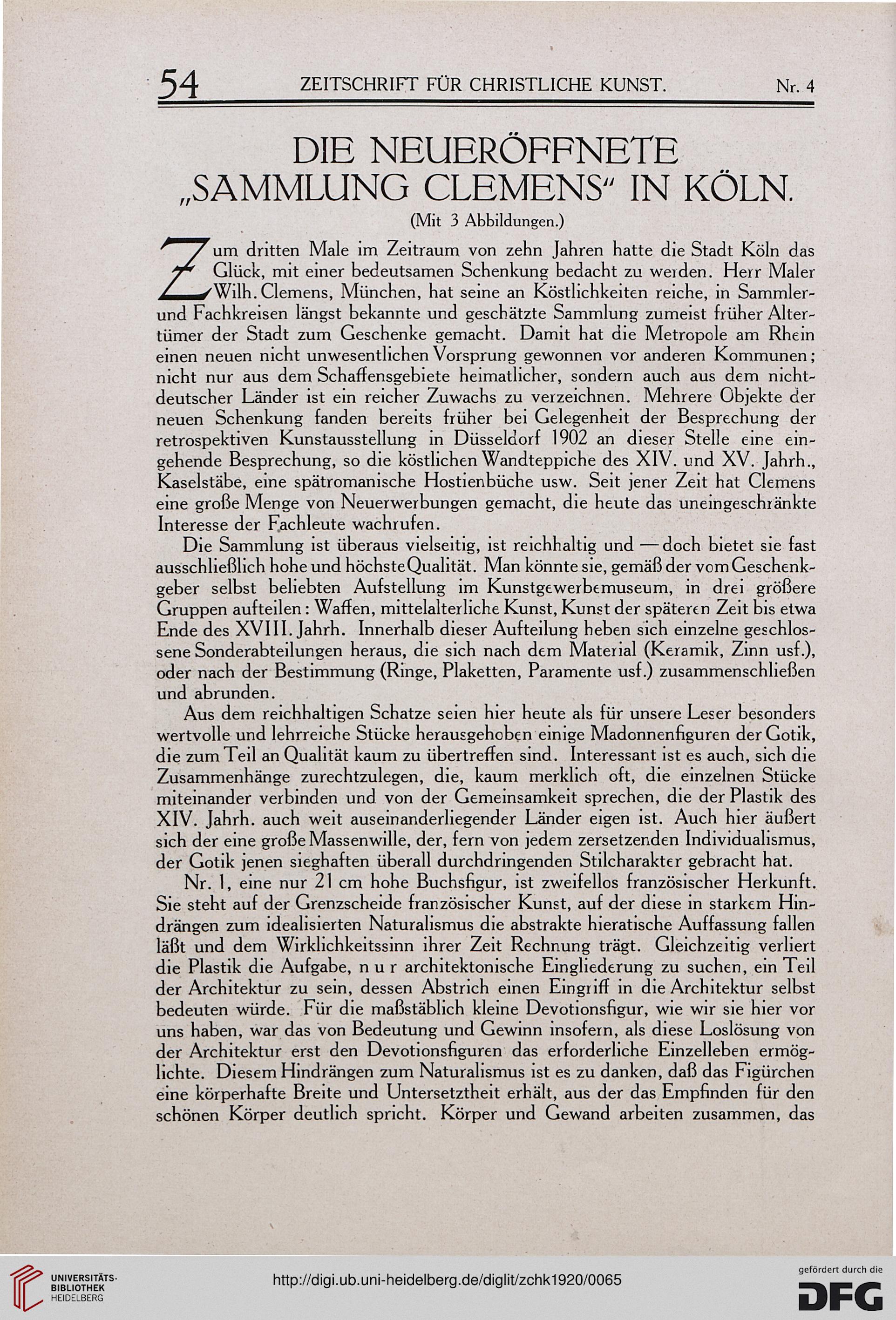54
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 4
DIE NEUERÖFFNETE
„SAMMLUNG CLEMENS" IN KÖLN.
(Mit 3 Abbildungen.)
Zum dritten Male im Zeitraum von zehn Jahren hatte die Stadt Köln das
Glück, mit einer bedeutsamen Schenkung bedacht zu weiden. Herr Maler
Wilh. Clemens, München, hat seine an Köstlichkeiten reiche, in Sammler-
und Fachkreisen längst bekannte und geschätzte Sammlung zumeist früher Alter-
tümer der Stadt zum Geschenke gemacht. Damit hat die Metropole am Rhein
einen neuen nicht unwesentlichen Vorsprung gewonnen vor anderen Kommunen;
nicht nur aus dem Schaffensgebiete heimatlicher, sondern auch aus dem nicht-
deutscher Länder ist ein reicher Zuwachs zu verzeichnen. Mehrere Objekte der
neuen Schenkung fanden bereits früher bei Gelegenheit der Besprechung der
retrospektiven Kunstausstellung in Düsseldorf 1902 an dieser Stelle eine ein-
gehende Besprechung, so die köstlichen Wandteppiche des XIV. und XV. Jahrh.,
Kaselstäbe, eine spätromanische Hostienbüche usw. Seit jener Zeit hat Clemens
eine große Menge von Neuerwerbungen gemacht, die heute das uneingeschränkte
Interesse der Fachleute wachrufen.
Die Sammlung ist überaus vielseitig, ist reichhaltig und —doch bietet sie fast
ausschließlich hohe und höchsteQuahtät. Man könnte sie, gemäß der vom Geschenk-
geber selbst beliebten Aufstellung im Kunstgewerbemuseum, in drei größere
Gruppen aufteilen : Waffen, mittelalterliche Kunst, Kunst der späteren Zeit bis etwa
Ende des XVIII. Jahrh. Innerhalb dieser Aufteilung heben sich einzelne geschlos-
sene Sonderabteilungen heraus, die sich nach dem Material (Keramik, Zinn usf.),
oder nach der Bestimmung (Ringe, Plaketten, Paramente usf.) zusammenschließen
und abrunden.
Aus dem reichhaltigen Schatze seien hier heute als für unsere Leser besonders
wertvolle und lehrreiche Stücke herausgehoben einige Madonnenfiguren der Gotik,
die zum Teil an Qualität kaum zu übertreffen sind. Interessant ist es auch, sich die
Zusammenhänge zurechtzulegen, die, kaum merklich oft, die einzelnen Stücke
miteinander verbinden und von der Gemeinsamkeit sprechen, die der Plastik des
XIV. Jahrh. auch weit auseinanderliegender Länder eigen ist. Auch hier äußert
sich der eine große Massenwille, der, fern von jedem zersetzenden Individualismus,
der Gotik jenen sieghaften überall durchdringenden Stilcharakter gebracht hat.
Nr. 1, eine nur 21 cm hohe Buchsfigur, ist zweifellos französischer Herkunft.
Sie steht auf der Grenzscheide französischer Kunst, auf der diese in starkem Hin-
drängen zum idealisierten Naturalismus die abstrakte hieratische Auffassung fallen
läßt und dem Wirkhchkeitssinn ihrer Zeit Rechnung trägt. Gleichzeitig verliert
die Plastik die Aufgabe, nur architektonische Eingliederung zu suchen, ein Teil
der Architektur zu sein, dessen Abstrich einen Eingriff in die Architektur selbst
bedeuten würde. Für die maßstäblich kleine Devotionsfigur, wie wir sie hier vor
uns haben, war das von Bedeutung und Gewinn insofern, als diese Loslösung von
der Architektur erst den Devotionsfiguren das erforderliche Einzelleben ermög-
lichte. Diesem Hindrängen zum Naturalismus ist es zu danken, daß das Figürchen
eine körperhafte Breite und Untersetztheit erhält, aus der das Empfinden für den
schönen Körper deutlich spricht. Körper und Gewand arbeiten zusammen, das
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 4
DIE NEUERÖFFNETE
„SAMMLUNG CLEMENS" IN KÖLN.
(Mit 3 Abbildungen.)
Zum dritten Male im Zeitraum von zehn Jahren hatte die Stadt Köln das
Glück, mit einer bedeutsamen Schenkung bedacht zu weiden. Herr Maler
Wilh. Clemens, München, hat seine an Köstlichkeiten reiche, in Sammler-
und Fachkreisen längst bekannte und geschätzte Sammlung zumeist früher Alter-
tümer der Stadt zum Geschenke gemacht. Damit hat die Metropole am Rhein
einen neuen nicht unwesentlichen Vorsprung gewonnen vor anderen Kommunen;
nicht nur aus dem Schaffensgebiete heimatlicher, sondern auch aus dem nicht-
deutscher Länder ist ein reicher Zuwachs zu verzeichnen. Mehrere Objekte der
neuen Schenkung fanden bereits früher bei Gelegenheit der Besprechung der
retrospektiven Kunstausstellung in Düsseldorf 1902 an dieser Stelle eine ein-
gehende Besprechung, so die köstlichen Wandteppiche des XIV. und XV. Jahrh.,
Kaselstäbe, eine spätromanische Hostienbüche usw. Seit jener Zeit hat Clemens
eine große Menge von Neuerwerbungen gemacht, die heute das uneingeschränkte
Interesse der Fachleute wachrufen.
Die Sammlung ist überaus vielseitig, ist reichhaltig und —doch bietet sie fast
ausschließlich hohe und höchsteQuahtät. Man könnte sie, gemäß der vom Geschenk-
geber selbst beliebten Aufstellung im Kunstgewerbemuseum, in drei größere
Gruppen aufteilen : Waffen, mittelalterliche Kunst, Kunst der späteren Zeit bis etwa
Ende des XVIII. Jahrh. Innerhalb dieser Aufteilung heben sich einzelne geschlos-
sene Sonderabteilungen heraus, die sich nach dem Material (Keramik, Zinn usf.),
oder nach der Bestimmung (Ringe, Plaketten, Paramente usf.) zusammenschließen
und abrunden.
Aus dem reichhaltigen Schatze seien hier heute als für unsere Leser besonders
wertvolle und lehrreiche Stücke herausgehoben einige Madonnenfiguren der Gotik,
die zum Teil an Qualität kaum zu übertreffen sind. Interessant ist es auch, sich die
Zusammenhänge zurechtzulegen, die, kaum merklich oft, die einzelnen Stücke
miteinander verbinden und von der Gemeinsamkeit sprechen, die der Plastik des
XIV. Jahrh. auch weit auseinanderliegender Länder eigen ist. Auch hier äußert
sich der eine große Massenwille, der, fern von jedem zersetzenden Individualismus,
der Gotik jenen sieghaften überall durchdringenden Stilcharakter gebracht hat.
Nr. 1, eine nur 21 cm hohe Buchsfigur, ist zweifellos französischer Herkunft.
Sie steht auf der Grenzscheide französischer Kunst, auf der diese in starkem Hin-
drängen zum idealisierten Naturalismus die abstrakte hieratische Auffassung fallen
läßt und dem Wirkhchkeitssinn ihrer Zeit Rechnung trägt. Gleichzeitig verliert
die Plastik die Aufgabe, nur architektonische Eingliederung zu suchen, ein Teil
der Architektur zu sein, dessen Abstrich einen Eingriff in die Architektur selbst
bedeuten würde. Für die maßstäblich kleine Devotionsfigur, wie wir sie hier vor
uns haben, war das von Bedeutung und Gewinn insofern, als diese Loslösung von
der Architektur erst den Devotionsfiguren das erforderliche Einzelleben ermög-
lichte. Diesem Hindrängen zum Naturalismus ist es zu danken, daß das Figürchen
eine körperhafte Breite und Untersetztheit erhält, aus der das Empfinden für den
schönen Körper deutlich spricht. Körper und Gewand arbeiten zusammen, das