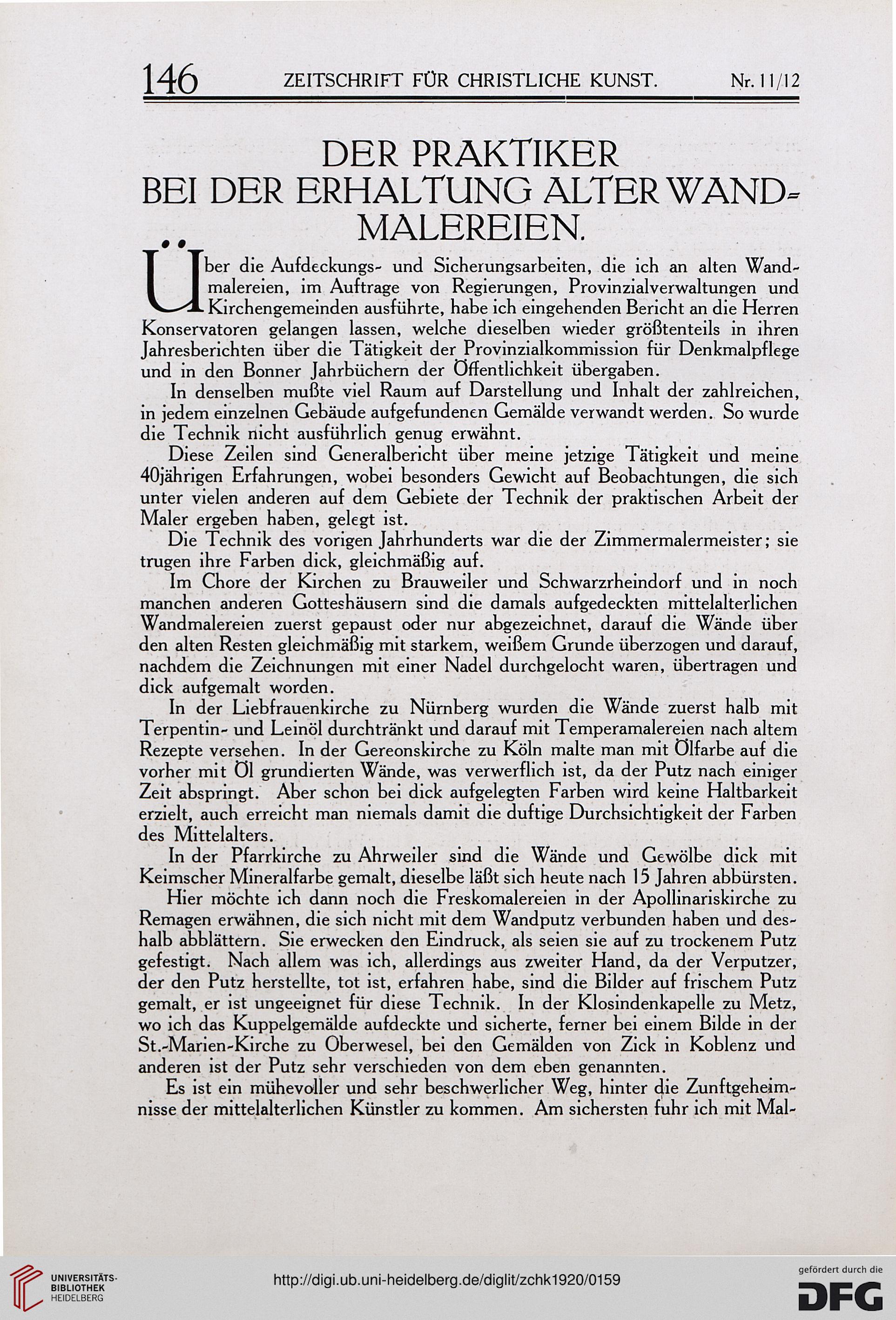146
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 11/12
DER PRAKTIKER
BEI DER ERHALTUNG ALTER WAND-
MALEREIEN.
Über die Aufdeckungs- und Sicherungsarbeiten, die ich an alten Wand-
malereien, im Auftrage von Regierungen, Provinzialverwaltungen und
Kirchengemeinden ausführte, habe ich eingehenden Bericht an die Herren
Konservatoren gelangen lassen, welche dieselben wieder größtenteils in ihren
Jahresberichten über die Tätigkeit der Provinzialkommission für Denkmalpflege
und in den Bonner Jahrbüchern der Öffentlichkeit übergaben.
In denselben mußte viel Raum auf Darstellung und Inhalt der zahlreichen,
in jedem einzelnen Gebäude aufgefundenen Gemälde verwandt werden. So wurde
die Technik nicht ausführlich genug erwähnt.
Diese Zeilen sind Generalbericht über meine jetzige Tätigkeit und meine
40jährigen Erfahrungen, wobei besonders Gewicht auf Beobachtungen, die sich
unter vielen anderen auf dem Gebiete der Technik der praktischen Arbeit der
Maler ergeben haben, gelegt ist.
Die Technik des vorigen Jahrhunderts war die der Zimmermalermeister; sie
trugen ihre Farben dick, gleichmäßig auf.
Im Chore der Kirchen zu Brauweiler und Schwarzrheindorf und in noch
manchen anderen Gotteshäusern sind die damals aufgedeckten mittelalterlichen
Wandmalereien zuerst gepaust oder nur abgezeichnet, darauf die Wände über
den alten Resten gleichmäßig mit starkem, weißem Grunde überzogen und darauf,
nachdem die Zeichnungen mit einer Nadel durchgelocht waren, übertragen und
dick aufgemalt worden.
In der Liebfrauenkirche zu Nürnberg wurden die Wände zuerst halb mit
Terpentin- und Leinöl durchtränkt und darauf mit Temperamalereien nach altem
Rezepte versehen. In der Gereonskirche zu Köln malte man mit Ölfarbe auf die
vorher mit öl grundierten Wände, was verwerflich ist, da der Putz nach einiger
Zeit abspringt. Aber schon bei dick aufgelegten Farben wird keine Haltbarkeit
erzielt, auch erreicht man niemals damit die duftige Durchsichtigkeit der Farben
des Mittelalters.
In der Pfarrkirche zu Ahrweiler sind die Wände und Gewölbe dick mit
Keimscher Mineralfarbe gemalt, dieselbe läßt sich heute nach 15 Jahren abbürsten.
Hier möchte ich dann noch die Freskomalereien in der Apollinanskirche zu
Remagen erwähnen, die sich nicht mit dem Wandputz verbunden haben und des-
halb abblättern. Sie erwecken den Eindruck, als seien sie auf zu trockenem Putz
gefestigt. Nach allem was ich, allerdings aus zweiter Hand, da der Verputzer,
der den Putz herstellte, tot ist, erfahren habe, sind die Bilder auf frischem Putz
gemalt, er ist ungeeignet für diese Technik. In der Klosmdenkapelle zu Metz,
wo ich das Kuppelgemälde aufdeckte und sicherte, ferner bei einem Bilde in der
St.-Marien-Kirche zu Oberwesel, bei den Gemälden von Zick in Koblenz und
anderen ist der Putz sehr verschieden von dem eben genannten.
Es ist ein mühevoller und sehr beschwerlicher Weg, hinter die Zunftgeheim-
nisse der mittelalterlichen Künstler zu kommen. Am sichersten fuhr ich mit Mal-
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 11/12
DER PRAKTIKER
BEI DER ERHALTUNG ALTER WAND-
MALEREIEN.
Über die Aufdeckungs- und Sicherungsarbeiten, die ich an alten Wand-
malereien, im Auftrage von Regierungen, Provinzialverwaltungen und
Kirchengemeinden ausführte, habe ich eingehenden Bericht an die Herren
Konservatoren gelangen lassen, welche dieselben wieder größtenteils in ihren
Jahresberichten über die Tätigkeit der Provinzialkommission für Denkmalpflege
und in den Bonner Jahrbüchern der Öffentlichkeit übergaben.
In denselben mußte viel Raum auf Darstellung und Inhalt der zahlreichen,
in jedem einzelnen Gebäude aufgefundenen Gemälde verwandt werden. So wurde
die Technik nicht ausführlich genug erwähnt.
Diese Zeilen sind Generalbericht über meine jetzige Tätigkeit und meine
40jährigen Erfahrungen, wobei besonders Gewicht auf Beobachtungen, die sich
unter vielen anderen auf dem Gebiete der Technik der praktischen Arbeit der
Maler ergeben haben, gelegt ist.
Die Technik des vorigen Jahrhunderts war die der Zimmermalermeister; sie
trugen ihre Farben dick, gleichmäßig auf.
Im Chore der Kirchen zu Brauweiler und Schwarzrheindorf und in noch
manchen anderen Gotteshäusern sind die damals aufgedeckten mittelalterlichen
Wandmalereien zuerst gepaust oder nur abgezeichnet, darauf die Wände über
den alten Resten gleichmäßig mit starkem, weißem Grunde überzogen und darauf,
nachdem die Zeichnungen mit einer Nadel durchgelocht waren, übertragen und
dick aufgemalt worden.
In der Liebfrauenkirche zu Nürnberg wurden die Wände zuerst halb mit
Terpentin- und Leinöl durchtränkt und darauf mit Temperamalereien nach altem
Rezepte versehen. In der Gereonskirche zu Köln malte man mit Ölfarbe auf die
vorher mit öl grundierten Wände, was verwerflich ist, da der Putz nach einiger
Zeit abspringt. Aber schon bei dick aufgelegten Farben wird keine Haltbarkeit
erzielt, auch erreicht man niemals damit die duftige Durchsichtigkeit der Farben
des Mittelalters.
In der Pfarrkirche zu Ahrweiler sind die Wände und Gewölbe dick mit
Keimscher Mineralfarbe gemalt, dieselbe läßt sich heute nach 15 Jahren abbürsten.
Hier möchte ich dann noch die Freskomalereien in der Apollinanskirche zu
Remagen erwähnen, die sich nicht mit dem Wandputz verbunden haben und des-
halb abblättern. Sie erwecken den Eindruck, als seien sie auf zu trockenem Putz
gefestigt. Nach allem was ich, allerdings aus zweiter Hand, da der Verputzer,
der den Putz herstellte, tot ist, erfahren habe, sind die Bilder auf frischem Putz
gemalt, er ist ungeeignet für diese Technik. In der Klosmdenkapelle zu Metz,
wo ich das Kuppelgemälde aufdeckte und sicherte, ferner bei einem Bilde in der
St.-Marien-Kirche zu Oberwesel, bei den Gemälden von Zick in Koblenz und
anderen ist der Putz sehr verschieden von dem eben genannten.
Es ist ein mühevoller und sehr beschwerlicher Weg, hinter die Zunftgeheim-
nisse der mittelalterlichen Künstler zu kommen. Am sichersten fuhr ich mit Mal-