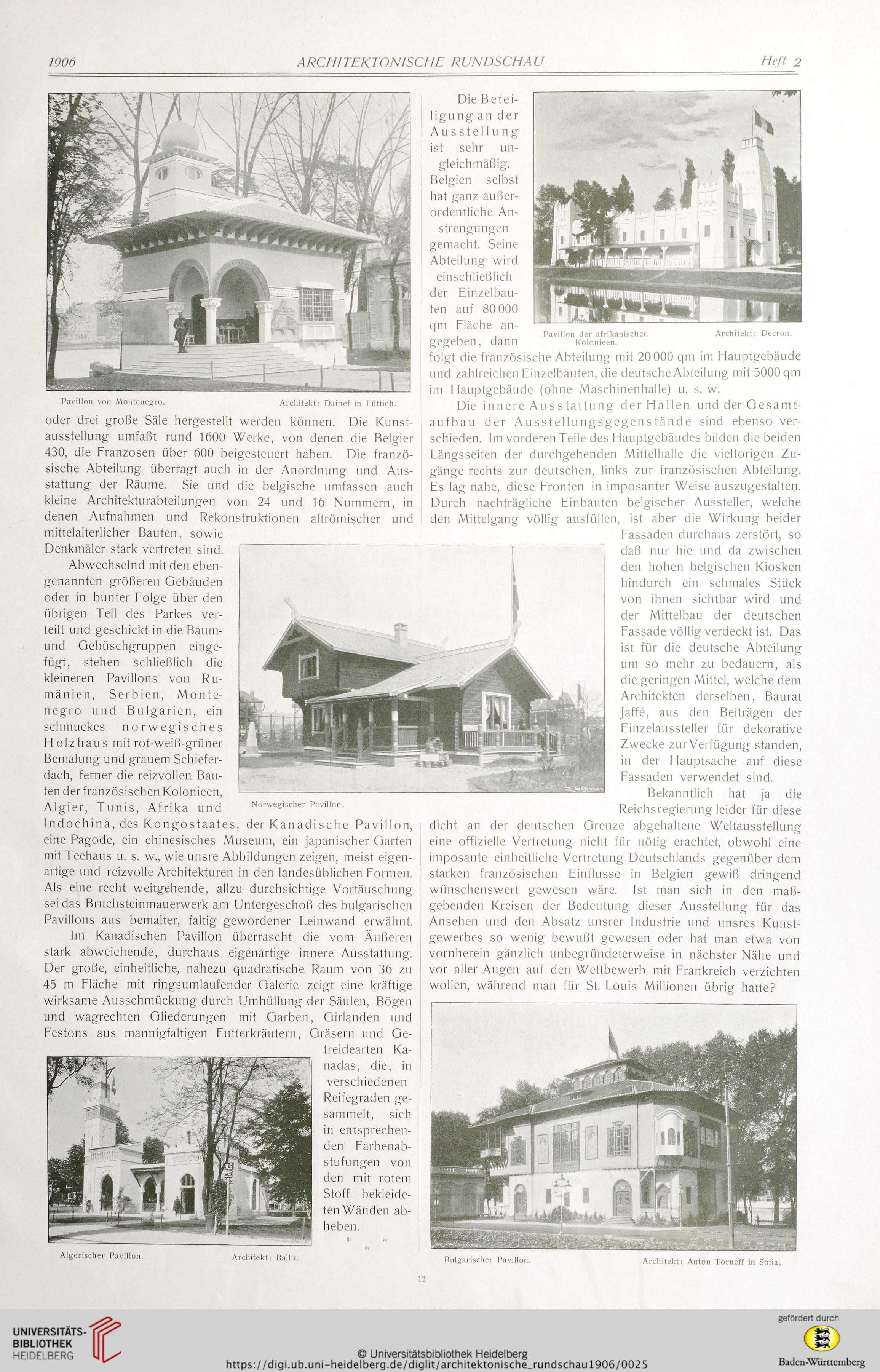1Q06
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHA U
Heft 2
Pavillon von Montenegro. Architekt: Dainef in Lüttich.
oder drei große Säle hergestellt werden können. Die Kunst-
ausstellung umfaßt rund 1600 Werke, von denen die Belgier
430, die Franzosen über 600 beigesteuert haben. Die franzö-
sische Abteilung überragt auch in der Anordnung und Aus-
stattung der Räume. Sie und die belgische umfassen auch
kleine Architekturabteilungen von 24 und 16 Nummern, in
denen Aufnahmen und Rekonstruktionen altrömischer und
mittelalterlicher Bauten, sowie
Die Betei¬
lig u n g a n der
Ausstellung
ist sehr un¬
gleichmäßig.
Belgien selbst
hat ganz außer¬
ordentliche An¬
strengungen
gemacht. Seine
Abteilung wird
einschließlich
der Einzelbau¬
ten auf 80 000
qm Fläche an¬
gegeben, dann
folgt die französische Abteilung mit 20 000 qm im Hauptgebäude
und zahlreichen Einzelbauten, die deutsche Abteilung mit 5000 qm
im Hauptgebäude (ohne Maschinenhalle) u. s. w.
Die innere Ausstattung der Hallen und der Oesamt-
aufbau der Ausstellungsgegenstände sind ebenso ver-
schieden. Im vorderen Teile des Hauptgebäudes bilden die beiden
Längsseiten der durchgehenden Mittelhalle die vieltorigen Zu-
gänge rechts zur deutschen, links zur französischen Abteilung.
Es lag nahe, diese Fronten in imposanter Weise auszugestalten.
Durch nachträgliche Einbauten belgischer Aussteller, welche
den Mittelgang völlig ausfüllen, ist aber die Wirkung beider
Fassaden durchaus zerstört, so
Architekt: Decron.
Pavillon der afrikanischen
Kolonieen.
Denkmäler stark vertreten sind.
Abwechselnd mit den eben-
genannten größeren Gebäuden
oder in bunter Folge über den
übrigen Teil des Parkes ver-
teilt und geschickt in die Baum-
und Gebüschgruppen einge-
fügt, stehen schließlich die
kleineren Pavillons von Ru¬
mänien, Serbien, Monte¬
negro und Bulgarien, ein
schmuckes norwegisches
Holzhaus mit rot-weiß-grüner
Bemalung und grauem Schiefer¬
dach, ferner die reizvollen Bau-
ten der französischen Kolonieen,
Algier, Tunis, Afrika und
Indochina, des Kongostaates, der Kan adi sehe Pavillon,
eine Pagode, ein chinesisches Museum, ein japanischer Garten
mit Teehaus u. s. w., wie unsre Abbildungen zeigen, meist eigen-
artige und reizvolle Architekturen in den landesüblichen Formen.
Als eine recht weitgehende, allzu durchsichtige Vortäuschung
sei das Bruchsteinmauerwerk am Untergeschoß des bulgarischen
Pavillons aus bemalter, faltig gewordener Leinwand erwähnt.
Im Kanadischen Pavillon überrascht die vom Äußeren
stark abweichende, durchaus eigenartige innere Ausstattung.
Der große, einheitliche, nahezu quadratische Raum von 36 zu
45 m Fläche mit ringsumlaufender Galerie zeigt eine kräftige
wirksame Ausschmückung durch Umhüllung der Säulen, Bögen
und wagrechten Gliederungen mit Garben, Girlanden und
Festons aus mannigfaltigen Futterkräutern, Gräsern und Ge-
treidearten Ka-
nadas, die, in
verschiedenen
Reifegraden ge-
sammelt, sich
in entsprechen-
den Farbenab-
stufungen von
den mit rotem
Stoff bekleide-
ten Wänden ab-
heben.
* *
$
Algerischer Pavillon. Architekt: Ballu.
daß nur hie und da zwischen
den hohen belgischen Kiosken
hindurch ein schmales Stück
von ihnen sichtbar wird und
der Mittelbau der deutschen
Fassade völlig verdeckt ist. Das
ist für die deutsche Abteilung
um so mehr zu bedauern, als
die geringen Mittel, welche dem
Architekten derselben, Baurat
Jaffe, aus den Beiträgen der
Einzelaussteller für dekorative
Zwecke zur Verfügung standen,
in der Hauptsache auf diese
Fassaden verwendet sind.
Bekanntlich hat ja die
Reichsregierung leider für diese
dicht an der deutschen Grenze abgehaltene Weltausstellung
eine offizielle Vertretung nicht für nötig erachtet, obwohl eine
imposante einheitliche Vertretung Deutschlands gegenüber dem
starken französischen Einflüsse in Belgien gewiß dringend
wünschenswert gewesen wäre. Ist man sich in den maß-
gebenden Kreisen der Bedeutung dieser Ausstellung für das
Ansehen und den Absatz unsrer Industrie und unsres Kunst-
gewerbes so wenig bewußt gewesen oder hat man etwa von
vornherein gänzlich unbegründeterweise in nächster Nähe und
vor aller Augen auf den Wettbewerb mit Frankreich verzichten
wollen, während man für St. Louis Millionen übrig hatte?
Bulgarischer Pavillon. Architekt: Anton Torneff in Sofia.
Norwegischer Pavillon.
13
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHA U
Heft 2
Pavillon von Montenegro. Architekt: Dainef in Lüttich.
oder drei große Säle hergestellt werden können. Die Kunst-
ausstellung umfaßt rund 1600 Werke, von denen die Belgier
430, die Franzosen über 600 beigesteuert haben. Die franzö-
sische Abteilung überragt auch in der Anordnung und Aus-
stattung der Räume. Sie und die belgische umfassen auch
kleine Architekturabteilungen von 24 und 16 Nummern, in
denen Aufnahmen und Rekonstruktionen altrömischer und
mittelalterlicher Bauten, sowie
Die Betei¬
lig u n g a n der
Ausstellung
ist sehr un¬
gleichmäßig.
Belgien selbst
hat ganz außer¬
ordentliche An¬
strengungen
gemacht. Seine
Abteilung wird
einschließlich
der Einzelbau¬
ten auf 80 000
qm Fläche an¬
gegeben, dann
folgt die französische Abteilung mit 20 000 qm im Hauptgebäude
und zahlreichen Einzelbauten, die deutsche Abteilung mit 5000 qm
im Hauptgebäude (ohne Maschinenhalle) u. s. w.
Die innere Ausstattung der Hallen und der Oesamt-
aufbau der Ausstellungsgegenstände sind ebenso ver-
schieden. Im vorderen Teile des Hauptgebäudes bilden die beiden
Längsseiten der durchgehenden Mittelhalle die vieltorigen Zu-
gänge rechts zur deutschen, links zur französischen Abteilung.
Es lag nahe, diese Fronten in imposanter Weise auszugestalten.
Durch nachträgliche Einbauten belgischer Aussteller, welche
den Mittelgang völlig ausfüllen, ist aber die Wirkung beider
Fassaden durchaus zerstört, so
Architekt: Decron.
Pavillon der afrikanischen
Kolonieen.
Denkmäler stark vertreten sind.
Abwechselnd mit den eben-
genannten größeren Gebäuden
oder in bunter Folge über den
übrigen Teil des Parkes ver-
teilt und geschickt in die Baum-
und Gebüschgruppen einge-
fügt, stehen schließlich die
kleineren Pavillons von Ru¬
mänien, Serbien, Monte¬
negro und Bulgarien, ein
schmuckes norwegisches
Holzhaus mit rot-weiß-grüner
Bemalung und grauem Schiefer¬
dach, ferner die reizvollen Bau-
ten der französischen Kolonieen,
Algier, Tunis, Afrika und
Indochina, des Kongostaates, der Kan adi sehe Pavillon,
eine Pagode, ein chinesisches Museum, ein japanischer Garten
mit Teehaus u. s. w., wie unsre Abbildungen zeigen, meist eigen-
artige und reizvolle Architekturen in den landesüblichen Formen.
Als eine recht weitgehende, allzu durchsichtige Vortäuschung
sei das Bruchsteinmauerwerk am Untergeschoß des bulgarischen
Pavillons aus bemalter, faltig gewordener Leinwand erwähnt.
Im Kanadischen Pavillon überrascht die vom Äußeren
stark abweichende, durchaus eigenartige innere Ausstattung.
Der große, einheitliche, nahezu quadratische Raum von 36 zu
45 m Fläche mit ringsumlaufender Galerie zeigt eine kräftige
wirksame Ausschmückung durch Umhüllung der Säulen, Bögen
und wagrechten Gliederungen mit Garben, Girlanden und
Festons aus mannigfaltigen Futterkräutern, Gräsern und Ge-
treidearten Ka-
nadas, die, in
verschiedenen
Reifegraden ge-
sammelt, sich
in entsprechen-
den Farbenab-
stufungen von
den mit rotem
Stoff bekleide-
ten Wänden ab-
heben.
* *
$
Algerischer Pavillon. Architekt: Ballu.
daß nur hie und da zwischen
den hohen belgischen Kiosken
hindurch ein schmales Stück
von ihnen sichtbar wird und
der Mittelbau der deutschen
Fassade völlig verdeckt ist. Das
ist für die deutsche Abteilung
um so mehr zu bedauern, als
die geringen Mittel, welche dem
Architekten derselben, Baurat
Jaffe, aus den Beiträgen der
Einzelaussteller für dekorative
Zwecke zur Verfügung standen,
in der Hauptsache auf diese
Fassaden verwendet sind.
Bekanntlich hat ja die
Reichsregierung leider für diese
dicht an der deutschen Grenze abgehaltene Weltausstellung
eine offizielle Vertretung nicht für nötig erachtet, obwohl eine
imposante einheitliche Vertretung Deutschlands gegenüber dem
starken französischen Einflüsse in Belgien gewiß dringend
wünschenswert gewesen wäre. Ist man sich in den maß-
gebenden Kreisen der Bedeutung dieser Ausstellung für das
Ansehen und den Absatz unsrer Industrie und unsres Kunst-
gewerbes so wenig bewußt gewesen oder hat man etwa von
vornherein gänzlich unbegründeterweise in nächster Nähe und
vor aller Augen auf den Wettbewerb mit Frankreich verzichten
wollen, während man für St. Louis Millionen übrig hatte?
Bulgarischer Pavillon. Architekt: Anton Torneff in Sofia.
Norwegischer Pavillon.
13