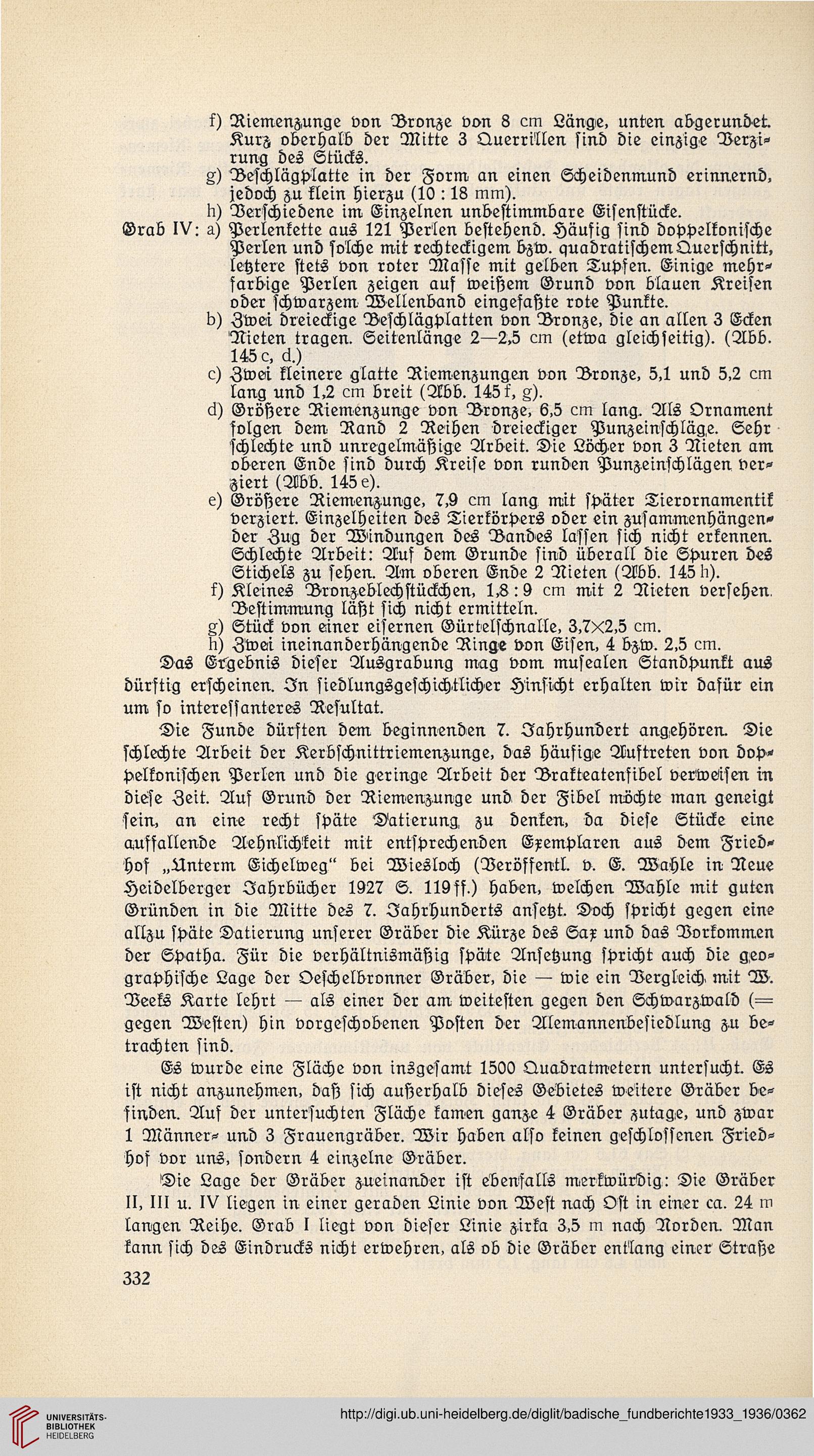k) RiemenWnge von Bronze von 8 cm Länge, unten abgerunöet.
Kurz oberhalb der Mitte 3 Querrillen sinö die einzige Derzi-
rung des Stücks.
§) Beschlägplatte in der Form an einen Scheidenmund erinnernö,
jedoch zu klein hierzu (10 :18 mm).
b) Derschiedene im Sinzelnen unbestimmbare Eisenstücke.
Grab IV: a) Perlenkette aus 121 Perlen bestehenö. Häufig sind doppelkonische
Perlen und solche mit rechteckigem bzw. quadratischemQuerschnitt,
letztere stets von roter Masse mit gelben Tupfen. Einige mehr-
farbige Perlen zeigen auf weihem Grund von blauen Kreisen
oder schwarzem Wellenband eingefaßte rote Punkte.
b) Zwei dreieckige Deschlägplatten von Bronze, öie an allen 3 Ecken
Meten tragen. Seitenlänge 2—2,5 cm (etwa gleichseitig). (Abb.
145 c, ck.)
c) Zwot kleinere glatte Riemenzungen von Bronze, 5,1 unö 5,2 cm
lang und 1,2 cm breit (Abb. 145 k, §).
ck) Größere Riemenzunge von Dronze, 6,5 cm lang. 2lls Ornament
folgen dem Rand 2 Reihen dreieckiger Punzeinschläge. Sehr
schlechte und unregLlmähige Arbeit. Die Löcher von 3 Rieten am
oberen Ende sind durch Kreise von runden Punzeinschlägen ver-
ziert (2l>bb. 145 e).
e) Größere Riemenzunge, 7,9 cm lang mit später Tierornamentik
verziert. Einzelheiten des Tierkörpers oder ein zusammenhängen-
der Zug der Windungen des Dandes lässen sich nicht erkennen.
Schlechte 2Irbeit: 2Iuf dem Grunöe sind überall öie Spuren des
Stichels zu sehen. 21m oberen Ende 2 Rieten (2lbb. 145 b).
k) Kleines Bronzeblechftückchen, 1,8 :9 cm mit 2 Rieten versehen
Destimmung läßt sich nicht ermitteln.
§) Stück von einer eisernen Gürtelschnalle, 3,7x2,5 cm.
b) Zwei ineinanderhängLnde Ringe von Eisen, 4 bzw. 2.5 cm.
Das Ergebnis dieser 2lusgrabung mag vom musealen Standpunkt aus
dürftig erscheinen. 2n siedlungsgeschichtlicher Hinsicht erhalten wir dafür ein
um so interessanteres Resultat.
Die Funde dürften dem beginnenden 7. Jahrhundert angehören. Die
schlechte 2lrbeit der Kerbschnittriemenzunge, öas häufige Auftreten von öop-
pelkonischen Perlen und die geringe 2lrbeit öer Brakteatenfibel verweisen in
diese Zeit. Auf Grund der Riemenzunge und öer Fibel möchte man geneigt
sein, an eine recht späte Datierung zu öenken, da diese Stücke eine
auffallende 2lehnlichkeit mit entsprechenden Exemplaren aus öem Frieö-
hof „Llnterm Eichelweg" bei Wiesloch (Derösfentl. v. E. Wahle in Reue
Heidelberger Fahrbücher 1927 S. 119ff.) haben, welchen Wahle mit guten
Gründen in die Mitte des 7. Fahrhunderts ansetzt. Doch spricht gegen eine
allzu späte Datierung unserer Gräber die Kürze des Sax und das Dorkommen
der Spatha. Für die verhältnismähig späte 2lnsetzung spricht auch öie geo-
graphische Lage der Oeschelbronner Gräber, öie — wie ein Dergleich mit W.
Veeks Karte lehrt — als einer der am weitesten gegen öen Schwarzwalö (—
gegen Westen) hin vorgeschobenen Posten öer 2llemannenbesieölung zu be-
trachten sind.
Es wurde eine Fläche von insgesamt 1502 Quaöratmetern untersucht. Es
ist nicht anzunehmen, daß sich außerhalb öiefes Gebietes weitere Gräber be-
finden. 2luf der unterfuchten Fläche kamen ganze 4 Gräber zutage, unö zwar
1 Männer- und 3 Frauengräber. Wir haben also keinen geschlossenen Frieö-
hof vor uns, sondern 4 einzelne Graber.
Die Lage der Gräber zueinanöer ist ebenfalls merkwürbig: Die Gräber
II, III u. IV liegen in einer geraden Linie von West nach Ost in einer ca. 24 m
langen Reihe. Grab I liegt von dieser Linie zirka 3,5 m nach Roröen. Man
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob die Gräber entlang einer Straße
332
Kurz oberhalb der Mitte 3 Querrillen sinö die einzige Derzi-
rung des Stücks.
§) Beschlägplatte in der Form an einen Scheidenmund erinnernö,
jedoch zu klein hierzu (10 :18 mm).
b) Derschiedene im Sinzelnen unbestimmbare Eisenstücke.
Grab IV: a) Perlenkette aus 121 Perlen bestehenö. Häufig sind doppelkonische
Perlen und solche mit rechteckigem bzw. quadratischemQuerschnitt,
letztere stets von roter Masse mit gelben Tupfen. Einige mehr-
farbige Perlen zeigen auf weihem Grund von blauen Kreisen
oder schwarzem Wellenband eingefaßte rote Punkte.
b) Zwei dreieckige Deschlägplatten von Bronze, öie an allen 3 Ecken
Meten tragen. Seitenlänge 2—2,5 cm (etwa gleichseitig). (Abb.
145 c, ck.)
c) Zwot kleinere glatte Riemenzungen von Bronze, 5,1 unö 5,2 cm
lang und 1,2 cm breit (Abb. 145 k, §).
ck) Größere Riemenzunge von Dronze, 6,5 cm lang. 2lls Ornament
folgen dem Rand 2 Reihen dreieckiger Punzeinschläge. Sehr
schlechte und unregLlmähige Arbeit. Die Löcher von 3 Rieten am
oberen Ende sind durch Kreise von runden Punzeinschlägen ver-
ziert (2l>bb. 145 e).
e) Größere Riemenzunge, 7,9 cm lang mit später Tierornamentik
verziert. Einzelheiten des Tierkörpers oder ein zusammenhängen-
der Zug der Windungen des Dandes lässen sich nicht erkennen.
Schlechte 2Irbeit: 2Iuf dem Grunöe sind überall öie Spuren des
Stichels zu sehen. 21m oberen Ende 2 Rieten (2lbb. 145 b).
k) Kleines Bronzeblechftückchen, 1,8 :9 cm mit 2 Rieten versehen
Destimmung läßt sich nicht ermitteln.
§) Stück von einer eisernen Gürtelschnalle, 3,7x2,5 cm.
b) Zwei ineinanderhängLnde Ringe von Eisen, 4 bzw. 2.5 cm.
Das Ergebnis dieser 2lusgrabung mag vom musealen Standpunkt aus
dürftig erscheinen. 2n siedlungsgeschichtlicher Hinsicht erhalten wir dafür ein
um so interessanteres Resultat.
Die Funde dürften dem beginnenden 7. Jahrhundert angehören. Die
schlechte 2lrbeit der Kerbschnittriemenzunge, öas häufige Auftreten von öop-
pelkonischen Perlen und die geringe 2lrbeit öer Brakteatenfibel verweisen in
diese Zeit. Auf Grund der Riemenzunge und öer Fibel möchte man geneigt
sein, an eine recht späte Datierung zu öenken, da diese Stücke eine
auffallende 2lehnlichkeit mit entsprechenden Exemplaren aus öem Frieö-
hof „Llnterm Eichelweg" bei Wiesloch (Derösfentl. v. E. Wahle in Reue
Heidelberger Fahrbücher 1927 S. 119ff.) haben, welchen Wahle mit guten
Gründen in die Mitte des 7. Fahrhunderts ansetzt. Doch spricht gegen eine
allzu späte Datierung unserer Gräber die Kürze des Sax und das Dorkommen
der Spatha. Für die verhältnismähig späte 2lnsetzung spricht auch öie geo-
graphische Lage der Oeschelbronner Gräber, öie — wie ein Dergleich mit W.
Veeks Karte lehrt — als einer der am weitesten gegen öen Schwarzwalö (—
gegen Westen) hin vorgeschobenen Posten öer 2llemannenbesieölung zu be-
trachten sind.
Es wurde eine Fläche von insgesamt 1502 Quaöratmetern untersucht. Es
ist nicht anzunehmen, daß sich außerhalb öiefes Gebietes weitere Gräber be-
finden. 2luf der unterfuchten Fläche kamen ganze 4 Gräber zutage, unö zwar
1 Männer- und 3 Frauengräber. Wir haben also keinen geschlossenen Frieö-
hof vor uns, sondern 4 einzelne Graber.
Die Lage der Gräber zueinanöer ist ebenfalls merkwürbig: Die Gräber
II, III u. IV liegen in einer geraden Linie von West nach Ost in einer ca. 24 m
langen Reihe. Grab I liegt von dieser Linie zirka 3,5 m nach Roröen. Man
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob die Gräber entlang einer Straße
332