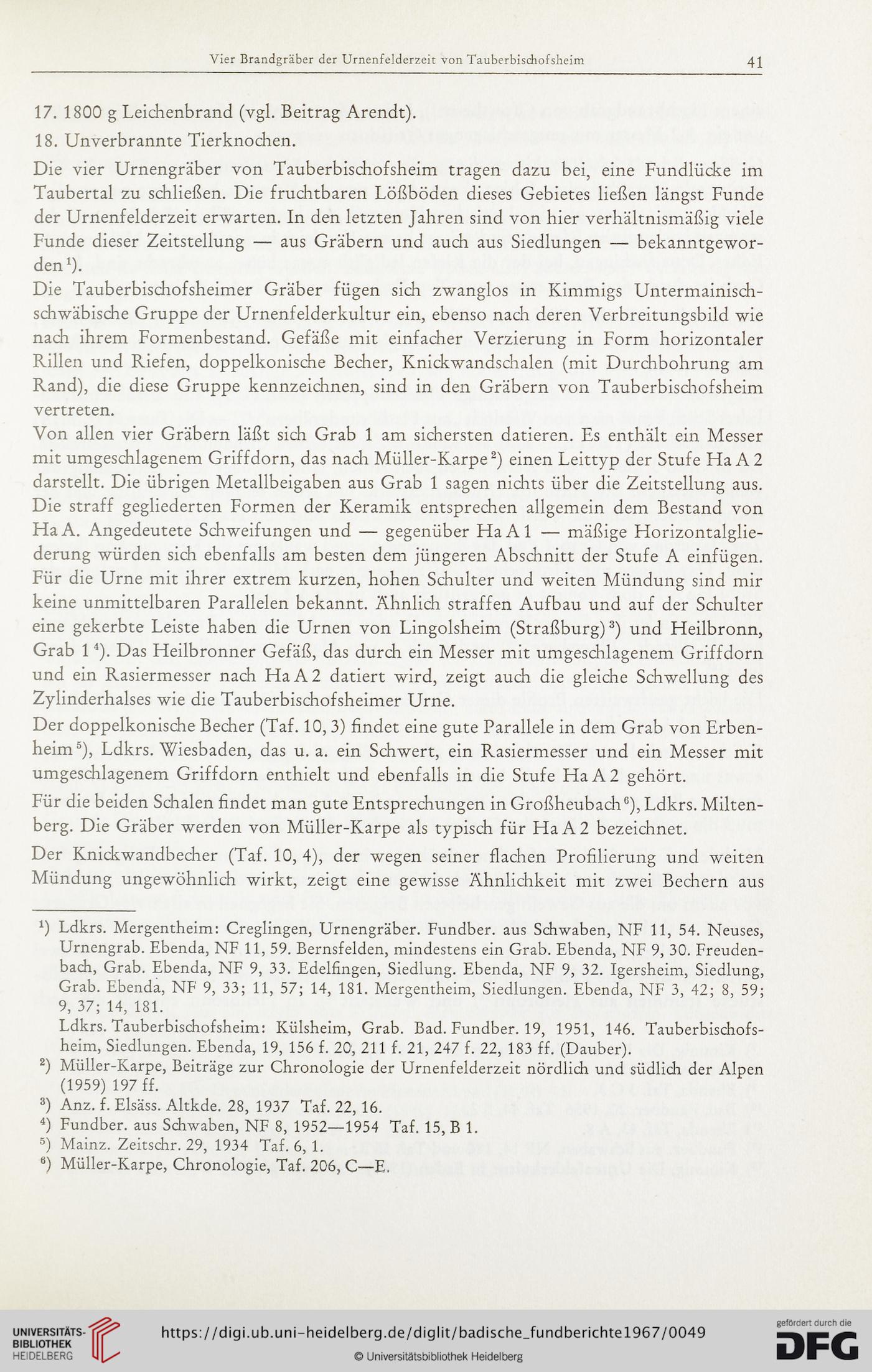Vier Brandgräber der Urnenfelderzeit von Tauberbischofsheim
41
17. 1800 g Leichenbrand (vgl. Beitrag Arendt).
18. Unverbrannte Tierknochen.
Die vier Urnengräber von Tauberbischofsheim tragen dazu bei, eine Fundlücke im
Taubertal zu schließen. Die fruchtbaren Lößböden dieses Gebietes ließen längst Funde
der Urnenfelderzeit erwarten. In den letzten Jahren sind von hier verhältnismäßig viele
Funde dieser Zeitstellung — aus Gräbern und auch aus Siedlungen — bekanntgewor-
den 1).
Die Tauberbischofsheimer Gräber fügen sich zwanglos in Kimmigs Untermainisch-
schwäbische Gruppe der Urnenfelderkultur ein, ebenso nach deren Verbreitungsbild wie
nach ihrem Formenbestand. Gefäße mit einfacher Verzierung in Form horizontaler
Rillen und Riefen, doppelkonische Becher, Knickwandschalen (mit Durchbohrung am
Rand), die diese Gruppe kennzeichnen, sind in den Gräbern von Tauberbischofsheim
vertreten.
Von allen vier Gräbern läßt sich Grab 1 am sichersten datieren. Es enthält ein Messer
mit umgeschlagenem Griffdorn, das nach Müller-Karpe2) einen Leittyp der Stufe Ha A 2
darstellt. Die übrigen Metallbeigaben aus Grab 1 sagen nichts über die Zeitstellung aus.
Die straff gegliederten Formen der Keramik entsprechen allgemein dem Bestand von
HaA. Angedeutete Schweifungen und — gegenüber Ha Al — mäßige Horizontalglie-
derung würden sich ebenfalls am besten dem jüngeren Abschnitt der Stufe A einfügen.
Für die Urne mit ihrer extrem kurzen, hohen Schulter und weiten Mündung sind mir
keine unmittelbaren Parallelen bekannt. Ähnlich straffen Aufbau und auf der Schulter
eine gekerbte Leiste haben die Urnen von Lingolsheim (Straßburg)3) und Heilbronn,
Grab 14). Das Heilbronner Gefäß, das durch ein Messer mit umgeschlagenem Griffdorn
und ein Rasiermesser nach HaA2 datiert wird, zeigt auch die gleiche Schwellung des
Zylinderhalses wie die Tauberbischofsheimer Urne.
Der doppelkonische Becher (Taf. 10, 3) findet eine gute Parallele in dem Grab von Erben-
heim5), Ldkrs. Wiesbaden, das u. a. ein Schwert, ein Rasiermesser und ein Messer mit
umgeschlagenem Griffdorn enthielt und ebenfalls in die Stufe HaA2 gehört.
Für die beiden Schalen findet man gute Entsprechungen in Großheubach6), Ldkrs. Milten-
berg. Die Gräber werden von Müller-Karpe als typisch für Ha A2 bezeichnet.
Der Knickwandbecher (Taf. 10, 4), der wegen seiner flachen Profilierung und weiten
Mündung ungewöhnlich wirkt, zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit zwei Bechern aus
4) Ldkrs. Mergentheim: Creglingen, Urnengräber. Fundber. aus Schwaben, NF 11, 54. Neuses,
Urnengrab. Ebenda, NF 11, 59. Bernsfelden, mindestens ein Grab. Ebenda, NF 9, 30. Freuden-
bach, Grab. Ebenda, NF 9, 33. Edelfingen, Siedlung. Ebenda, NF 9, 32. Igersheim, Siedlung,
Grab. Ebenda, NF 9, 33; 11, 57; 14, 181. Mergentheim, Siedlungen. Ebenda, NF 3, 42; 8, 59;
9, 37; 14, 181.
Ldkrs. Tauberbischofsheim: Külsheim, Grab. Bad. Fundber. 19, 1951, 146. Tauberbischofs-
heim, Siedlungen. Ebenda, 19, 156 f. 20, 211 f. 21, 247 f. 22, 183 ff. (Dauber).
2) Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen
(1959) 197 ff.
3) Anz. f. Elsäss. Altkde. 28, 1937 Taf. 22, 16.
4) Fundber. aus Schwaben, NF 8, 1952—1954 Taf. 15, B 1.
5) Mainz. Zeitschr. 29, 1934 Taf. 6, 1.
8) Müller-Karpe, Chronologie, Taf. 206, C—E.
41
17. 1800 g Leichenbrand (vgl. Beitrag Arendt).
18. Unverbrannte Tierknochen.
Die vier Urnengräber von Tauberbischofsheim tragen dazu bei, eine Fundlücke im
Taubertal zu schließen. Die fruchtbaren Lößböden dieses Gebietes ließen längst Funde
der Urnenfelderzeit erwarten. In den letzten Jahren sind von hier verhältnismäßig viele
Funde dieser Zeitstellung — aus Gräbern und auch aus Siedlungen — bekanntgewor-
den 1).
Die Tauberbischofsheimer Gräber fügen sich zwanglos in Kimmigs Untermainisch-
schwäbische Gruppe der Urnenfelderkultur ein, ebenso nach deren Verbreitungsbild wie
nach ihrem Formenbestand. Gefäße mit einfacher Verzierung in Form horizontaler
Rillen und Riefen, doppelkonische Becher, Knickwandschalen (mit Durchbohrung am
Rand), die diese Gruppe kennzeichnen, sind in den Gräbern von Tauberbischofsheim
vertreten.
Von allen vier Gräbern läßt sich Grab 1 am sichersten datieren. Es enthält ein Messer
mit umgeschlagenem Griffdorn, das nach Müller-Karpe2) einen Leittyp der Stufe Ha A 2
darstellt. Die übrigen Metallbeigaben aus Grab 1 sagen nichts über die Zeitstellung aus.
Die straff gegliederten Formen der Keramik entsprechen allgemein dem Bestand von
HaA. Angedeutete Schweifungen und — gegenüber Ha Al — mäßige Horizontalglie-
derung würden sich ebenfalls am besten dem jüngeren Abschnitt der Stufe A einfügen.
Für die Urne mit ihrer extrem kurzen, hohen Schulter und weiten Mündung sind mir
keine unmittelbaren Parallelen bekannt. Ähnlich straffen Aufbau und auf der Schulter
eine gekerbte Leiste haben die Urnen von Lingolsheim (Straßburg)3) und Heilbronn,
Grab 14). Das Heilbronner Gefäß, das durch ein Messer mit umgeschlagenem Griffdorn
und ein Rasiermesser nach HaA2 datiert wird, zeigt auch die gleiche Schwellung des
Zylinderhalses wie die Tauberbischofsheimer Urne.
Der doppelkonische Becher (Taf. 10, 3) findet eine gute Parallele in dem Grab von Erben-
heim5), Ldkrs. Wiesbaden, das u. a. ein Schwert, ein Rasiermesser und ein Messer mit
umgeschlagenem Griffdorn enthielt und ebenfalls in die Stufe HaA2 gehört.
Für die beiden Schalen findet man gute Entsprechungen in Großheubach6), Ldkrs. Milten-
berg. Die Gräber werden von Müller-Karpe als typisch für Ha A2 bezeichnet.
Der Knickwandbecher (Taf. 10, 4), der wegen seiner flachen Profilierung und weiten
Mündung ungewöhnlich wirkt, zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit zwei Bechern aus
4) Ldkrs. Mergentheim: Creglingen, Urnengräber. Fundber. aus Schwaben, NF 11, 54. Neuses,
Urnengrab. Ebenda, NF 11, 59. Bernsfelden, mindestens ein Grab. Ebenda, NF 9, 30. Freuden-
bach, Grab. Ebenda, NF 9, 33. Edelfingen, Siedlung. Ebenda, NF 9, 32. Igersheim, Siedlung,
Grab. Ebenda, NF 9, 33; 11, 57; 14, 181. Mergentheim, Siedlungen. Ebenda, NF 3, 42; 8, 59;
9, 37; 14, 181.
Ldkrs. Tauberbischofsheim: Külsheim, Grab. Bad. Fundber. 19, 1951, 146. Tauberbischofs-
heim, Siedlungen. Ebenda, 19, 156 f. 20, 211 f. 21, 247 f. 22, 183 ff. (Dauber).
2) Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen
(1959) 197 ff.
3) Anz. f. Elsäss. Altkde. 28, 1937 Taf. 22, 16.
4) Fundber. aus Schwaben, NF 8, 1952—1954 Taf. 15, B 1.
5) Mainz. Zeitschr. 29, 1934 Taf. 6, 1.
8) Müller-Karpe, Chronologie, Taf. 206, C—E.