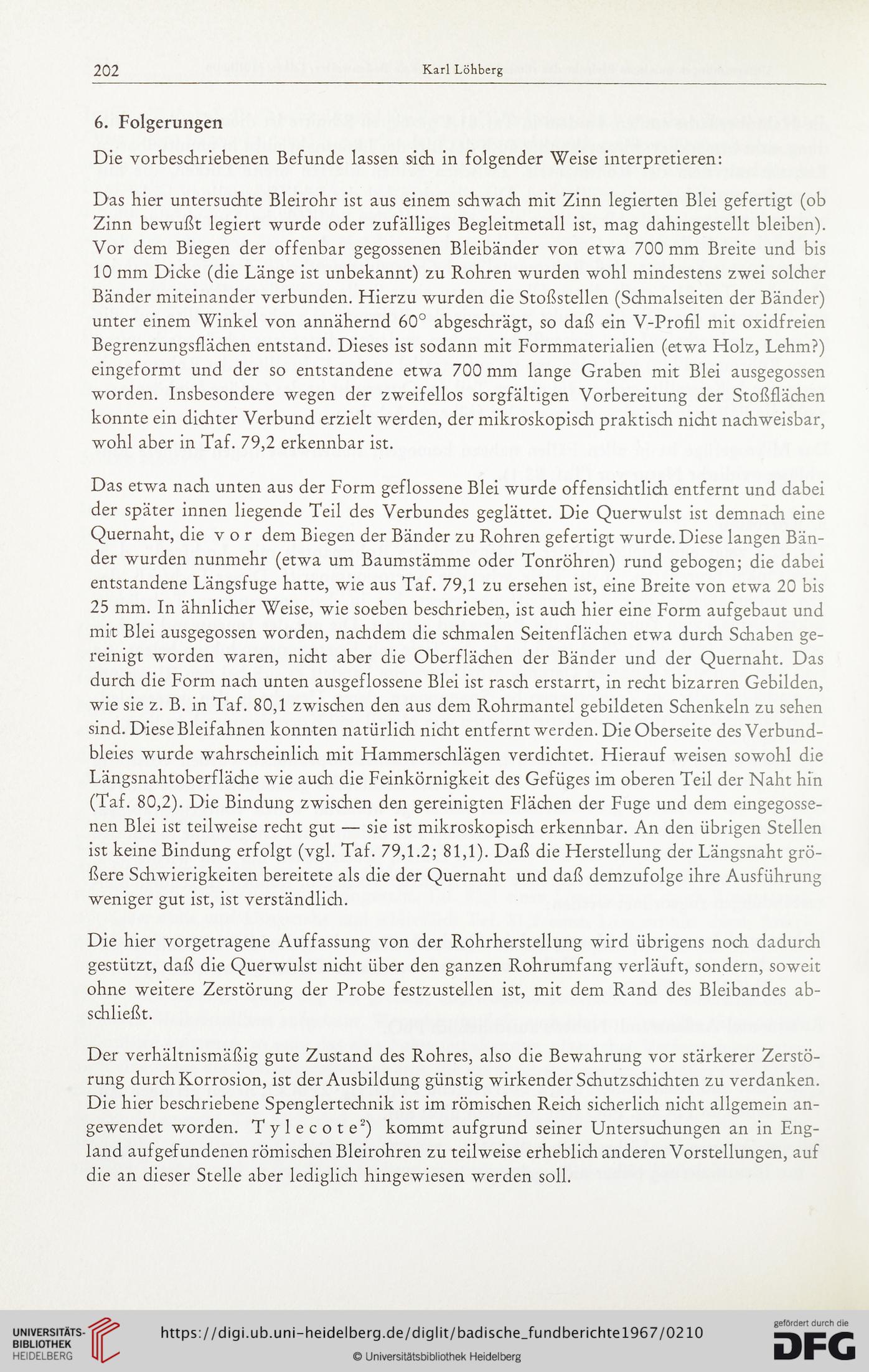202
Karl Löhberg
6. Folgerungen
Die vorbesdiriebenen Befunde lassen sich in folgender Weise interpretieren:
Das hier untersuchte Bleirohr ist aus einem schwach mit Zinn legierten Blei gefertigt (ob
Zinn bewußt legiert wurde oder zufälliges Begleitmetall ist, mag dahingestellt bleiben).
Vor dem Biegen der offenbar gegossenen Bleibänder von etwa 700 mm Breite und bis
10 mm Dicke (die Länge ist unbekannt) zu Rohren wurden wohl mindestens zwei solcher
Bänder miteinander verbunden. Hierzu wurden die Stoßstellen (Schmalseiten der Bänder)
unter einem Winkel von annähernd 60° abgeschrägt, so daß ein V-Profil mit oxidfreien
Begrenzungsflächen entstand. Dieses ist sodann mit Formmaterialien (etwa Holz, Lehm?)
eingeformt und der so entstandene etwa 700 mm lange Graben mit Blei ausgegossen
worden. Insbesondere wegen der zweifellos sorgfältigen Vorbereitung der Stoßflächen
konnte ein dichter Verbund erzielt werden, der mikroskopisch praktisch nicht nachweisbar,
wohl aber in Taf. 79,2 erkennbar ist.
Das etwa nach unten aus der Form geflossene Blei wurde offensichtlich entfernt und dabei
der später innen liegende Teil des Verbundes geglättet. Die Querwulst ist demnach eine
Quernaht, die vor dem Biegen der Bänder zu Rohren gefertigt wurde. Diese langen Bän-
der wurden nunmehr (etwa um Baumstämme oder Tonröhren) rund gebogen; die dabei
entstandene Längsfuge hatte, wie aus Taf. 79,1 zu ersehen ist, eine Breite von etwa 20 bis
25 mm. In ähnlicher Weise, wie soeben beschrieben, ist auch hier eine Form aufgebaut und
mit Blei ausgegossen worden, nachdem die schmalen Seitenflächen etwa durch Schaben ge-
reinigt worden waren, nicht aber die Oberflächen der Bänder und der Quernaht. Das
durch die Form nach unten ausgeflossene Blei ist rasch erstarrt, in recht bizarren Gebilden,
wie sie z. B. in Taf. 80,1 zwischen den aus dem Rohrmantel gebildeten Schenkeln zu sehen
sind. Diese Bleifahnen konnten natürlich nicht entfernt werden. Die Oberseite des Verbund-
bleies wurde wahrscheinlich mit Hammerschlägen verdichtet. Hierauf weisen sowohl die
Längsnahtoberfläche wie auch die Feinkörnigkeit des Gefüges im oberen Teil der Naht hin
(Taf. 80,2). Die Bindung zwischen den gereinigten Flächen der Fuge und dem eingegosse-
nen Blei ist teilweise recht gut — sie ist mikroskopisch erkennbar. An den übrigen Stellen
ist keine Bindung erfolgt (vgl. Taf. 79,1.2; 81,1). Daß die Herstellung der Längsnaht grö-
ßere Schwierigkeiten bereitete als die der Quernaht und daß demzufolge ihre Ausführung
weniger gut ist, ist verständlich.
Die hier vorgetragene Auffassung von der Rohrherstellung wird übrigens noch dadurch
gestützt, daß die Querwulst nicht über den ganzen Rohrumfang verläuft, sondern, soweit
ohne weitere Zerstörung der Probe festzustellen ist, mit dem Rand des Bleibandes ab-
schließt.
Der verhältnismäßig gute Zustand des Rohres, also die Bewahrung vor stärkerer Zerstö-
rung durch Korrosion, ist der Ausbildung günstig wirkender Schutzschichten zu verdanken.
Die hier beschriebene Spenglertechnik ist im römischen Reich sicherlich nicht allgemein an-
gewendet worden. Tylecote2) kommt aufgrund seiner Untersuchungen an in Eng-
land aufgefundenen römischen Bleirohren zu teilweise erheblich anderen Vorstellungen, auf
die an dieser Stelle aber lediglich hingewiesen werden soll.
Karl Löhberg
6. Folgerungen
Die vorbesdiriebenen Befunde lassen sich in folgender Weise interpretieren:
Das hier untersuchte Bleirohr ist aus einem schwach mit Zinn legierten Blei gefertigt (ob
Zinn bewußt legiert wurde oder zufälliges Begleitmetall ist, mag dahingestellt bleiben).
Vor dem Biegen der offenbar gegossenen Bleibänder von etwa 700 mm Breite und bis
10 mm Dicke (die Länge ist unbekannt) zu Rohren wurden wohl mindestens zwei solcher
Bänder miteinander verbunden. Hierzu wurden die Stoßstellen (Schmalseiten der Bänder)
unter einem Winkel von annähernd 60° abgeschrägt, so daß ein V-Profil mit oxidfreien
Begrenzungsflächen entstand. Dieses ist sodann mit Formmaterialien (etwa Holz, Lehm?)
eingeformt und der so entstandene etwa 700 mm lange Graben mit Blei ausgegossen
worden. Insbesondere wegen der zweifellos sorgfältigen Vorbereitung der Stoßflächen
konnte ein dichter Verbund erzielt werden, der mikroskopisch praktisch nicht nachweisbar,
wohl aber in Taf. 79,2 erkennbar ist.
Das etwa nach unten aus der Form geflossene Blei wurde offensichtlich entfernt und dabei
der später innen liegende Teil des Verbundes geglättet. Die Querwulst ist demnach eine
Quernaht, die vor dem Biegen der Bänder zu Rohren gefertigt wurde. Diese langen Bän-
der wurden nunmehr (etwa um Baumstämme oder Tonröhren) rund gebogen; die dabei
entstandene Längsfuge hatte, wie aus Taf. 79,1 zu ersehen ist, eine Breite von etwa 20 bis
25 mm. In ähnlicher Weise, wie soeben beschrieben, ist auch hier eine Form aufgebaut und
mit Blei ausgegossen worden, nachdem die schmalen Seitenflächen etwa durch Schaben ge-
reinigt worden waren, nicht aber die Oberflächen der Bänder und der Quernaht. Das
durch die Form nach unten ausgeflossene Blei ist rasch erstarrt, in recht bizarren Gebilden,
wie sie z. B. in Taf. 80,1 zwischen den aus dem Rohrmantel gebildeten Schenkeln zu sehen
sind. Diese Bleifahnen konnten natürlich nicht entfernt werden. Die Oberseite des Verbund-
bleies wurde wahrscheinlich mit Hammerschlägen verdichtet. Hierauf weisen sowohl die
Längsnahtoberfläche wie auch die Feinkörnigkeit des Gefüges im oberen Teil der Naht hin
(Taf. 80,2). Die Bindung zwischen den gereinigten Flächen der Fuge und dem eingegosse-
nen Blei ist teilweise recht gut — sie ist mikroskopisch erkennbar. An den übrigen Stellen
ist keine Bindung erfolgt (vgl. Taf. 79,1.2; 81,1). Daß die Herstellung der Längsnaht grö-
ßere Schwierigkeiten bereitete als die der Quernaht und daß demzufolge ihre Ausführung
weniger gut ist, ist verständlich.
Die hier vorgetragene Auffassung von der Rohrherstellung wird übrigens noch dadurch
gestützt, daß die Querwulst nicht über den ganzen Rohrumfang verläuft, sondern, soweit
ohne weitere Zerstörung der Probe festzustellen ist, mit dem Rand des Bleibandes ab-
schließt.
Der verhältnismäßig gute Zustand des Rohres, also die Bewahrung vor stärkerer Zerstö-
rung durch Korrosion, ist der Ausbildung günstig wirkender Schutzschichten zu verdanken.
Die hier beschriebene Spenglertechnik ist im römischen Reich sicherlich nicht allgemein an-
gewendet worden. Tylecote2) kommt aufgrund seiner Untersuchungen an in Eng-
land aufgefundenen römischen Bleirohren zu teilweise erheblich anderen Vorstellungen, auf
die an dieser Stelle aber lediglich hingewiesen werden soll.