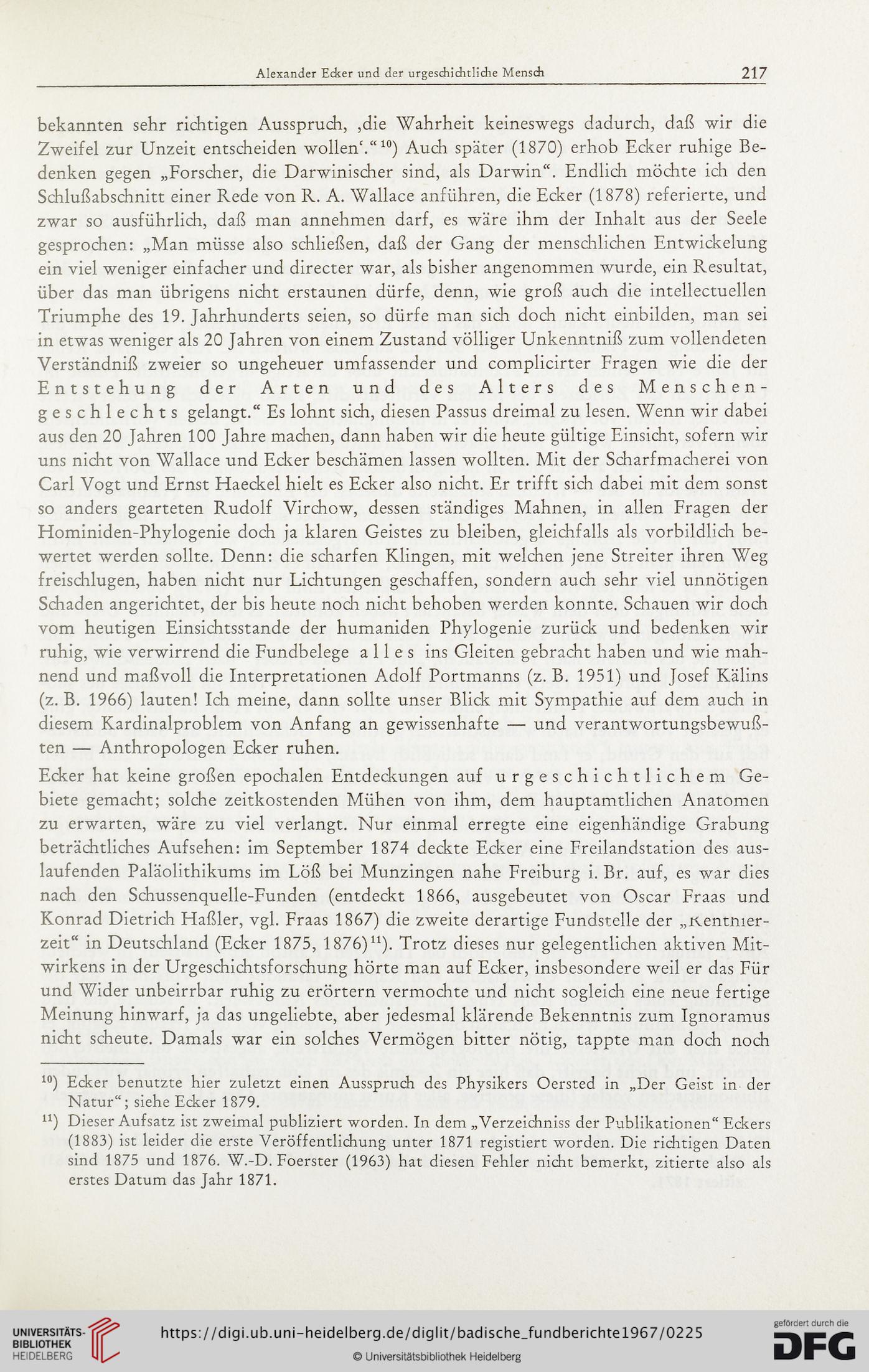Alexander Ecker und der urgeschichtliche Mensch
217
bekannten sehr richtigen Ausspruch, ,die Wahrheit keineswegs dadurch, daß wir die
Zweifel zur Unzeit entscheiden wollen'.“10) Auch später (1870) erhob Ecker ruhige Be-
denken gegen „Forscher, die Darwinischer sind, als Darwin“. Endlich möchte ich den
Schlußabschnitt einer Rede von R. A. Wallace anführen, die Ecker (1878) referierte, und
zwar so ausführlich, daß man annehmen darf, es wäre ihm der Inhalt aus der Seele
gesprochen: „Man müsse also schließen, daß der Gang der menschlichen Entwickelung
ein viel weniger einfacher und directer war, als bisher angenommen wurde, ein Resultat,
über das man übrigens nicht erstaunen dürfe, denn, wie groß auch die intellectuellen
Triumphe des 19. Jahrhunderts seien, so dürfe man sich doch nicht einbilden, man sei
in etwas weniger als 20 Jahren von einem Zustand völliger Unkenntniß zum vollendeten
Verständniß zweier so ungeheuer umfassender und complicirter Fragen wie die der
Entstehung der Arten und des Alters des Menschen-
geschlechts gelangt.“ Es lohnt sich, diesen Passus dreimal zu lesen. Wenn wir dabei
aus den 20 Jahren 100 Jahre machen, dann haben wir die heute gültige Einsicht, sofern wir
uns nicht von Wallace und Ecker beschämen lassen wollten. Mit der Scharfmacherei von
Carl Vogt und Ernst Haeckel hielt es Ecker also nicht. Er trifft sich dabei mit dem sonst
so anders gearteten Rudolf Virchow, dessen ständiges Mahnen, in allen Fragen der
Hominiden-Phylogenie doch ja klaren Geistes zu bleiben, gleichfalls als vorbildlich be-
wertet werden sollte. Denn: die scharfen Klingen, mit welchen jene Streiter ihren Weg
freischlugen, haben nicht nur Lichtungen geschaffen, sondern auch sehr viel unnötigen
Schaden angerichtet, der bis heute noch nicht behoben werden konnte. Schauen wir doch
vom heutigen Einsichtsstande der humaniden Phylogenie zurück und bedenken wir
ruhig, wie verwirrend die Fundbelege alles ins Gleiten gebracht haben und wie mah-
nend und maßvoll die Interpretationen Adolf Portmanns (z. B. 1951) und Josef Kälins
(z. B. 1966) lauten! Ich meine, dann sollte unser Blick mit Sympathie auf dem auch in
diesem Kardinalproblem von Anfang an gewissenhafte — und verantwortungsbewuß-
ten — Anthropologen Ecker ruhen.
Ecker hat keine großen epochalen Entdeckungen auf urgeschichtlichem Ge-
biete gemacht; solche zeitkostenden Mühen von ihm, dem hauptamtlichen Anatomen
zu erwarten, wäre zu viel verlangt. Nur einmal erregte eine eigenhändige Grabung
beträchtliches Aufsehen: im September 1874 deckte Ecker eine Freilandstation des aus-
laufenden Paläolithikums im Löß bei Munzingen nahe Freiburg i. Br. auf, es war dies
nach den Schussenquelle-Funden (entdeckt 1866, ausgebeutet von Oscar Fraas und
Konrad Dietrich Haßler, vgl. Fraas 1867) die zweite derartige Fundstelle der „Kentmer-
zeit“ in Deutschland (Ecker 1875, 1876)11). Trotz dieses nur gelegentlichen aktiven Mit-
wirkens in der Urgeschichtsforschung hörte man auf Ecker, insbesondere weil er das Für
und Wider unbeirrbar ruhig zu erörtern vermochte und nicht sogleich eine neue fertige
Meinung hinwarf, ja das ungeliebte, aber jedesmal klärende Bekenntnis zum Ignoramus
nicht scheute. Damals war ein solches Vermögen bitter nötig, tappte man doch noch
10) Ecker benutzte hier zuletzt einen Ausspruch des Physikers Oersted in „Der Geist in der
Natur“; siehe Ecker 1879.
n) Dieser Aufsatz ist zweimal publiziert worden. In dem „Verzeichniss der Publikationen“ Eckers
(1883) ist leider die erste Veröffentlichung unter 1871 registiert worden. Die richtigen Daten
sind 1875 und 1876. W.-D. Foerster (1963) hat diesen Fehler nicht bemerkt, zitierte also als
erstes Datum das Jahr 1871.
217
bekannten sehr richtigen Ausspruch, ,die Wahrheit keineswegs dadurch, daß wir die
Zweifel zur Unzeit entscheiden wollen'.“10) Auch später (1870) erhob Ecker ruhige Be-
denken gegen „Forscher, die Darwinischer sind, als Darwin“. Endlich möchte ich den
Schlußabschnitt einer Rede von R. A. Wallace anführen, die Ecker (1878) referierte, und
zwar so ausführlich, daß man annehmen darf, es wäre ihm der Inhalt aus der Seele
gesprochen: „Man müsse also schließen, daß der Gang der menschlichen Entwickelung
ein viel weniger einfacher und directer war, als bisher angenommen wurde, ein Resultat,
über das man übrigens nicht erstaunen dürfe, denn, wie groß auch die intellectuellen
Triumphe des 19. Jahrhunderts seien, so dürfe man sich doch nicht einbilden, man sei
in etwas weniger als 20 Jahren von einem Zustand völliger Unkenntniß zum vollendeten
Verständniß zweier so ungeheuer umfassender und complicirter Fragen wie die der
Entstehung der Arten und des Alters des Menschen-
geschlechts gelangt.“ Es lohnt sich, diesen Passus dreimal zu lesen. Wenn wir dabei
aus den 20 Jahren 100 Jahre machen, dann haben wir die heute gültige Einsicht, sofern wir
uns nicht von Wallace und Ecker beschämen lassen wollten. Mit der Scharfmacherei von
Carl Vogt und Ernst Haeckel hielt es Ecker also nicht. Er trifft sich dabei mit dem sonst
so anders gearteten Rudolf Virchow, dessen ständiges Mahnen, in allen Fragen der
Hominiden-Phylogenie doch ja klaren Geistes zu bleiben, gleichfalls als vorbildlich be-
wertet werden sollte. Denn: die scharfen Klingen, mit welchen jene Streiter ihren Weg
freischlugen, haben nicht nur Lichtungen geschaffen, sondern auch sehr viel unnötigen
Schaden angerichtet, der bis heute noch nicht behoben werden konnte. Schauen wir doch
vom heutigen Einsichtsstande der humaniden Phylogenie zurück und bedenken wir
ruhig, wie verwirrend die Fundbelege alles ins Gleiten gebracht haben und wie mah-
nend und maßvoll die Interpretationen Adolf Portmanns (z. B. 1951) und Josef Kälins
(z. B. 1966) lauten! Ich meine, dann sollte unser Blick mit Sympathie auf dem auch in
diesem Kardinalproblem von Anfang an gewissenhafte — und verantwortungsbewuß-
ten — Anthropologen Ecker ruhen.
Ecker hat keine großen epochalen Entdeckungen auf urgeschichtlichem Ge-
biete gemacht; solche zeitkostenden Mühen von ihm, dem hauptamtlichen Anatomen
zu erwarten, wäre zu viel verlangt. Nur einmal erregte eine eigenhändige Grabung
beträchtliches Aufsehen: im September 1874 deckte Ecker eine Freilandstation des aus-
laufenden Paläolithikums im Löß bei Munzingen nahe Freiburg i. Br. auf, es war dies
nach den Schussenquelle-Funden (entdeckt 1866, ausgebeutet von Oscar Fraas und
Konrad Dietrich Haßler, vgl. Fraas 1867) die zweite derartige Fundstelle der „Kentmer-
zeit“ in Deutschland (Ecker 1875, 1876)11). Trotz dieses nur gelegentlichen aktiven Mit-
wirkens in der Urgeschichtsforschung hörte man auf Ecker, insbesondere weil er das Für
und Wider unbeirrbar ruhig zu erörtern vermochte und nicht sogleich eine neue fertige
Meinung hinwarf, ja das ungeliebte, aber jedesmal klärende Bekenntnis zum Ignoramus
nicht scheute. Damals war ein solches Vermögen bitter nötig, tappte man doch noch
10) Ecker benutzte hier zuletzt einen Ausspruch des Physikers Oersted in „Der Geist in der
Natur“; siehe Ecker 1879.
n) Dieser Aufsatz ist zweimal publiziert worden. In dem „Verzeichniss der Publikationen“ Eckers
(1883) ist leider die erste Veröffentlichung unter 1871 registiert worden. Die richtigen Daten
sind 1875 und 1876. W.-D. Foerster (1963) hat diesen Fehler nicht bemerkt, zitierte also als
erstes Datum das Jahr 1871.