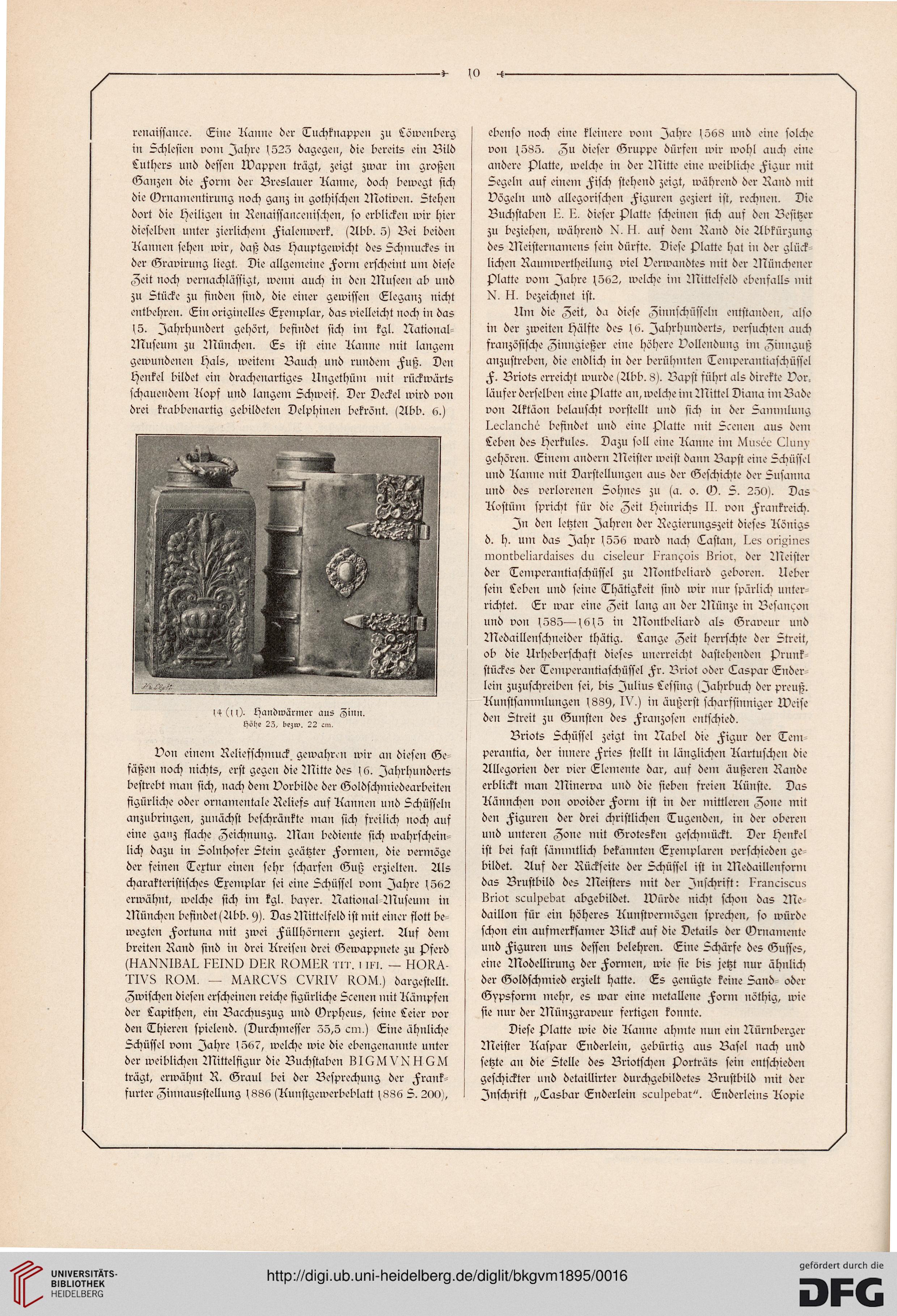renaissance. Eine Kanne der Tuchknappe» zu Löwenberg
in Schlesien vom Jaljre (523 dagegen, die bereits ein Bild
Luthers und dessen Wappen tragt, zeigt zwar im großen
Ganzen die Form der Breslauer Kanne, doch bewegt sich
die Ornamentirung noch ganz in gothischeu Motiven. Stehen
dort die heiligen in Renaissancenischen, so erblicken wir hier
dieselben unter zierlichem Fialenwerk. lAbb. 5) Bei beiden
Kannen sehen wir, daß das Hauptgewicht des Schmuckes in
der Gravirung liegt. Die allgemeine Form erscheint um diese
Zeit noch vernachlässigt, wenn auch in den Museen ab und
zu Stücke zu finden sind, die einer gewissen Eleganz nicht
entbehren. Ein originelles Exemplar, das vielleicht noch in das
(5. Jahrhundert gehört, befindet sich im kgl. National-
Museum zu München. Es ist eine Kanne mit langem
gewundenen hals, weitem Bauch und rundem Fuß. Den
Henkel bildet ein drachenartiges Ungethüm mit rückwärts
schauendem Kopf und langem Schweif. Der Deckel wird von
drei krabbenartig gebildeten Delphinen bekrönt. (Abb. 6.)
W (u). Bandwürmer aus Zinn.
höbe 23, bezw. 22 cm.
Bon einem Reliefschmuck, gewahren wir an diesen Ge-
fäßen noch nichts, erst gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts
bestrebt man sich, nach dem Borbilde der Goldschmiedearbeiten
figürliche oder ornamentale Reliefs auf Kannen und Schüsseln
anzubringen, zunächst beschränkte man sich freilich noch auf
eine ganz flache Zeichnung. Man bediente sich wahrschein-
lich dazu in Solnhofer Stein geätzter Formen, die vermöge
der feinen Textur einen sehr scharfen Guß erzielten. Als
charakteristisches Exemplar sei eine Schüssel vorn Jahre (562
erwähnt, welche sich im kgl. bayer. National Museum in
München befindet (Abb. 9). Das Mittelfeld ist mit einer flott be
wegten Fortuna mit zwei Füllhörnern geziert. Auf dem
breiten Rand sind in drei Kreisen drei Gewappnete zu Pferd
(HANNIBAL FEIND DER RÖMER tit. i ifj. — HORA-
TIVS ROM. — MARC VS CVRIV ROM.) dargestellt.
Zwischen diesen erscheinen reiche figürliche Scenen mit Kämpfen
der Lapithen, ein Bacchuszug und Orpheus, seine Leier vor
den Thieren spielend. (Durchmesser 33,5 cm.) Eine ähnliche
Schüssel vom Zahre (567, welche wie die ebengenannte unter
der weiblichen Mittelfigur die Buchstaben BIGMVNHGM
trägt, erwähnt R. Graul bei der Besprechung der Frank-
furter Zinnausstellung 1886 (Kunstgewerbeblatt (886 5. 200),
ebenso noch eine kleinere vom Jahre (568 und eine solche
von (585. Zu dieser Gruppe dürfen wir wohl auch eine
andere Platte, welche in der Mitte eine weibliche Figur mit
Segeln auf einem Fisch stehend zeigt, während der Rand mit
Bögeln und allegorischen Figuren geziert ist, rechnen. Die
Buchstaben E. E. dieser Platte scheinen sich auf den Besitzer
zu beziehen, während N. H. aus dem Rand die Abkürzung
des Meisternamens sein dürfte. Diese Platte hat in der glück-
lichen Raumvertheilung viel Verwandtes mit der Münchener
Platte vom Zahre (562, welche im Mittelfeld ebenfalls mit
N. H. bezeichnet ist.
Hm die Zeit, da diese Zinnschüsseln entstanden, also
in der zweiten Hälfte des (6. Jahrhunderts, versuchten auch
französische Zinngießer eine höhere Vollendung im Zinnguß
anzustreben, die endlich in der berühmten Temperantiaschüssel
F. Briots erreicht wurde (Abb. 8). Bapst führt als direkte Vor-
läufer derselben eine Platte an, welche im Mittel Diana im Bade
von Aktäon belauscht vorstellt und sich in der Sammlung
Leclanchd befindet und eine Platte mit Scenen aus dem
Leben des Herkules. Dazu soll eine Kanne im Musee Cluny
gehören. Einem andern Meister weist dann Bapst eine Schüssel
und Kanne mit Darstellungen aus der Geschichte der Susanna
und des verlorenen Sohnes zu (a. o. O. S. 250). Das
Kostüm spricht für die Zeit Heinrichs II. von Frankreich.
Zn den letzten Jahren der Regierungszeit dieses Königs
d. h. um das Zahr (556 ward nach Tastan, Ees origines
montbeliardaises du ciseleur Francois Briot, der Meister
der Temperantiaschüssel zu Montbeliard geboren. lieber
sein Leben und seine Thätigkeit sind wir nur spärlich unter
richtet. Er war eine Zeit lang an der Münze in Besancon
und von (585—(6(5 in Montbeliard als Graveur und
Medaillenschneider thätig. Lange Zeit herrschte der Streit,
ob die Urheberschaft dieses unerreicht dastehenden Prunk
stückes der Temperantiaschüssel Fr. Briot oder Taspar Ender
lein zuzuschreiben sei, bis Julius Lessiug (Zahrbuch der preuß.
Kunstsammlungen (889, IV.) in äußerst scharfsinniger Weise
den Streit zu Gunsten des Franzosen entschied.
Briots Schüssel zeigt im Nabel die Figur der Tem
perantia, der innere Fries stellt in länglichen Kartuschen die
Allegorien der vier Elemente dar, auf dem äußeren Rande
erblickt man Minerva und die sieben freien Künste. Das
Kännchen von ovoider Form ist in der mittleren Zone mit
den Figuren der drei christlichen Tugenden, in der oberen
und unteren Zone mit Grotesken geschmückt. Der Henkel
ist bei fast sämmtlich bekannten Exemplaren verschieden ge
bildet. Auf der Rückseite der Schüssel ist in Medaillensorm
das Brustbild des Meisters mit der Zuschrift: FrancNcus
Brior «culpebar abgebildet. Würde nicht schon das Me
daillon für ein höheres Kunstvermögen sprechen, so würde
schon ein aufmerksamer Blick auf die Details der Ornamente
und Figuren uns dessen belehren. Eine Schärfe des Gusses,
eine Modellirung der Formen, wie sie bis jetzt nur ähnlich
der Goldschmied erzielt hatte. Es genügte keine Sand- oder
Gypsform mehr, es war eine metallene Form nöthig, wie
sie nur der Münzgraveur fertigen konnte.
Diese Platte wie die Kanne ahmte nun ein Nürnberger
Meister Kaspar Enderlein, gebürtig aus Basel nach und
setzte an die Stelle des Briotfchen Porträts sein entschieden
geschickter und detaillirter durchgebildetes Brustbild mit der
Zuschrift „Tasbar Enderlein sculpebar". Enderleins Kopie
in Schlesien vom Jaljre (523 dagegen, die bereits ein Bild
Luthers und dessen Wappen tragt, zeigt zwar im großen
Ganzen die Form der Breslauer Kanne, doch bewegt sich
die Ornamentirung noch ganz in gothischeu Motiven. Stehen
dort die heiligen in Renaissancenischen, so erblicken wir hier
dieselben unter zierlichem Fialenwerk. lAbb. 5) Bei beiden
Kannen sehen wir, daß das Hauptgewicht des Schmuckes in
der Gravirung liegt. Die allgemeine Form erscheint um diese
Zeit noch vernachlässigt, wenn auch in den Museen ab und
zu Stücke zu finden sind, die einer gewissen Eleganz nicht
entbehren. Ein originelles Exemplar, das vielleicht noch in das
(5. Jahrhundert gehört, befindet sich im kgl. National-
Museum zu München. Es ist eine Kanne mit langem
gewundenen hals, weitem Bauch und rundem Fuß. Den
Henkel bildet ein drachenartiges Ungethüm mit rückwärts
schauendem Kopf und langem Schweif. Der Deckel wird von
drei krabbenartig gebildeten Delphinen bekrönt. (Abb. 6.)
W (u). Bandwürmer aus Zinn.
höbe 23, bezw. 22 cm.
Bon einem Reliefschmuck, gewahren wir an diesen Ge-
fäßen noch nichts, erst gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts
bestrebt man sich, nach dem Borbilde der Goldschmiedearbeiten
figürliche oder ornamentale Reliefs auf Kannen und Schüsseln
anzubringen, zunächst beschränkte man sich freilich noch auf
eine ganz flache Zeichnung. Man bediente sich wahrschein-
lich dazu in Solnhofer Stein geätzter Formen, die vermöge
der feinen Textur einen sehr scharfen Guß erzielten. Als
charakteristisches Exemplar sei eine Schüssel vorn Jahre (562
erwähnt, welche sich im kgl. bayer. National Museum in
München befindet (Abb. 9). Das Mittelfeld ist mit einer flott be
wegten Fortuna mit zwei Füllhörnern geziert. Auf dem
breiten Rand sind in drei Kreisen drei Gewappnete zu Pferd
(HANNIBAL FEIND DER RÖMER tit. i ifj. — HORA-
TIVS ROM. — MARC VS CVRIV ROM.) dargestellt.
Zwischen diesen erscheinen reiche figürliche Scenen mit Kämpfen
der Lapithen, ein Bacchuszug und Orpheus, seine Leier vor
den Thieren spielend. (Durchmesser 33,5 cm.) Eine ähnliche
Schüssel vom Zahre (567, welche wie die ebengenannte unter
der weiblichen Mittelfigur die Buchstaben BIGMVNHGM
trägt, erwähnt R. Graul bei der Besprechung der Frank-
furter Zinnausstellung 1886 (Kunstgewerbeblatt (886 5. 200),
ebenso noch eine kleinere vom Jahre (568 und eine solche
von (585. Zu dieser Gruppe dürfen wir wohl auch eine
andere Platte, welche in der Mitte eine weibliche Figur mit
Segeln auf einem Fisch stehend zeigt, während der Rand mit
Bögeln und allegorischen Figuren geziert ist, rechnen. Die
Buchstaben E. E. dieser Platte scheinen sich auf den Besitzer
zu beziehen, während N. H. aus dem Rand die Abkürzung
des Meisternamens sein dürfte. Diese Platte hat in der glück-
lichen Raumvertheilung viel Verwandtes mit der Münchener
Platte vom Zahre (562, welche im Mittelfeld ebenfalls mit
N. H. bezeichnet ist.
Hm die Zeit, da diese Zinnschüsseln entstanden, also
in der zweiten Hälfte des (6. Jahrhunderts, versuchten auch
französische Zinngießer eine höhere Vollendung im Zinnguß
anzustreben, die endlich in der berühmten Temperantiaschüssel
F. Briots erreicht wurde (Abb. 8). Bapst führt als direkte Vor-
läufer derselben eine Platte an, welche im Mittel Diana im Bade
von Aktäon belauscht vorstellt und sich in der Sammlung
Leclanchd befindet und eine Platte mit Scenen aus dem
Leben des Herkules. Dazu soll eine Kanne im Musee Cluny
gehören. Einem andern Meister weist dann Bapst eine Schüssel
und Kanne mit Darstellungen aus der Geschichte der Susanna
und des verlorenen Sohnes zu (a. o. O. S. 250). Das
Kostüm spricht für die Zeit Heinrichs II. von Frankreich.
Zn den letzten Jahren der Regierungszeit dieses Königs
d. h. um das Zahr (556 ward nach Tastan, Ees origines
montbeliardaises du ciseleur Francois Briot, der Meister
der Temperantiaschüssel zu Montbeliard geboren. lieber
sein Leben und seine Thätigkeit sind wir nur spärlich unter
richtet. Er war eine Zeit lang an der Münze in Besancon
und von (585—(6(5 in Montbeliard als Graveur und
Medaillenschneider thätig. Lange Zeit herrschte der Streit,
ob die Urheberschaft dieses unerreicht dastehenden Prunk
stückes der Temperantiaschüssel Fr. Briot oder Taspar Ender
lein zuzuschreiben sei, bis Julius Lessiug (Zahrbuch der preuß.
Kunstsammlungen (889, IV.) in äußerst scharfsinniger Weise
den Streit zu Gunsten des Franzosen entschied.
Briots Schüssel zeigt im Nabel die Figur der Tem
perantia, der innere Fries stellt in länglichen Kartuschen die
Allegorien der vier Elemente dar, auf dem äußeren Rande
erblickt man Minerva und die sieben freien Künste. Das
Kännchen von ovoider Form ist in der mittleren Zone mit
den Figuren der drei christlichen Tugenden, in der oberen
und unteren Zone mit Grotesken geschmückt. Der Henkel
ist bei fast sämmtlich bekannten Exemplaren verschieden ge
bildet. Auf der Rückseite der Schüssel ist in Medaillensorm
das Brustbild des Meisters mit der Zuschrift: FrancNcus
Brior «culpebar abgebildet. Würde nicht schon das Me
daillon für ein höheres Kunstvermögen sprechen, so würde
schon ein aufmerksamer Blick auf die Details der Ornamente
und Figuren uns dessen belehren. Eine Schärfe des Gusses,
eine Modellirung der Formen, wie sie bis jetzt nur ähnlich
der Goldschmied erzielt hatte. Es genügte keine Sand- oder
Gypsform mehr, es war eine metallene Form nöthig, wie
sie nur der Münzgraveur fertigen konnte.
Diese Platte wie die Kanne ahmte nun ein Nürnberger
Meister Kaspar Enderlein, gebürtig aus Basel nach und
setzte an die Stelle des Briotfchen Porträts sein entschieden
geschickter und detaillirter durchgebildetes Brustbild mit der
Zuschrift „Tasbar Enderlein sculpebar". Enderleins Kopie