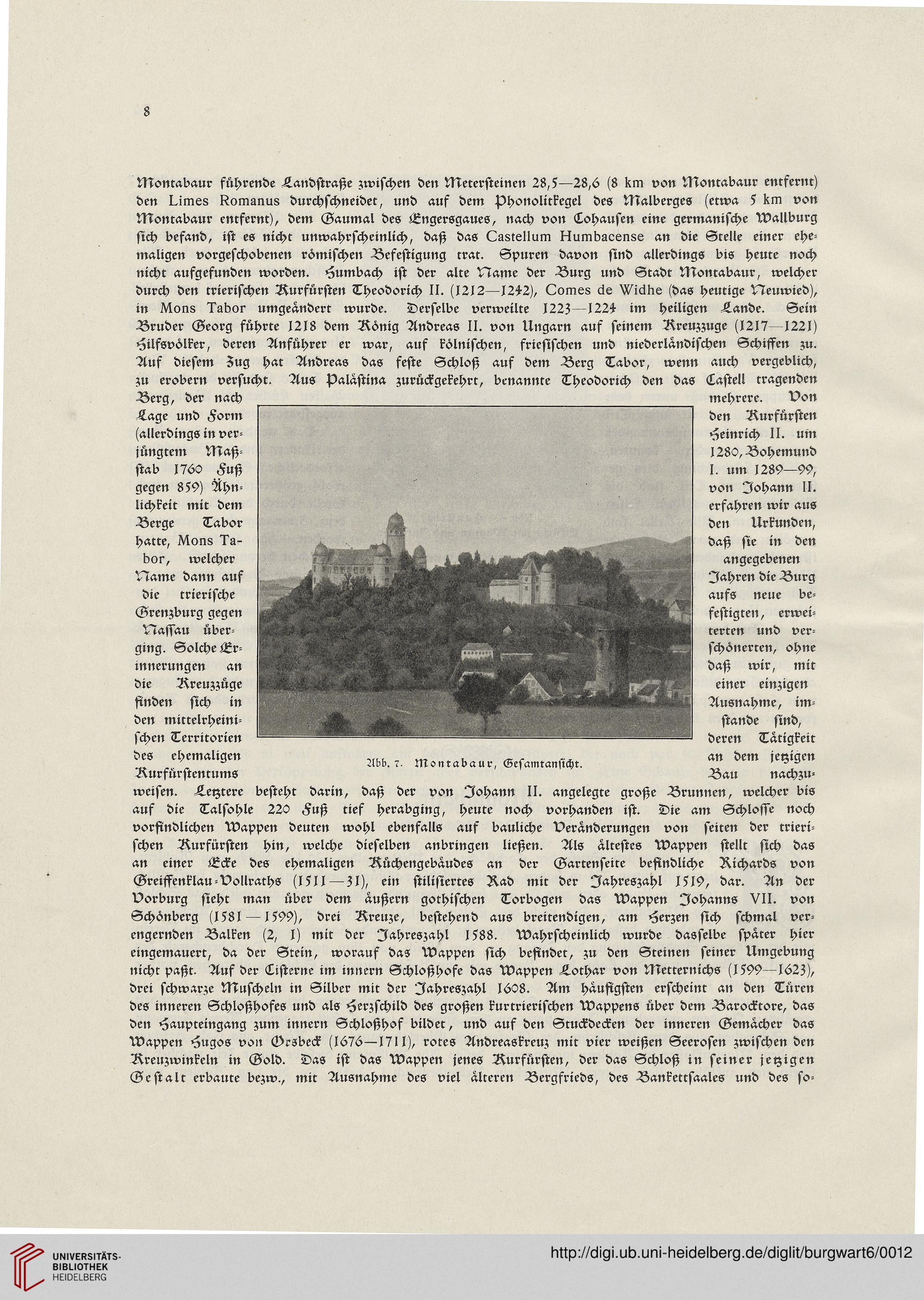8
Momabaur führende Eandstrasie zrvischen den Merersteinen 28,5—28,6 (8 km von 2Nonrabaur encfernc)
den l^im68 kromanu8 durchschneidet, und auf deur phonolickegel des Malberges (erwa 5 Icm von
Monrabaur enrfernr), dem Gaumal des Engersgaues, nach von Lohausen einc germanische wallburg
sich befand, ist es nichr unwahrscheinlich, daß das Lastellum NumbaLense an die Scelle einer ehe-
maligen vorgeschobenen römischen Befestigung crac. Spuren davon sind allerdings bis heuce noch
nichc aufgefunden worden. Humbach ist der alce V7ame der Burg und Scadc Monrabaur, welcher
durch den crierischen Rurfürften Theodorich II. (1212—124-2), Lomes cie V^iclke (das heurige Vleuwied),
in Non8 Tabor umgeanderr wurde. Derselbe verweilce 122Z 1224 im heiligen Eande. Gein
Bruder Georg führte 1218 dem Rönig Andreas II. von Nngarn auf seinem Rreuzzuge (1217 1221)
Hilfsvölker, deren Anführer er war, auf kölnischcn, fricsischen und niederlandischen Schiffen ;u.
Auf diesem Zug hac Andreas das feste Schlosi auf dem Berg Tabor, wenn auch vergeblich,
;u erobern versucht. Aus Palastina zurückgekehrt, benannte Theodorich den das Lastell tragenden
Berg, der nach
Lage und Lorm
(allerdings in ver-
jüngtem Maß-
stab 1760 Lusi
gegen 856) Ähn-
lichkeic mit dem
2Zerge Tabor
hacce, IVlon8 ssa-
bor, welcher
Vlame dann auf
die trierische
Grenzburg gegen
Nassau über-
gmg. GolcheEr-
mnerungen an
die Rreuzzüge
finden sich in
den mittelrheini-
schen Terricoricn
des ehemaligen
Rurfürstenrums
weisen. Leczcerc
auf die Talsohle
mehrcrc. Von
den Rurfürsten
Heinrich II. um
128S, Bohemund
I. um 1286—66,
von Iohann II.
erfahren wir aus
den Urkunden,
daß sie in den
angegebenen
Iahren die Burg
aufs neue be-
festigcen, erwei-
rerten und vcr-
schönercen, ohne
daß wir, mic
einer einzigcn
Ausnahme, im-
stande sind,
deren Tatigkeit
an dem jeyigcn
Bau nachzu-
bestehr darin, daß der von Iohann II. angelegre grosie Brunnen, welcher bis
220 Fuß tief herabging, heute noch vorhanden ist. Die am Schlosse noch
Abb. 7. Monrabaur, Gesamransichr.
vorfindlichen Wappen deuten wohl ebenfalls auf bauliche I6eranderungen von seicen der trieri-
schen Rurfürsten hin, welche dieselben anbringen liesien. Als alrestes wappen stellt sich das
an einer Ecke des ehemaligen Rüchengebaudes an der Garcenseire befindliche Richards von
Greiffenklau-Vollrarhs (1511 — ZI), ein stilisierres Rad mic der Iahreszahl 1516, dar. An dcr
vorburg siehr man über dem ausiern gorhischen Torbogen das Wappen Iohanns VII. von
Schönberg (1581 — 1566), drei Rreuze, beftehcnd aus breitendigen, am Herzen sich schmal ver-
engernden Balken (2, 1) mit der Iahreszahl 1588. Wahrscheinlich wurde dasselbe sparer hier
cingemauert, da der Srein, worauf das wappen sich befinder, zu den Sceinen sciner Umgebung
nichr paßt. Auf der Listerne im innern Schloßhofe das Wappen Lothar von Metternichs (1566—162Z),
drei schwarze Muscheln in Gilber mir der Iahreszahl 1628. Am haufigsten erscheint an den Türen
des inneren Gchloßhofes und als Herzschild des großen kurrrierischen Wappens über dem Barocktore, das
den Haupceingang zuin innern Schloßhof bildet, und auf den Gcuckdecken der inneren Gemacher das
wappen Hugos von Grsbeck (1676—1711), rotes Andreaskreu; mir vier weißen Seerosen zwischen den
Rreuzwinkcln in Gold. Das ist das Wappen jenes Rurfürsten, der das Schlosi in seiner jetzigen
Gcstalt erbauce bezw., mir ?Iusnahme dcs viel alceren Bergfrieds, dcs Bankettsaales und des so-
Momabaur führende Eandstrasie zrvischen den Merersteinen 28,5—28,6 (8 km von 2Nonrabaur encfernc)
den l^im68 kromanu8 durchschneidet, und auf deur phonolickegel des Malberges (erwa 5 Icm von
Monrabaur enrfernr), dem Gaumal des Engersgaues, nach von Lohausen einc germanische wallburg
sich befand, ist es nichr unwahrscheinlich, daß das Lastellum NumbaLense an die Scelle einer ehe-
maligen vorgeschobenen römischen Befestigung crac. Spuren davon sind allerdings bis heuce noch
nichc aufgefunden worden. Humbach ist der alce V7ame der Burg und Scadc Monrabaur, welcher
durch den crierischen Rurfürften Theodorich II. (1212—124-2), Lomes cie V^iclke (das heurige Vleuwied),
in Non8 Tabor umgeanderr wurde. Derselbe verweilce 122Z 1224 im heiligen Eande. Gein
Bruder Georg führte 1218 dem Rönig Andreas II. von Nngarn auf seinem Rreuzzuge (1217 1221)
Hilfsvölker, deren Anführer er war, auf kölnischcn, fricsischen und niederlandischen Schiffen ;u.
Auf diesem Zug hac Andreas das feste Schlosi auf dem Berg Tabor, wenn auch vergeblich,
;u erobern versucht. Aus Palastina zurückgekehrt, benannte Theodorich den das Lastell tragenden
Berg, der nach
Lage und Lorm
(allerdings in ver-
jüngtem Maß-
stab 1760 Lusi
gegen 856) Ähn-
lichkeic mit dem
2Zerge Tabor
hacce, IVlon8 ssa-
bor, welcher
Vlame dann auf
die trierische
Grenzburg gegen
Nassau über-
gmg. GolcheEr-
mnerungen an
die Rreuzzüge
finden sich in
den mittelrheini-
schen Terricoricn
des ehemaligen
Rurfürstenrums
weisen. Leczcerc
auf die Talsohle
mehrcrc. Von
den Rurfürsten
Heinrich II. um
128S, Bohemund
I. um 1286—66,
von Iohann II.
erfahren wir aus
den Urkunden,
daß sie in den
angegebenen
Iahren die Burg
aufs neue be-
festigcen, erwei-
rerten und vcr-
schönercen, ohne
daß wir, mic
einer einzigcn
Ausnahme, im-
stande sind,
deren Tatigkeit
an dem jeyigcn
Bau nachzu-
bestehr darin, daß der von Iohann II. angelegre grosie Brunnen, welcher bis
220 Fuß tief herabging, heute noch vorhanden ist. Die am Schlosse noch
Abb. 7. Monrabaur, Gesamransichr.
vorfindlichen Wappen deuten wohl ebenfalls auf bauliche I6eranderungen von seicen der trieri-
schen Rurfürsten hin, welche dieselben anbringen liesien. Als alrestes wappen stellt sich das
an einer Ecke des ehemaligen Rüchengebaudes an der Garcenseire befindliche Richards von
Greiffenklau-Vollrarhs (1511 — ZI), ein stilisierres Rad mic der Iahreszahl 1516, dar. An dcr
vorburg siehr man über dem ausiern gorhischen Torbogen das Wappen Iohanns VII. von
Schönberg (1581 — 1566), drei Rreuze, beftehcnd aus breitendigen, am Herzen sich schmal ver-
engernden Balken (2, 1) mit der Iahreszahl 1588. Wahrscheinlich wurde dasselbe sparer hier
cingemauert, da der Srein, worauf das wappen sich befinder, zu den Sceinen sciner Umgebung
nichr paßt. Auf der Listerne im innern Schloßhofe das Wappen Lothar von Metternichs (1566—162Z),
drei schwarze Muscheln in Gilber mir der Iahreszahl 1628. Am haufigsten erscheint an den Türen
des inneren Gchloßhofes und als Herzschild des großen kurrrierischen Wappens über dem Barocktore, das
den Haupceingang zuin innern Schloßhof bildet, und auf den Gcuckdecken der inneren Gemacher das
wappen Hugos von Grsbeck (1676—1711), rotes Andreaskreu; mir vier weißen Seerosen zwischen den
Rreuzwinkcln in Gold. Das ist das Wappen jenes Rurfürsten, der das Schlosi in seiner jetzigen
Gcstalt erbauce bezw., mir ?Iusnahme dcs viel alceren Bergfrieds, dcs Bankettsaales und des so-