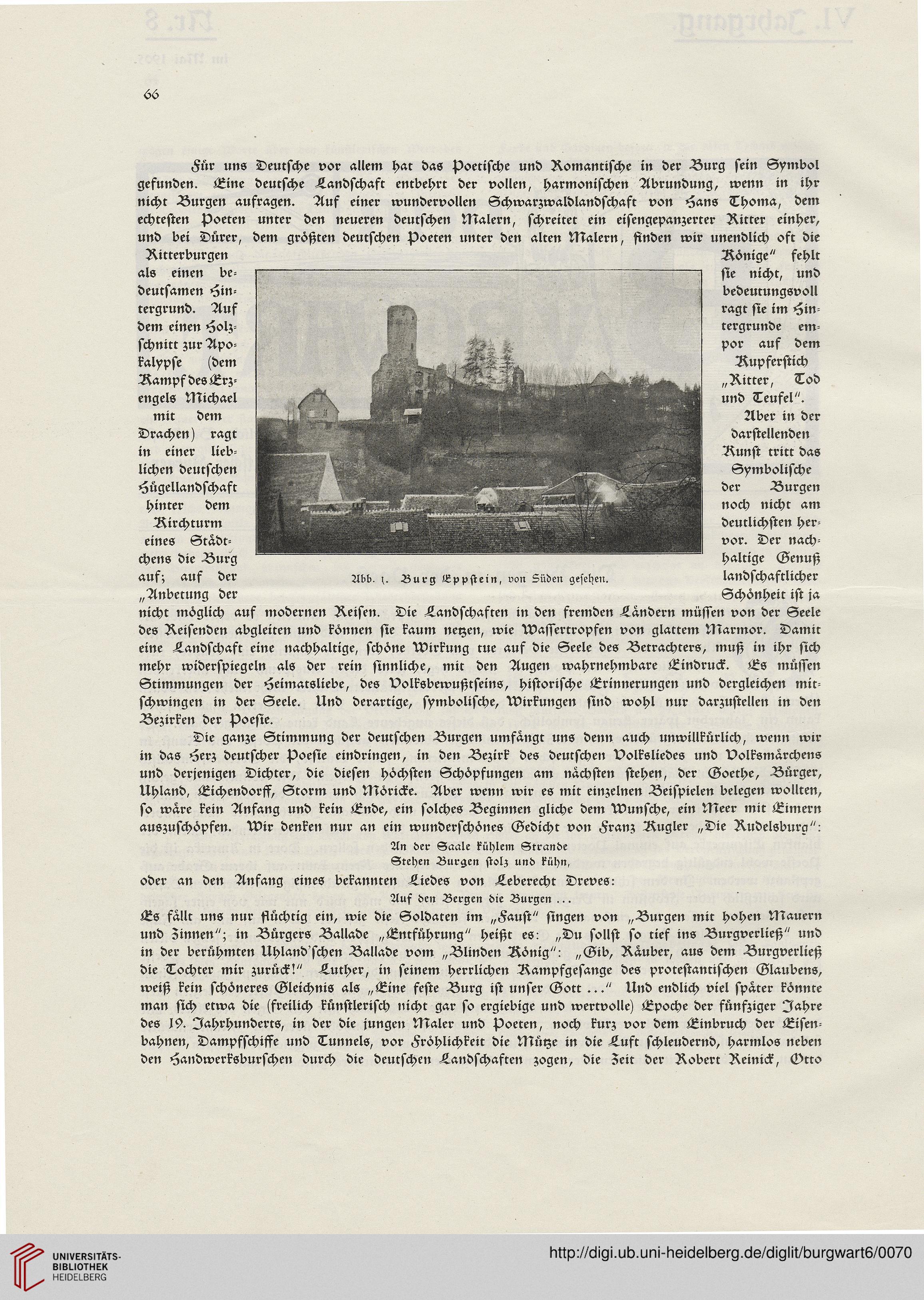Für uns Deursche vor aliem har das Poerische und Romantische in der Burg sein Symbol
gefunden. Eine deutsche Landschaft enrbehrr der vollen, harmonischen Abrundung, wenn in ihr
nicht Burgen aufragen. Auf einer wundervollen Schwarzwaldlandschafc von Hans Thoma, dem
echcesten poeten unrer den neueren deutschen Nralern, schreicet ein eisengepanzerrer Ricrer einher,
und bei Dürer, dem größten deurschen Poeren uncer den alten Malern, finden wir unendlich oft die
Rönige" fefilt
sie nicht, und
bedeucungsvoll
ragt sie iin Hin
tergrunde em-
por auf dem
Rupferslich
„Rirrer, Tod
! und Teufel".
2lber in der
darstcllenden
Runst critt das
Symbolische
der Burgen
noch nichc am
deurlichften her-
vor. Der nach-
haltige Genuß
landschafrlicher
Gchönheic ist ja
nicht möglich auf moderncn Reisen. Die -Landschafren in den fremden Eandern müssen von der Seele
des Reisenden abgleiren und können sie kaum nctzcn, wie Wasserrropfen von glarrem Niarmor. Damir
eine Landschafc eine nachhaltige, schöne Wirkung cue auf die Seele des Berrachters, muß in ihr sich
mel>r widerspiegeln als der rein sinnliche, mic den Augen wahrnebmbare Eindruck. Es müssen
Stimmungen der Heimacsliebe, des volksbewußtseins, historische Erinnerungen und dergleichen mic-
schwingen in der Geele. Nnd derartige, symbolische, Wirkungen sind wohl nur darzustellen in den
Bezirken der poesie.
Die ganze Stimmung der demschen Äurgcn umfangc uns denn auch unwillkürlich, wenn wir
in das Her; dcutscher poesie eindringen, in den Bezirk des deucschen volksliedcs und volksmarchens
und derjenigen Dichter, die diesen höchsten Gchöpfungen am nachsten ftehen, der Goerhe, Bürger,
Uhland, Eichendorff, Scorm und Möricke. Aber wenn wir es mir einzelnen Beispielen belegen wollren,
so ware kein Anfang und kein Ende, ein solches Beginnen gliche dem wunsche, ein Meer mir Eimern
auszuschöpfen. Wir denken nur an ein wunderschönes Gedicht von Franz Rugler „Die Rudelsburg":
An der Saale kühlem Strande
Stehcn Lurgen stol; und kühn,
oder an den Anfang eines bekannren Liedes von Leberechr Dreves:
Auf dcn Bergen dic Burgen ...
Es fallc uns nur flüchtig eitt, wie die Soldaten im „Laust" singen von „Burgen mit hohen kUauern
und Zinnen"; in Bürgers Ballade „Enrfüßrung" heißr es: „Du sollst so rief ins Burgverließ" und
in der bcrrchmten Uhland'schen Ballade vom „Blinden Rönig": „Gib, Rauber, aus dem Burgverließ
die Tochcer mir zurück!" Euther, in seinem ßerrlichcn Rampfgesange des protestanrischen Glaubens,
weiß kein schöneres Gleichnis als „ELne feste Burg ist unser Gott ..." Und endlich viel spater könnre
man sich etwa die (freilich künstlerisch nichr gar so ergiebige und wertvolle) Epoche der fünfziger Iaßre
des 19. Iahichundcrts, in der die jungen Malcr und poecen, noch kur; vor dem Einbruch der Eisen-
bahnen, Dampfschiffe und Tunnels, vor Lröhlichkeit die Uiütze in die Luft schleudernd, harmlos neben
den Handwerksburschen durch die deutschen Landschafcen zogen, die Zeit der Robert Reinick, Vcco
Rittcrburgen
als einen be-
deutsamen Hin-
rergrund. Auf
dem einen Hol;
schnirr zur Apo-
kalypse sdem
RampfdesErz-
engels U7ichael
mir dem
Drachen) ragr
in einer lieb-
lichen deucschen
Hügellandschafc
hincer dem
Rirchrurm
eines Gtadt-
chens die Burg
auf; auf der
„Anbecung der
Abb. ;. BurgEppstein, von Süden gesehen.
gefunden. Eine deutsche Landschaft enrbehrr der vollen, harmonischen Abrundung, wenn in ihr
nicht Burgen aufragen. Auf einer wundervollen Schwarzwaldlandschafc von Hans Thoma, dem
echcesten poeten unrer den neueren deutschen Nralern, schreicet ein eisengepanzerrer Ricrer einher,
und bei Dürer, dem größten deurschen Poeren uncer den alten Malern, finden wir unendlich oft die
Rönige" fefilt
sie nicht, und
bedeucungsvoll
ragt sie iin Hin
tergrunde em-
por auf dem
Rupferslich
„Rirrer, Tod
! und Teufel".
2lber in der
darstcllenden
Runst critt das
Symbolische
der Burgen
noch nichc am
deurlichften her-
vor. Der nach-
haltige Genuß
landschafrlicher
Gchönheic ist ja
nicht möglich auf moderncn Reisen. Die -Landschafren in den fremden Eandern müssen von der Seele
des Reisenden abgleiren und können sie kaum nctzcn, wie Wasserrropfen von glarrem Niarmor. Damir
eine Landschafc eine nachhaltige, schöne Wirkung cue auf die Seele des Berrachters, muß in ihr sich
mel>r widerspiegeln als der rein sinnliche, mic den Augen wahrnebmbare Eindruck. Es müssen
Stimmungen der Heimacsliebe, des volksbewußtseins, historische Erinnerungen und dergleichen mic-
schwingen in der Geele. Nnd derartige, symbolische, Wirkungen sind wohl nur darzustellen in den
Bezirken der poesie.
Die ganze Stimmung der demschen Äurgcn umfangc uns denn auch unwillkürlich, wenn wir
in das Her; dcutscher poesie eindringen, in den Bezirk des deucschen volksliedcs und volksmarchens
und derjenigen Dichter, die diesen höchsten Gchöpfungen am nachsten ftehen, der Goerhe, Bürger,
Uhland, Eichendorff, Scorm und Möricke. Aber wenn wir es mir einzelnen Beispielen belegen wollren,
so ware kein Anfang und kein Ende, ein solches Beginnen gliche dem wunsche, ein Meer mir Eimern
auszuschöpfen. Wir denken nur an ein wunderschönes Gedicht von Franz Rugler „Die Rudelsburg":
An der Saale kühlem Strande
Stehcn Lurgen stol; und kühn,
oder an den Anfang eines bekannren Liedes von Leberechr Dreves:
Auf dcn Bergen dic Burgen ...
Es fallc uns nur flüchtig eitt, wie die Soldaten im „Laust" singen von „Burgen mit hohen kUauern
und Zinnen"; in Bürgers Ballade „Enrfüßrung" heißr es: „Du sollst so rief ins Burgverließ" und
in der bcrrchmten Uhland'schen Ballade vom „Blinden Rönig": „Gib, Rauber, aus dem Burgverließ
die Tochcer mir zurück!" Euther, in seinem ßerrlichcn Rampfgesange des protestanrischen Glaubens,
weiß kein schöneres Gleichnis als „ELne feste Burg ist unser Gott ..." Und endlich viel spater könnre
man sich etwa die (freilich künstlerisch nichr gar so ergiebige und wertvolle) Epoche der fünfziger Iaßre
des 19. Iahichundcrts, in der die jungen Malcr und poecen, noch kur; vor dem Einbruch der Eisen-
bahnen, Dampfschiffe und Tunnels, vor Lröhlichkeit die Uiütze in die Luft schleudernd, harmlos neben
den Handwerksburschen durch die deutschen Landschafcen zogen, die Zeit der Robert Reinick, Vcco
Rittcrburgen
als einen be-
deutsamen Hin-
rergrund. Auf
dem einen Hol;
schnirr zur Apo-
kalypse sdem
RampfdesErz-
engels U7ichael
mir dem
Drachen) ragr
in einer lieb-
lichen deucschen
Hügellandschafc
hincer dem
Rirchrurm
eines Gtadt-
chens die Burg
auf; auf der
„Anbecung der
Abb. ;. BurgEppstein, von Süden gesehen.