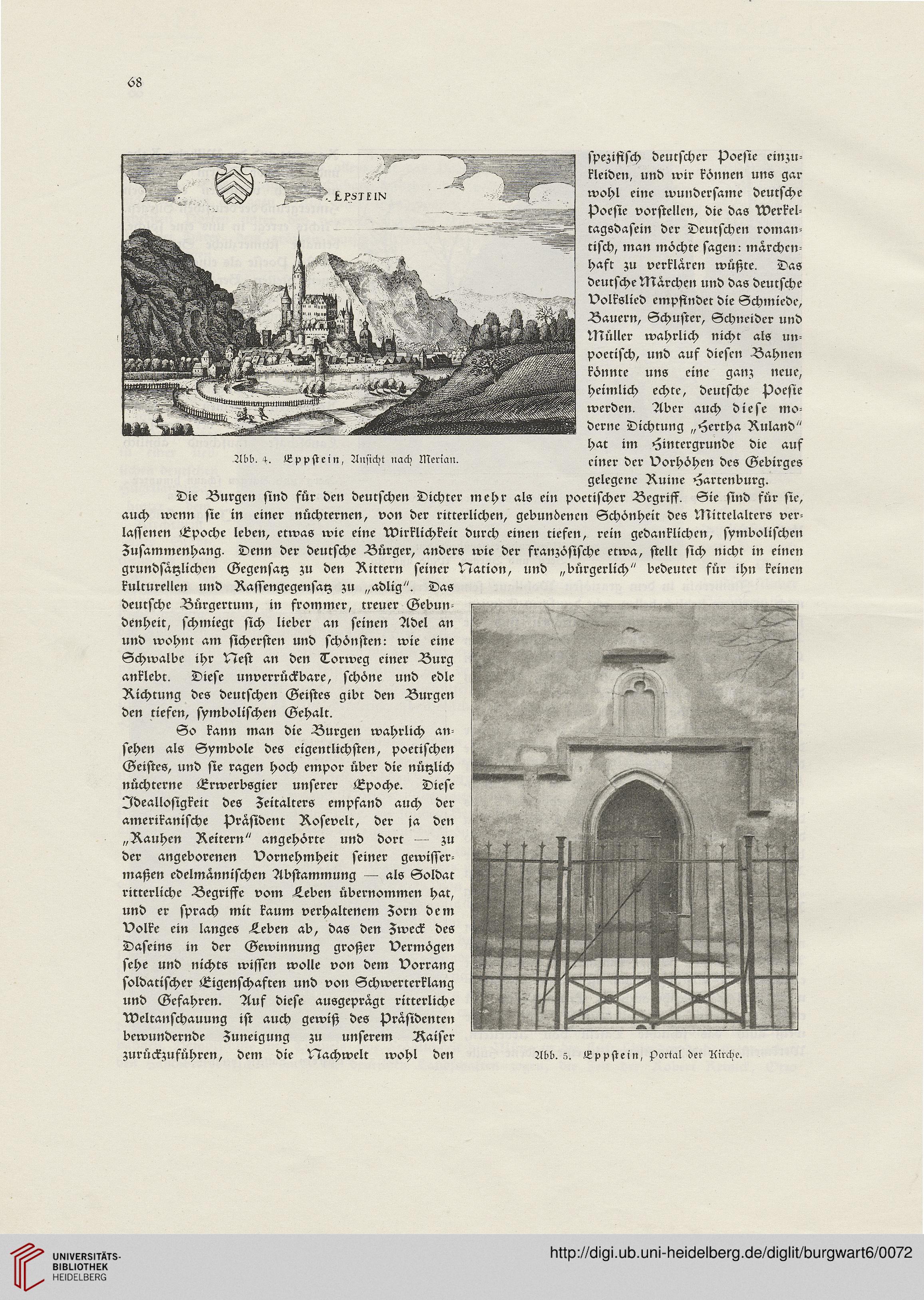68
spezifisch deucscher Poefte cinzu-
kleideu, und wir können uns gar
wofil eine wundcrsaine deutsche
Poesie vorsteUen, die das werkel-
ragsdasein dcr Deutscben roman-
tisch, man inöchte sagen: inarchcn-
haft ;u vcrklaren wüßte. Das
deucsche Marchen und das deutsche
Dolkslied empfindec die Schniicde,
Baucrn, Schuster, Schneider und
Muller wahrlich nicht als un-
poccisch, und auf diescn Bahnen
könnce uns cine gan; neue,
heiinlich echte, deutsche Poesie
wcrden. Aber auch diese ino-
dcrne Dichcung „Hertha Xnland"
hac iin Hintergrunde die auf
ciner der Vorhöhen dcs Gebirges
gelegenc Ruine Harrenburg.
Die Äurgen sind für den deutschen Dichter inehr als ein poetischer Begriff. Sie sind für sic,
auch wenn sie in einer nüchternen, von der ritrerlichen, gebundencn Gchönheit des Miccelalters ver-
laffenen Epoche leben, etwas wie eine Wirklichkeit durch einen tiefen, rein gedanklichcn, synibolischen
susaininenhang. Denn der deutsche Bürger, anders wie der französische etwa, stellt sich nicht in eincn
grundsatzlichen Gegensatz zu den Rittern seincr Nation, und „bürgerlich" bedeutec für ihn keinen
kulcurellcn und Rassengegensatz zu „adlig". Das
deursche Bürgertum, in froininer, rreuer Gebun-
denheir, schiniegt sich lieber an seinen Adel an
und wohnc am sicherstcn und schönsten: wie eine
Schwalbe ihr Neft an den Torweg einer Burg
anklebt. Diese unverrückbare, schöne und edle
Richrung dcs deucschen Geistcs gibt den Burgcn
den tiefcn, symbolischen Gehalt.
Go kann inan die Burgen wahrlich an-
sehen als Gyinbole des eigentlichstcn, poerischen
Geistcs, und sie ragen hoch einpor über die nützlich
nüchterne Erwerbsgier unserer Epoche. Diese
Ideallosigkeic des Zeiraltcrs empfand auch der
amerikanische Prasidenc Rosevelt, der ja den
„Rauhcn Reitern" angehörte und dort ;u
der angeborenen vornehmheit seiner gewisser-
maßen edelmaniiischen ?ibslammung — als Goldac
ritterliche Begriffe vom Leben übernommen hat,
und er sprach mit kaum verhaltenem Zorn dem
volke ein langes Leben ab, das den Zweck des
Daseins in der Gewinnung großer vermögen
sehe und nichcs wissen wolle von dem Vorrang
soldatischer Eigenschafren und von Schwertcrklang
und Gefahren. Auf diese ausgepragt ritterliche
Welcanschauung ist auch gewiß des prasidenten
bewundernde Zuneigung ;u unserem Raiser
;urück;uführen, dem die »Zachwclc wohl den
Abb. -i. Eppstein, Ansicht nach Nerian.
Abb. s. Eppstein, portal der Airche.
spezifisch deucscher Poefte cinzu-
kleideu, und wir können uns gar
wofil eine wundcrsaine deutsche
Poesie vorsteUen, die das werkel-
ragsdasein dcr Deutscben roman-
tisch, man inöchte sagen: inarchcn-
haft ;u vcrklaren wüßte. Das
deucsche Marchen und das deutsche
Dolkslied empfindec die Schniicde,
Baucrn, Schuster, Schneider und
Muller wahrlich nicht als un-
poccisch, und auf diescn Bahnen
könnce uns cine gan; neue,
heiinlich echte, deutsche Poesie
wcrden. Aber auch diese ino-
dcrne Dichcung „Hertha Xnland"
hac iin Hintergrunde die auf
ciner der Vorhöhen dcs Gebirges
gelegenc Ruine Harrenburg.
Die Äurgen sind für den deutschen Dichter inehr als ein poetischer Begriff. Sie sind für sic,
auch wenn sie in einer nüchternen, von der ritrerlichen, gebundencn Gchönheit des Miccelalters ver-
laffenen Epoche leben, etwas wie eine Wirklichkeit durch einen tiefen, rein gedanklichcn, synibolischen
susaininenhang. Denn der deutsche Bürger, anders wie der französische etwa, stellt sich nicht in eincn
grundsatzlichen Gegensatz zu den Rittern seincr Nation, und „bürgerlich" bedeutec für ihn keinen
kulcurellcn und Rassengegensatz zu „adlig". Das
deursche Bürgertum, in froininer, rreuer Gebun-
denheir, schiniegt sich lieber an seinen Adel an
und wohnc am sicherstcn und schönsten: wie eine
Schwalbe ihr Neft an den Torweg einer Burg
anklebt. Diese unverrückbare, schöne und edle
Richrung dcs deucschen Geistcs gibt den Burgcn
den tiefcn, symbolischen Gehalt.
Go kann inan die Burgen wahrlich an-
sehen als Gyinbole des eigentlichstcn, poerischen
Geistcs, und sie ragen hoch einpor über die nützlich
nüchterne Erwerbsgier unserer Epoche. Diese
Ideallosigkeic des Zeiraltcrs empfand auch der
amerikanische Prasidenc Rosevelt, der ja den
„Rauhcn Reitern" angehörte und dort ;u
der angeborenen vornehmheit seiner gewisser-
maßen edelmaniiischen ?ibslammung — als Goldac
ritterliche Begriffe vom Leben übernommen hat,
und er sprach mit kaum verhaltenem Zorn dem
volke ein langes Leben ab, das den Zweck des
Daseins in der Gewinnung großer vermögen
sehe und nichcs wissen wolle von dem Vorrang
soldatischer Eigenschafren und von Schwertcrklang
und Gefahren. Auf diese ausgepragt ritterliche
Welcanschauung ist auch gewiß des prasidenten
bewundernde Zuneigung ;u unserem Raiser
;urück;uführen, dem die »Zachwclc wohl den
Abb. -i. Eppstein, Ansicht nach Nerian.
Abb. s. Eppstein, portal der Airche.