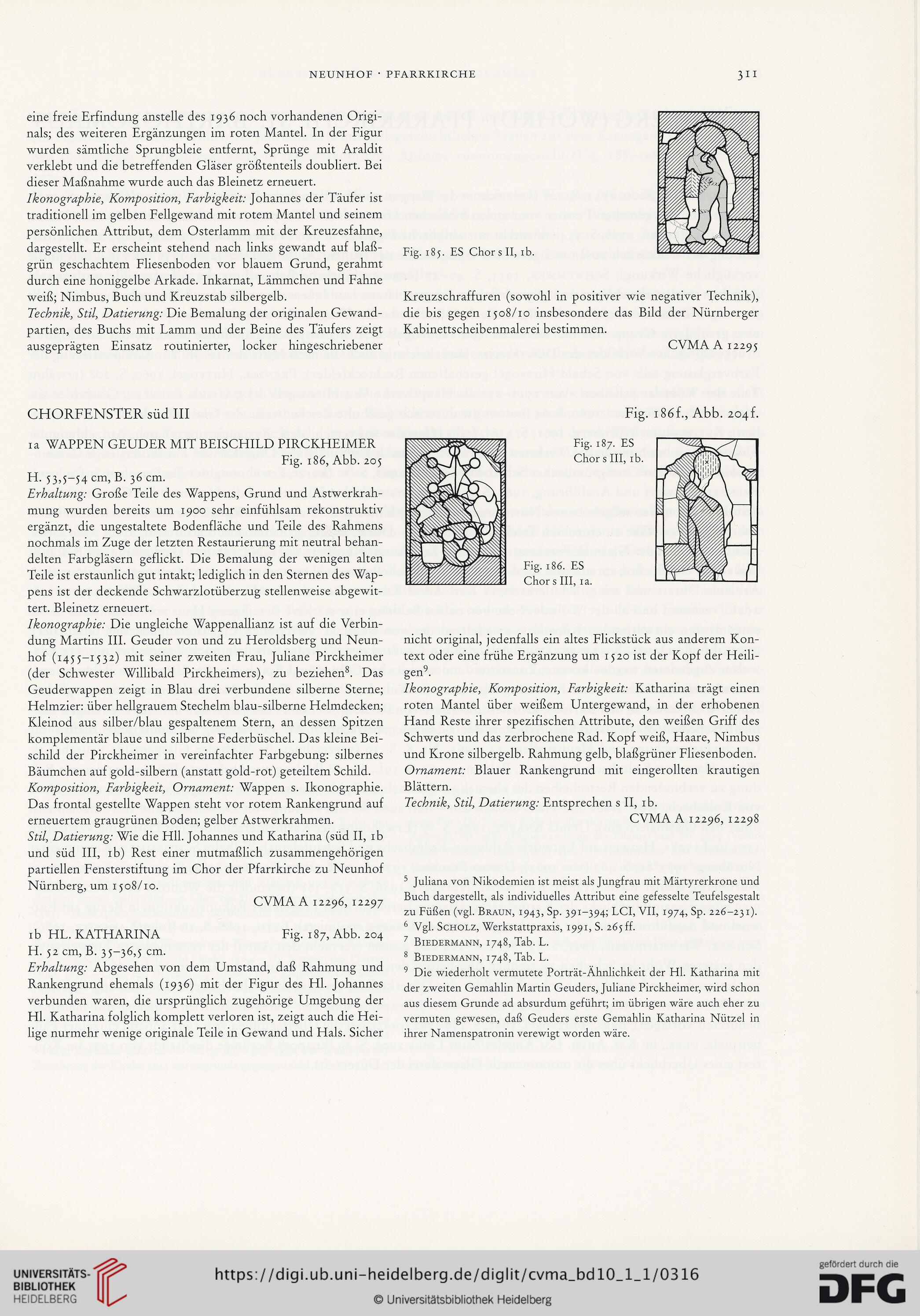NEUNHOF • PFARRKIRCHE
311
eine freie Erfindung anstelle des 1936 noch vorhandenen Origi-
nals; des weiteren Ergänzungen im roten Mantel. In der Figur
wurden sämtliche Sprungbleie entfernt, Sprünge mit Araldit
verklebt und die betreffenden Gläser größtenteils doubliert. Bei
dieser Maßnahme wurde auch das Bleinetz erneuert.
Ikonographie, Komposition, Farbigkeit: Johannes der Täufer ist
traditionell im gelben Fellgewand mit rotem Mantel und seinem
persönlichen Attribut, dem Osterlamm mit der Kreuzesfahne,
dargestellt. Er erscheint stehend nach links gewandt auf blaß-
grün geschachtem Fliesenboden vor blauem Grund, gerahmt
durch eine honiggelbe Arkade. Inkarnat, Lämmchen und Fahne
weiß; Nimbus, Buch und Kreuzstab silbergelb.
Technik, Stil, Datierung: Die Bemalung der originalen Gewand-
partien, des Buchs mit Lamm und der Beine des Täufers zeigt
ausgeprägten Einsatz routinierter, locker Eingeschriebener
Fig. 185. ES Chors II, ib.
Kreuzschraffuren (sowohl in positiver wie negativer Technik),
die bis gegen 1508/10 insbesondere das Bild der Nürnberger
Kabinettscheibenmalerei bestimmen.
CVMAA 12295
CHORFENSTER süd III
Fig. i86f., Abb. 204E
ia WAPPEN GEUDER MIT BEISCHILD PIRCKHEIMER
Fig. 186, Abb. 205
H. 53,5-54 cm, B. 36 cm.
Erhaltung: Große Teile des Wappens, Grund und Astwerkrah-
mung wurden bereits um 1900 sehr einfühlsam rekonstruktiv
ergänzt, die ungestaltete Bodenfläche und Teile des Rahmens
nochmals im Zuge der letzten Restaurierung mit neutral behan-
delten Farbgläsern geflickt. Die Bemalung der wenigen alten
Teile ist erstaunlich gut intakt; lediglich in den Sternen des Wap-
pens ist der deckende Schwarzlotüberzug stellenweise abgewit-
tert. Bleinetz erneuert.
Ikonographie: Die ungleiche Wappenallianz ist auf die Verbin-
dung Martins III. Geuder von und zu Heroldsberg und Neun-
hof (1455-1532) mit seiner zweiten Frau, Juliane Pirckheimer
(der Schwester Willibald Pirckheimers), zu beziehen8. Das
Geuderwappen zeigt in Blau drei verbundene silberne Sterne;
Helmzier: über hellgrauem Stechelm blau-silberne Helmdecken;
Kleinod aus silber/blau gespaltenem Stern, an dessen Spitzen
komplementär blaue und silberne Federbüschel. Das kleine Bei-
schild der Pirckheimer in vereinfachter Farbgebung: silbernes
Bäumchen auf gold-silbern (anstatt gold-rot) geteiltem Schild.
Komposition, Farbigkeit, Ornament: Wappen s. Ikonographie.
Das frontal gestellte Wappen steht vor rotem Rankengrund auf
erneuertem graugrünen Boden; gelber Astwerkrahmen.
Stil, Datierung: Wie die Hll. Johannes und Katharina (süd II, ib
und süd III, ib) Rest einer mutmaßlich zusammengehörigen
partiellen Fensterstiftung im Chor der Pfarrkirche zu Neunhof
Nürnberg, um 1508/10.
CVMAA 12296, 12297
ib HL. KATHARINA Fig. 187, Abb. 204
H. 52 cm, B. 35-36,5 cm.
Erhaltung: Abgesehen von dem Umstand, daß Rahmung und
Rankengrund ehemals (1936) mit der Figur des Hl. Johannes
verbunden waren, die ursprünglich zugehörige Umgebung der
Hl. Katharina folglich komplett verloren ist, zeigt auch die Hei-
lige nurmehr wenige originale Teile in Gewand und Hals. Sicher
Fig. 187. ES
Chor s III, ib.
Fig. 186. ES
Chor s III, ia.
nicht original, jedenfalls ein altes Flickstück aus anderem Kon-
text oder eine frühe Ergänzung um 1520 ist der Kopf der Heili-
9
genL
Ikonographie, Komposition, Farbigkeit: Katharina trägt einen
roten Mantel über weißem Untergewand, in der erhobenen
Hand Reste ihrer spezifischen Attribute, den weißen Griff des
Schwerts und das zerbrochene Rad. Kopf weiß, Haare, Nimbus
und Krone silbergelb. Rahmung gelb, blaßgrüner Fliesenboden.
Ornament: Blauer Rankengrund mit eingerollten krautigen
Blättern.
Technik, Stil, Datierung: Entsprechen s II, ib.
CVMAA 12296, 12298
5 Juliana von Nikodemien ist meist als Jungfrau mit Märtyrerkrone und
Buch dargestellt, als individuelles Attribut eine gefesselte Teufelsgestalt
zu Füßen (vgl. Braun, 1943, Sp. 391-394; LCI, VII, 1974, Sp. 226-231).
6 Vgl. Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 265 ff.
7 Biedermann, 1748, Tab. L.
8 Biedermann, 1748, Tab. L.
9 Die wiederholt vermutete Porträt-Ähnlichkeit der Hl. Katharina mit
der zweiten Gemahlin Martin Geuders, Juliane Pirckheimer, wird schon
aus diesem Grunde ad absurdum geführt; im übrigen wäre auch eher zu
vermuten gewesen, daß Geuders erste Gemahlin Katharina Nützel in
ihrer Namenspatronin verewigt worden wäre.
311
eine freie Erfindung anstelle des 1936 noch vorhandenen Origi-
nals; des weiteren Ergänzungen im roten Mantel. In der Figur
wurden sämtliche Sprungbleie entfernt, Sprünge mit Araldit
verklebt und die betreffenden Gläser größtenteils doubliert. Bei
dieser Maßnahme wurde auch das Bleinetz erneuert.
Ikonographie, Komposition, Farbigkeit: Johannes der Täufer ist
traditionell im gelben Fellgewand mit rotem Mantel und seinem
persönlichen Attribut, dem Osterlamm mit der Kreuzesfahne,
dargestellt. Er erscheint stehend nach links gewandt auf blaß-
grün geschachtem Fliesenboden vor blauem Grund, gerahmt
durch eine honiggelbe Arkade. Inkarnat, Lämmchen und Fahne
weiß; Nimbus, Buch und Kreuzstab silbergelb.
Technik, Stil, Datierung: Die Bemalung der originalen Gewand-
partien, des Buchs mit Lamm und der Beine des Täufers zeigt
ausgeprägten Einsatz routinierter, locker Eingeschriebener
Fig. 185. ES Chors II, ib.
Kreuzschraffuren (sowohl in positiver wie negativer Technik),
die bis gegen 1508/10 insbesondere das Bild der Nürnberger
Kabinettscheibenmalerei bestimmen.
CVMAA 12295
CHORFENSTER süd III
Fig. i86f., Abb. 204E
ia WAPPEN GEUDER MIT BEISCHILD PIRCKHEIMER
Fig. 186, Abb. 205
H. 53,5-54 cm, B. 36 cm.
Erhaltung: Große Teile des Wappens, Grund und Astwerkrah-
mung wurden bereits um 1900 sehr einfühlsam rekonstruktiv
ergänzt, die ungestaltete Bodenfläche und Teile des Rahmens
nochmals im Zuge der letzten Restaurierung mit neutral behan-
delten Farbgläsern geflickt. Die Bemalung der wenigen alten
Teile ist erstaunlich gut intakt; lediglich in den Sternen des Wap-
pens ist der deckende Schwarzlotüberzug stellenweise abgewit-
tert. Bleinetz erneuert.
Ikonographie: Die ungleiche Wappenallianz ist auf die Verbin-
dung Martins III. Geuder von und zu Heroldsberg und Neun-
hof (1455-1532) mit seiner zweiten Frau, Juliane Pirckheimer
(der Schwester Willibald Pirckheimers), zu beziehen8. Das
Geuderwappen zeigt in Blau drei verbundene silberne Sterne;
Helmzier: über hellgrauem Stechelm blau-silberne Helmdecken;
Kleinod aus silber/blau gespaltenem Stern, an dessen Spitzen
komplementär blaue und silberne Federbüschel. Das kleine Bei-
schild der Pirckheimer in vereinfachter Farbgebung: silbernes
Bäumchen auf gold-silbern (anstatt gold-rot) geteiltem Schild.
Komposition, Farbigkeit, Ornament: Wappen s. Ikonographie.
Das frontal gestellte Wappen steht vor rotem Rankengrund auf
erneuertem graugrünen Boden; gelber Astwerkrahmen.
Stil, Datierung: Wie die Hll. Johannes und Katharina (süd II, ib
und süd III, ib) Rest einer mutmaßlich zusammengehörigen
partiellen Fensterstiftung im Chor der Pfarrkirche zu Neunhof
Nürnberg, um 1508/10.
CVMAA 12296, 12297
ib HL. KATHARINA Fig. 187, Abb. 204
H. 52 cm, B. 35-36,5 cm.
Erhaltung: Abgesehen von dem Umstand, daß Rahmung und
Rankengrund ehemals (1936) mit der Figur des Hl. Johannes
verbunden waren, die ursprünglich zugehörige Umgebung der
Hl. Katharina folglich komplett verloren ist, zeigt auch die Hei-
lige nurmehr wenige originale Teile in Gewand und Hals. Sicher
Fig. 187. ES
Chor s III, ib.
Fig. 186. ES
Chor s III, ia.
nicht original, jedenfalls ein altes Flickstück aus anderem Kon-
text oder eine frühe Ergänzung um 1520 ist der Kopf der Heili-
9
genL
Ikonographie, Komposition, Farbigkeit: Katharina trägt einen
roten Mantel über weißem Untergewand, in der erhobenen
Hand Reste ihrer spezifischen Attribute, den weißen Griff des
Schwerts und das zerbrochene Rad. Kopf weiß, Haare, Nimbus
und Krone silbergelb. Rahmung gelb, blaßgrüner Fliesenboden.
Ornament: Blauer Rankengrund mit eingerollten krautigen
Blättern.
Technik, Stil, Datierung: Entsprechen s II, ib.
CVMAA 12296, 12298
5 Juliana von Nikodemien ist meist als Jungfrau mit Märtyrerkrone und
Buch dargestellt, als individuelles Attribut eine gefesselte Teufelsgestalt
zu Füßen (vgl. Braun, 1943, Sp. 391-394; LCI, VII, 1974, Sp. 226-231).
6 Vgl. Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 265 ff.
7 Biedermann, 1748, Tab. L.
8 Biedermann, 1748, Tab. L.
9 Die wiederholt vermutete Porträt-Ähnlichkeit der Hl. Katharina mit
der zweiten Gemahlin Martin Geuders, Juliane Pirckheimer, wird schon
aus diesem Grunde ad absurdum geführt; im übrigen wäre auch eher zu
vermuten gewesen, daß Geuders erste Gemahlin Katharina Nützel in
ihrer Namenspatronin verewigt worden wäre.