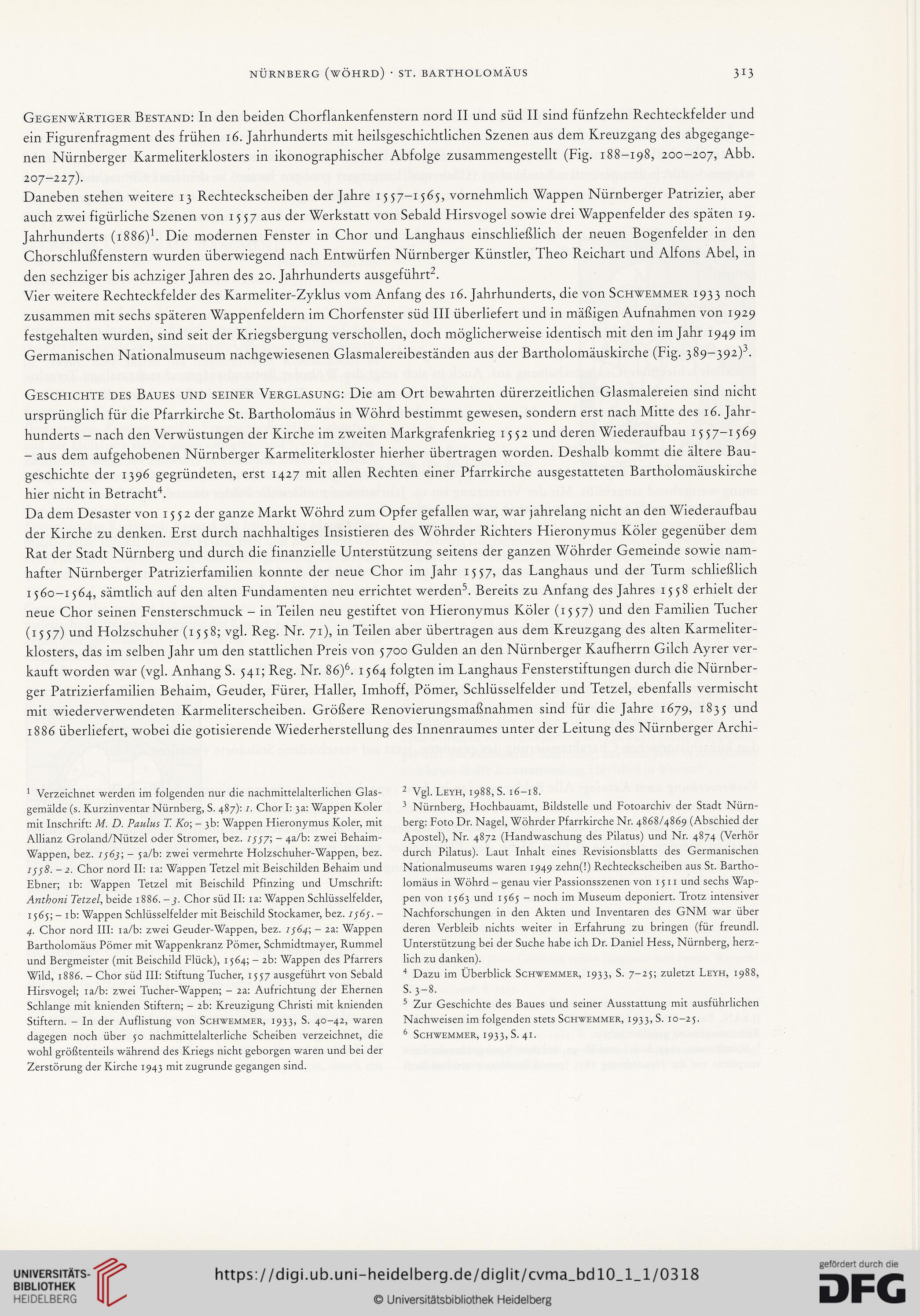NÜRNBERG (wÖHRO) • ST. BARTHOLOMÄUS
Gegenwärtiger Bestand: In den beiden Chorflankenfenstern nord II und süd II sind fünfzehn Rechteckfelder und
ein Figurenfragment des frühen 16. Jahrhunderts mit heilsgeschichtlichen Szenen aus dem Kreuzgang des abgegange-
nen Nürnberger Karmeliterklosters in ikonographischer Abfolge zusammengestellt (Fig. 188-198, 200-207, Abb.
207-227).
Daneben stehen weitere 13 Rechteckscheiben der Jahre 1557—1565, vornehmlich Wappen Nürnberger Patrizier, aber
auch zwei figürliche Szenen von 1557 aus der Werkstatt von Sebald Hirsvogel sowie drei Wappenfelder des späten 19.
Jahrhunderts (1886)1. Die modernen Fenster in Chor und Langhaus einschließlich der neuen Bogenfelder in den
Chorschlußfenstern wurden überwiegend nach Entwürfen Nürnberger Künstler, Theo Reichart und Alfons Abel, in
den sechziger bis achziger Jahren des 20. Jahrhunderts ausgeführt2.
Vier weitere Rechteckfelder des Karmeliter-Zyklus vom Anfang des 16. Jahrhunderts, die von Schwemmer 1933 noch
zusammen mit sechs späteren Wappenfeldern im Chorfenster süd III überliefert und in mäßigen Aufnahmen von 1929
festgehalten wurden, sind seit der Kriegsbergung verschollen, doch möglicherweise identisch mit den im Jahr 1949 im
Germanischen Nationalmuseum nachgewiesenen Glasmalereibeständen aus der Bartholomäuskirche (Fig. 389~392)3.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Die am Ort bewahrten dürerzeitlichen Glasmalereien sind nicht
ursprünglich für die Pfarrkirche St. Bartholomäus in Wöhrd bestimmt gewesen, sondern erst nach Mitte des 16. Jahr-
hunderts - nach den Verwüstungen der Kirche im zweiten Markgrafenkrieg 1552 und deren Wiederaufbau 1557-1569
- aus dem aufgehobenen Nürnberger Karmeliterkloster hierher übertragen worden. Deshalb kommt die ältere Bau-
geschichte der 1396 gegründeten, erst 1427 mit allen Rechten einer Pfarrkirche ausgestatteten Bartholomäuskirche
hier nicht in Betracht4.
Da dem Desaster von 1552 der ganze Markt Wöhrd zum Opfer gefallen war, war jahrelang nicht an den Wiederaufbau
der Kirche zu denken. Erst durch nachhaltiges Insistieren des Wöhrder Richters Hieronymus Köler gegenüber dem
Rat der Stadt Nürnberg und durch die finanzielle Unterstützung seitens der ganzen Wöhrder Gemeinde sowie nam-
hafter Nürnberger Patrizierfamilien konnte der neue Chor im Jahr 1557, das Langhaus und der Turm schließlich
1560-1564, sämtlich auf den alten Fundamenten neu errichtet werden5. Bereits zu Anfang des Jahres 1558 erhielt der
neue Chor seinen Fensterschmuck - in Teilen neu gestiftet von Hieronymus Köler (1557) und den Familien Tücher
(1557) und Holzschuher (1558; vgl. Reg. Nr. 71), in Teilen aber übertragen aus dem Kreuzgang des alten Karmeliter-
klosters, das im selben Jahr um den stattlichen Preis von 5700 Gulden an den Nürnberger Kaufherrn Gilch Ayrer ver-
kauft worden war (vgl. Anhang S. 541; Reg. Nr. 86)6. 1564 folgten im Langhaus Fensterstiftungen durch die Nürnber-
ger Patrizierfamilien Behaim, Geuder, Fürer, Haller, Imhoff, Pömer, Schlüsselfelder und Tetzel, ebenfalls vermischt
mit wiederverwendeten Karmeliterscheiben. Größere Renovierungsmaßnahmen sind für die Jahre 1679, 1835 und
1886 überliefert, wobei die gotisierende Wiederherstellung des Innenraumes unter der Leitung des Nürnberger Archi-
1 Verzeichnet werden im folgenden nur die nachmittelalterlichen Glas-
gemälde (s. Kurzinventar Nürnberg, S. 487): 1. Chor I: 3a: Wappen Koler
mit Inschrift: M. D. Paulus T. Ko; - 3b: Wappen Hieronymus Koler, mit
Allianz Groland/Nützel oder Stromer, bez. 1557; - 4a/b: zwei Behaim-
Wappen, bez. 1565; - ja/b: zwei vermehrte Holzschuher-Wappen, bez.
1558. -2. Chor nord II: 1a: Wappen Tetzel mit Beischilden Behaim und
Ebner; ib: Wappen Tetzel mit Beischild Pfinzing und Umschrift:
Anthoni Tetzel, beide 1886. -3. Chor süd II: 1a: Wappen Schlüsselfelder,
1565; - ib: Wappen Schlüsselfelder mit Beischild Stockamer, bez. 1565. -
4. Chor nord III: ta/b: zwei Geuder-Wappen, bez. 1564; - 2a: Wappen
Bartholomäus Pömer mit Wappenkranz Pömer, Schmidtmayer, Rummel
und Bergmeister (mit Beischild Flück), 1564; - 2b: Wappen des Pfarrers
Wild, 1886. - Chor süd III: Stiftung Tücher, 1557 ausgeführt von Sebald
Hirsvogel; la/b: zwei Tücher-Wappen; - 2a: Aufrichtung der Ehernen
Schlange mit knienden Stiftern; - 2b: Kreuzigung Christi mit knienden
Stiftern. - In der Auflistung von Schwemmer, 1933, S. 40-42, waren
dagegen noch über 50 nachmittelalterliche Scheiben verzeichnet, die
wohl größtenteils während des Kriegs nicht geborgen waren und bei der
Zerstörung der Kirche 1943 mit zugrunde gegangen sind.
2 Vgl. Leyh, 1988, S. 16-18.
3 Nürnberg, Hochbauamt, Bildstelle und Fotoarchiv der Stadt Nürn-
berg: Foto Dr. Nagel, Wöhrder Pfarrkirche Nr. 4868/4869 (Abschied der
Apostel), Nr. 4872 (Handwaschung des Pilatus) und Nr. 4874 (Verhör
durch Pilatus). Laut Inhalt eines Revisionsblatts des Germanischen
Nationalmuseums waren 1949 zehn(!) Rechteckscheiben aus St. Bartho-
lomäus in Wöhrd - genau vier Passionsszenen von 1511 und sechs Wap-
pen von 1563 und 1565 - noch im Museum deponiert. Trotz intensiver
Nachforschungen in den Akten und Inventaren des GNM war über
deren Verbleib nichts weiter in Erfahrung zu bringen (für freundl.
Unterstützung bei der Suche habe ich Dr. Daniel Hess, Nürnberg, herz-
lich zu danken).
4 Dazu im Überblick Schwemmer, 1933, S. 7-25; zuletzt Leyh, 1988,
S. 3-8.
5 Zur Geschichte des Baues und seiner Ausstattung mit ausführlichen
Nachweisen im folgenden stets Schwemmer, 1933, S. 10-25.
6 Schwemmer, 1933, S. 41.
Gegenwärtiger Bestand: In den beiden Chorflankenfenstern nord II und süd II sind fünfzehn Rechteckfelder und
ein Figurenfragment des frühen 16. Jahrhunderts mit heilsgeschichtlichen Szenen aus dem Kreuzgang des abgegange-
nen Nürnberger Karmeliterklosters in ikonographischer Abfolge zusammengestellt (Fig. 188-198, 200-207, Abb.
207-227).
Daneben stehen weitere 13 Rechteckscheiben der Jahre 1557—1565, vornehmlich Wappen Nürnberger Patrizier, aber
auch zwei figürliche Szenen von 1557 aus der Werkstatt von Sebald Hirsvogel sowie drei Wappenfelder des späten 19.
Jahrhunderts (1886)1. Die modernen Fenster in Chor und Langhaus einschließlich der neuen Bogenfelder in den
Chorschlußfenstern wurden überwiegend nach Entwürfen Nürnberger Künstler, Theo Reichart und Alfons Abel, in
den sechziger bis achziger Jahren des 20. Jahrhunderts ausgeführt2.
Vier weitere Rechteckfelder des Karmeliter-Zyklus vom Anfang des 16. Jahrhunderts, die von Schwemmer 1933 noch
zusammen mit sechs späteren Wappenfeldern im Chorfenster süd III überliefert und in mäßigen Aufnahmen von 1929
festgehalten wurden, sind seit der Kriegsbergung verschollen, doch möglicherweise identisch mit den im Jahr 1949 im
Germanischen Nationalmuseum nachgewiesenen Glasmalereibeständen aus der Bartholomäuskirche (Fig. 389~392)3.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Die am Ort bewahrten dürerzeitlichen Glasmalereien sind nicht
ursprünglich für die Pfarrkirche St. Bartholomäus in Wöhrd bestimmt gewesen, sondern erst nach Mitte des 16. Jahr-
hunderts - nach den Verwüstungen der Kirche im zweiten Markgrafenkrieg 1552 und deren Wiederaufbau 1557-1569
- aus dem aufgehobenen Nürnberger Karmeliterkloster hierher übertragen worden. Deshalb kommt die ältere Bau-
geschichte der 1396 gegründeten, erst 1427 mit allen Rechten einer Pfarrkirche ausgestatteten Bartholomäuskirche
hier nicht in Betracht4.
Da dem Desaster von 1552 der ganze Markt Wöhrd zum Opfer gefallen war, war jahrelang nicht an den Wiederaufbau
der Kirche zu denken. Erst durch nachhaltiges Insistieren des Wöhrder Richters Hieronymus Köler gegenüber dem
Rat der Stadt Nürnberg und durch die finanzielle Unterstützung seitens der ganzen Wöhrder Gemeinde sowie nam-
hafter Nürnberger Patrizierfamilien konnte der neue Chor im Jahr 1557, das Langhaus und der Turm schließlich
1560-1564, sämtlich auf den alten Fundamenten neu errichtet werden5. Bereits zu Anfang des Jahres 1558 erhielt der
neue Chor seinen Fensterschmuck - in Teilen neu gestiftet von Hieronymus Köler (1557) und den Familien Tücher
(1557) und Holzschuher (1558; vgl. Reg. Nr. 71), in Teilen aber übertragen aus dem Kreuzgang des alten Karmeliter-
klosters, das im selben Jahr um den stattlichen Preis von 5700 Gulden an den Nürnberger Kaufherrn Gilch Ayrer ver-
kauft worden war (vgl. Anhang S. 541; Reg. Nr. 86)6. 1564 folgten im Langhaus Fensterstiftungen durch die Nürnber-
ger Patrizierfamilien Behaim, Geuder, Fürer, Haller, Imhoff, Pömer, Schlüsselfelder und Tetzel, ebenfalls vermischt
mit wiederverwendeten Karmeliterscheiben. Größere Renovierungsmaßnahmen sind für die Jahre 1679, 1835 und
1886 überliefert, wobei die gotisierende Wiederherstellung des Innenraumes unter der Leitung des Nürnberger Archi-
1 Verzeichnet werden im folgenden nur die nachmittelalterlichen Glas-
gemälde (s. Kurzinventar Nürnberg, S. 487): 1. Chor I: 3a: Wappen Koler
mit Inschrift: M. D. Paulus T. Ko; - 3b: Wappen Hieronymus Koler, mit
Allianz Groland/Nützel oder Stromer, bez. 1557; - 4a/b: zwei Behaim-
Wappen, bez. 1565; - ja/b: zwei vermehrte Holzschuher-Wappen, bez.
1558. -2. Chor nord II: 1a: Wappen Tetzel mit Beischilden Behaim und
Ebner; ib: Wappen Tetzel mit Beischild Pfinzing und Umschrift:
Anthoni Tetzel, beide 1886. -3. Chor süd II: 1a: Wappen Schlüsselfelder,
1565; - ib: Wappen Schlüsselfelder mit Beischild Stockamer, bez. 1565. -
4. Chor nord III: ta/b: zwei Geuder-Wappen, bez. 1564; - 2a: Wappen
Bartholomäus Pömer mit Wappenkranz Pömer, Schmidtmayer, Rummel
und Bergmeister (mit Beischild Flück), 1564; - 2b: Wappen des Pfarrers
Wild, 1886. - Chor süd III: Stiftung Tücher, 1557 ausgeführt von Sebald
Hirsvogel; la/b: zwei Tücher-Wappen; - 2a: Aufrichtung der Ehernen
Schlange mit knienden Stiftern; - 2b: Kreuzigung Christi mit knienden
Stiftern. - In der Auflistung von Schwemmer, 1933, S. 40-42, waren
dagegen noch über 50 nachmittelalterliche Scheiben verzeichnet, die
wohl größtenteils während des Kriegs nicht geborgen waren und bei der
Zerstörung der Kirche 1943 mit zugrunde gegangen sind.
2 Vgl. Leyh, 1988, S. 16-18.
3 Nürnberg, Hochbauamt, Bildstelle und Fotoarchiv der Stadt Nürn-
berg: Foto Dr. Nagel, Wöhrder Pfarrkirche Nr. 4868/4869 (Abschied der
Apostel), Nr. 4872 (Handwaschung des Pilatus) und Nr. 4874 (Verhör
durch Pilatus). Laut Inhalt eines Revisionsblatts des Germanischen
Nationalmuseums waren 1949 zehn(!) Rechteckscheiben aus St. Bartho-
lomäus in Wöhrd - genau vier Passionsszenen von 1511 und sechs Wap-
pen von 1563 und 1565 - noch im Museum deponiert. Trotz intensiver
Nachforschungen in den Akten und Inventaren des GNM war über
deren Verbleib nichts weiter in Erfahrung zu bringen (für freundl.
Unterstützung bei der Suche habe ich Dr. Daniel Hess, Nürnberg, herz-
lich zu danken).
4 Dazu im Überblick Schwemmer, 1933, S. 7-25; zuletzt Leyh, 1988,
S. 3-8.
5 Zur Geschichte des Baues und seiner Ausstattung mit ausführlichen
Nachweisen im folgenden stets Schwemmer, 1933, S. 10-25.
6 Schwemmer, 1933, S. 41.