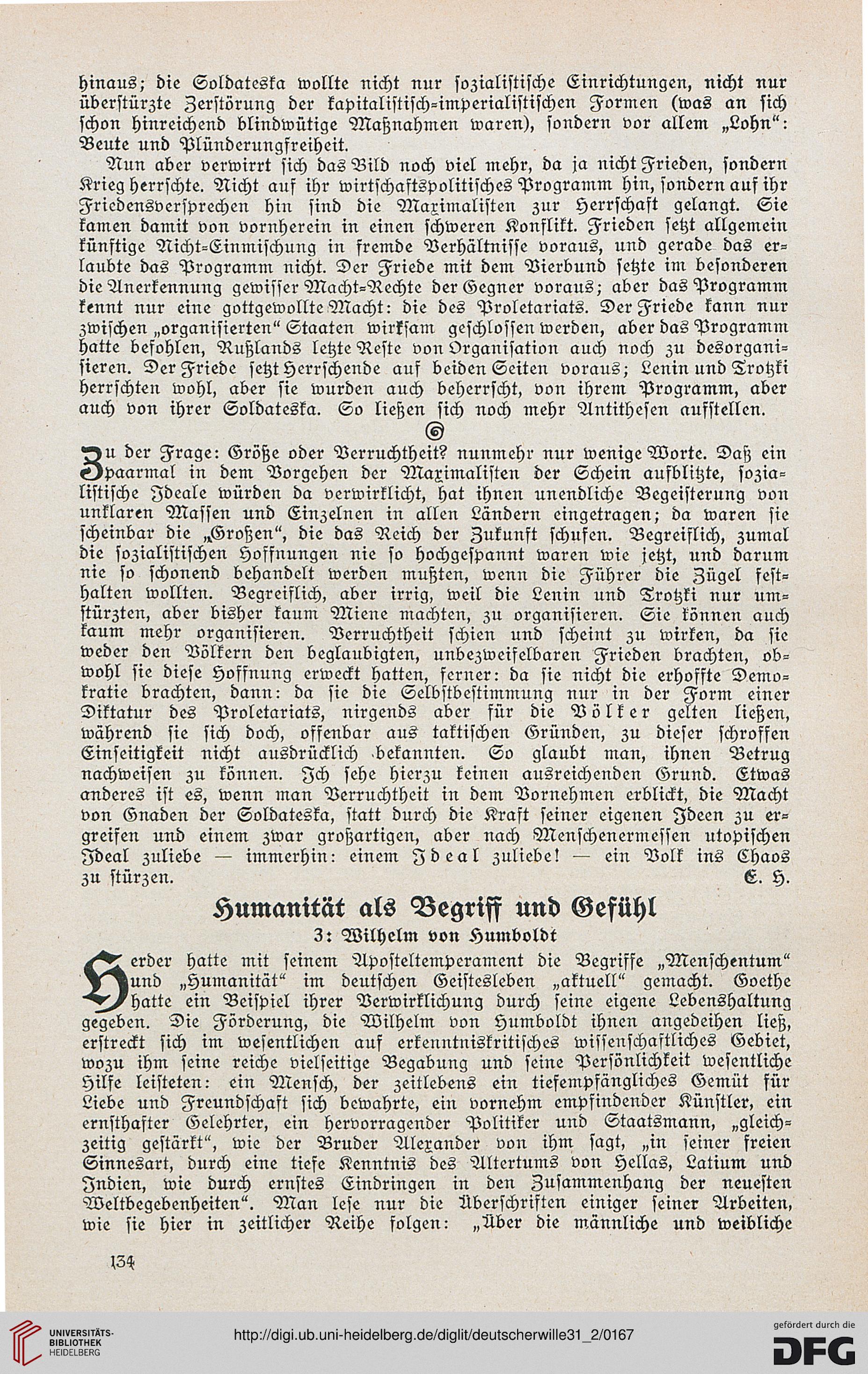hinaus; die Soldateska wollte nicht nur sozialistische Einrichtungen, nicht nur
überstürzte Zerstörung der kapitalistisch-imperialistischen Formen (was an sich
schon hinreichend blindwütige Maßnahmen waren), sondern vor allem „Lohn":
Beute und Plünderungfreiheit.
Nun aber verwirrt sich das Bild noch viel mehr, da ja nicht Frieden, sondern
Krieg herrschte. Nicht auf ihr wirtschaftspolitisches Programm hin, sondern anf ihr
Friedensversprechen hin sind die Maximalisten zur Herrschaft gelangt. Sie
kamen damit von vornherein in einen schweren Konflikt. Frieden setzt allgemein
künftige Nicht-Einmischung in fremde Verhältnisse voraus, und gerade das er-
laubte das Programm nicht. Der Friede mit dem Vierbund setzte im besonderen
die Anerkennung gewisser Macht-Rechte der Gegner voraus; aber das Programm
kennt nur eine gottgewollte Macht: die des Proletariats. Der Friede kann nnr
zwischen „organisierten" Staaten wirksam geschlossen werden, aber das Programm
hatte befohlen, Rußlands letzte Reste von Organisation auch noch zu desorgani-
sieren. Der Friede setzt Herrschende auf beiden Seiten voraus; Lenin und Trotzki
herrschten wohl, aber sie wurden auch beherrscht, von ihrem Programm, aber
auch von ihrer Soldateska. So ließen sich noch mehr Antithesen aufstellen.
T
^)u der Frage: Größe oder Verruchtheit? nnnmehr nur wenige Worte. Daß ein
Apaarmal in dem Vorgehen der Maximalisten der Schein aufblitzte, sozia-
listische Ideale würden da verwirklicht, hat ihnen nnendliche Begeisterung von
unklaren Massen nnd Einzelnen in allen LLndern eingetragen; da waren sie
scheinbar die ,Kroßen", die das Reich der Zukunft schufen. Begreiflich, zumal
die sozialistischen Hoffnungen nie so hochgespannt waren wie jetzt, und darum
nie so schonend behandelt werden mußten, wenn die Führer die Zügel fest-
halten wollten. Begreiflich, aber irrig, weil die Lenin und Trotzki nur um-
stürzten, aber bisher kaum Miene machten, zu organisieren. Sie können auch
kaum mehr organisieren. Verruchtheit schien und scheint zn wirken, da sie
weder den Völkern den beglaubigten, unbezweifelbaren Frieden brachten, ob-
wohl sie diese Hoffnung erweckt hatten, ferner: da sie nicht die erhoffte Demo-
kratie brachten, dann: da sie die Selbstbestimmung nur in der Form einer
Diktatur des Proletariats, nirgends aber für die Völker gelten ließen,
während sie sich doch, offenbar aus taktischen Gründen, zu dieser schroffen
Einseitigkeit nicht ansdrücklich bekannten. So glaubt man, ihnen Betrug
nachweisen zu können. Ich sehe hierzu keinen ansreichenden Grund. Etwas
anderes ist es, wenn man Verruchtheit in dem Vornehmen erblickt, die Macht
von Gnaden der Soldateska, statt durch die Kraft seiner eigenen Ideen zu er-
greifen und einem zwar großartigen, aber nach Menschenermessen utopischen
Ideal zuliebe — immerhin: einem Ideal zuliebe! — ein Volk ins Chaos
zu stürzen. L. H.
HumaniLäL als Begriff und Gefühl
3: Wilhelm von Humboldt
erder hatte mit seinem Aposteltempcrament die Begriffe „Menschentum"
HsHund „Humanität" im deutschen Geistesleben „aktuell" gemacht. Goethe
^^hatte ein Beispiel ihrer Verwirklichung durch seine eigene Lebenshaltung
gegeben. Die Förderung, die Wilhelm von Humboldt ihnen angedeihen ließ,
erstreckt sich im wesentlichen auf erkenntniskritisches wissenschaftliches Gebiet,
wozu ihm seine reiche vielseitige Begabung und seine Persönlichkeit wesentliche
Hilfe leisteten: ein Mensch, der zeitlebens ein tiefempfängliches Gemüt für
Liebe und Freundschaft sich bewahrte, ein vornehm empfindender Künstler, ein
ernsthafter Gelehrter, ein hervorragender Politiker und Staatsmann, „gleich-
zeitig gestärkt", wie der Bruder Alexander von ihm sagt, „in seiner freien
Sinnesart, durch eine tiefe Kenntnis des Altertums von Hellas, Latium und
Indien, wie durch ernstes Eindringen in den Iusammenhang der neuesten
Weltbegebenheiten". Man lese nur die Aberschriften einiger seiner Arbeiten,
wie sie hier in zeitlicher Reihe folgen: „Aber die männliche und weibliche
überstürzte Zerstörung der kapitalistisch-imperialistischen Formen (was an sich
schon hinreichend blindwütige Maßnahmen waren), sondern vor allem „Lohn":
Beute und Plünderungfreiheit.
Nun aber verwirrt sich das Bild noch viel mehr, da ja nicht Frieden, sondern
Krieg herrschte. Nicht auf ihr wirtschaftspolitisches Programm hin, sondern anf ihr
Friedensversprechen hin sind die Maximalisten zur Herrschaft gelangt. Sie
kamen damit von vornherein in einen schweren Konflikt. Frieden setzt allgemein
künftige Nicht-Einmischung in fremde Verhältnisse voraus, und gerade das er-
laubte das Programm nicht. Der Friede mit dem Vierbund setzte im besonderen
die Anerkennung gewisser Macht-Rechte der Gegner voraus; aber das Programm
kennt nur eine gottgewollte Macht: die des Proletariats. Der Friede kann nnr
zwischen „organisierten" Staaten wirksam geschlossen werden, aber das Programm
hatte befohlen, Rußlands letzte Reste von Organisation auch noch zu desorgani-
sieren. Der Friede setzt Herrschende auf beiden Seiten voraus; Lenin und Trotzki
herrschten wohl, aber sie wurden auch beherrscht, von ihrem Programm, aber
auch von ihrer Soldateska. So ließen sich noch mehr Antithesen aufstellen.
T
^)u der Frage: Größe oder Verruchtheit? nnnmehr nur wenige Worte. Daß ein
Apaarmal in dem Vorgehen der Maximalisten der Schein aufblitzte, sozia-
listische Ideale würden da verwirklicht, hat ihnen nnendliche Begeisterung von
unklaren Massen nnd Einzelnen in allen LLndern eingetragen; da waren sie
scheinbar die ,Kroßen", die das Reich der Zukunft schufen. Begreiflich, zumal
die sozialistischen Hoffnungen nie so hochgespannt waren wie jetzt, und darum
nie so schonend behandelt werden mußten, wenn die Führer die Zügel fest-
halten wollten. Begreiflich, aber irrig, weil die Lenin und Trotzki nur um-
stürzten, aber bisher kaum Miene machten, zu organisieren. Sie können auch
kaum mehr organisieren. Verruchtheit schien und scheint zn wirken, da sie
weder den Völkern den beglaubigten, unbezweifelbaren Frieden brachten, ob-
wohl sie diese Hoffnung erweckt hatten, ferner: da sie nicht die erhoffte Demo-
kratie brachten, dann: da sie die Selbstbestimmung nur in der Form einer
Diktatur des Proletariats, nirgends aber für die Völker gelten ließen,
während sie sich doch, offenbar aus taktischen Gründen, zu dieser schroffen
Einseitigkeit nicht ansdrücklich bekannten. So glaubt man, ihnen Betrug
nachweisen zu können. Ich sehe hierzu keinen ansreichenden Grund. Etwas
anderes ist es, wenn man Verruchtheit in dem Vornehmen erblickt, die Macht
von Gnaden der Soldateska, statt durch die Kraft seiner eigenen Ideen zu er-
greifen und einem zwar großartigen, aber nach Menschenermessen utopischen
Ideal zuliebe — immerhin: einem Ideal zuliebe! — ein Volk ins Chaos
zu stürzen. L. H.
HumaniLäL als Begriff und Gefühl
3: Wilhelm von Humboldt
erder hatte mit seinem Aposteltempcrament die Begriffe „Menschentum"
HsHund „Humanität" im deutschen Geistesleben „aktuell" gemacht. Goethe
^^hatte ein Beispiel ihrer Verwirklichung durch seine eigene Lebenshaltung
gegeben. Die Förderung, die Wilhelm von Humboldt ihnen angedeihen ließ,
erstreckt sich im wesentlichen auf erkenntniskritisches wissenschaftliches Gebiet,
wozu ihm seine reiche vielseitige Begabung und seine Persönlichkeit wesentliche
Hilfe leisteten: ein Mensch, der zeitlebens ein tiefempfängliches Gemüt für
Liebe und Freundschaft sich bewahrte, ein vornehm empfindender Künstler, ein
ernsthafter Gelehrter, ein hervorragender Politiker und Staatsmann, „gleich-
zeitig gestärkt", wie der Bruder Alexander von ihm sagt, „in seiner freien
Sinnesart, durch eine tiefe Kenntnis des Altertums von Hellas, Latium und
Indien, wie durch ernstes Eindringen in den Iusammenhang der neuesten
Weltbegebenheiten". Man lese nur die Aberschriften einiger seiner Arbeiten,
wie sie hier in zeitlicher Reihe folgen: „Aber die männliche und weibliche