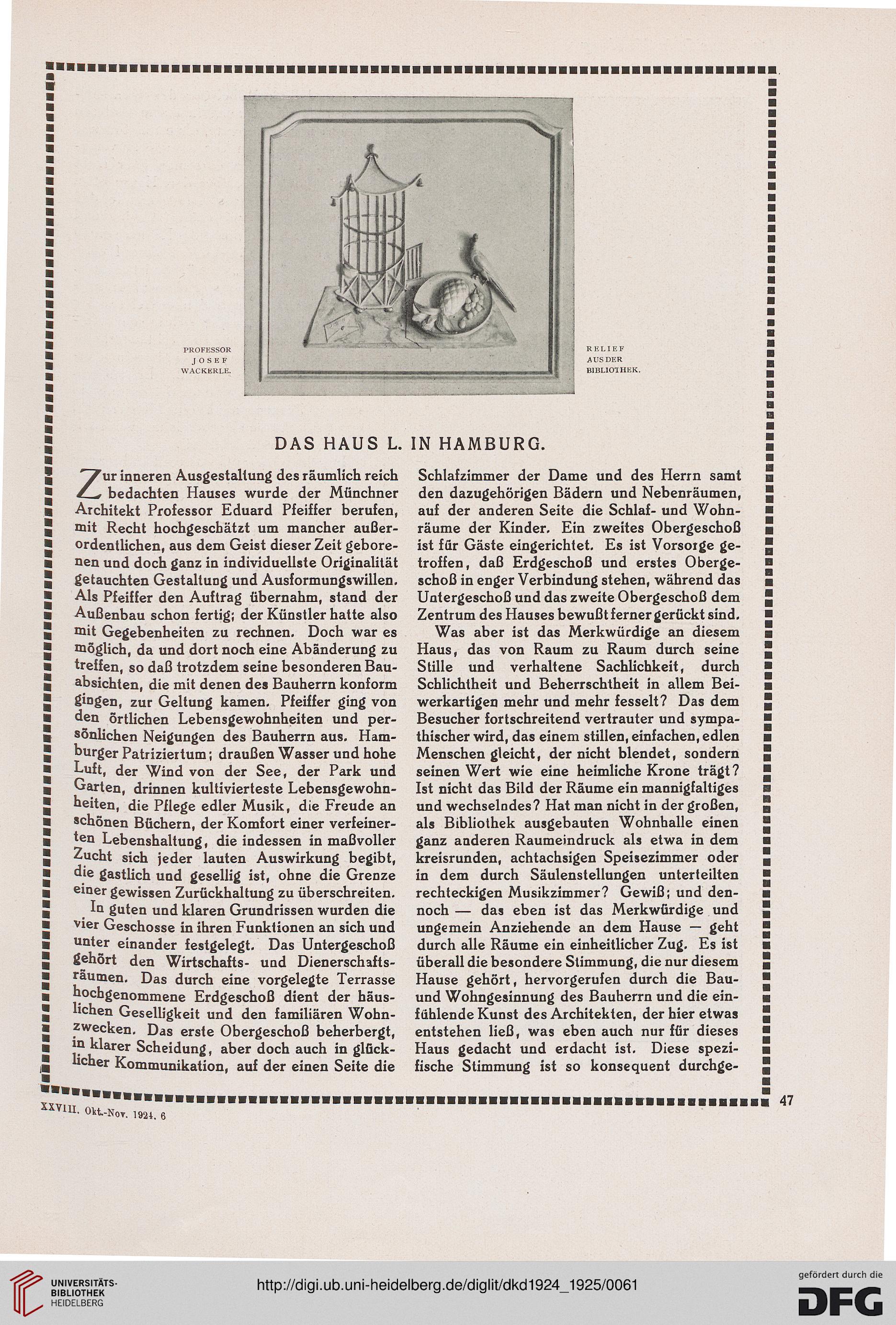PROFESSOR
JOSEF
WACKERLE.
RELIEF
AUS DF.R
BIBLIOTHEK.
DAS HAUS L. IN HAMBURG.
Zur inneren Ausgestaltung des räumlich reich
bedachten Hauses wurde der Münchner
Architekt Professor Eduard Pfeiffer berufen,
mit Recht hochgeschätzt um mancher außer-
ordentlichen, aus dem Geist dieser Zeit gebore-
nen und doch ganz in individuellste Originalität
getauchten Gestaltung und Ausformungswillen.
Als Pfeiffer den Auftrag übernahm, stand der
Außenbau schon fertig; der Künstler hatte also
mit Gegebenheiten zu rechnen. Doch war es
möglich, da und dort noch eine Abänderung zu
treffen, so daß trotzdem seine besonderen Bau-
absichten, die mit denen des Bauherrn konform
gingen, zur Geltung kamen. Pfeiffer ging von
den örtlichen Lebensgewohnheiten und per-
sönlichen Neigungen des Bauherrn aus. Ham-
burger Patriziertum; draußen Wasser und hohe
Luft, der Wind von der See, der Park und
Garten, drinnen kultivierteste Lebensgewohn-
heiten, die Pflege edler Musik, die Freude an
schönen Büchern, der Komfort einer verfeiner-
ten Lebenshaltung, die indessen in maßvoller
Zucht sich jeder lauten Auswirkung begibt,
die gastlich und gesellig ist, ohne die Grenze
einer gewissen Zurückhaltung zu überschreiten.
_ In guten und klaren Grundrissen wurden die
vier Geschosse in ihren Funktionen an sich und
unter einander festgelegt. Das Untergeschoß
gehört den Wirtschafts- und Dienerschafts-
raumen. Das durch eine vorgelegte Terrasse
hochgenommene Erdgeschoß dient der häus-
lichen Geselligkeit und den familiären Wohn-
zwecken. Das erste Obergeschoß beherbergt,
jn klarer Scheidung, aber doch auch in glück-
licher Kommunikation, auf der einen Seite die
Schlafzimmer der Dame und des Herrn samt
den dazugehörigen Bädern und Nebenräumen,
auf der anderen Seite die Schlaf- und Wohn-
räume der Kinder. Ein zweites Obergeschoß
ist für Gäste eingerichtet. Es ist Vorsorge ge-
troffen, daß Erdgeschoß und erstes Oberge-
schoß in enger Verbindung stehen, während das
Untergeschoß und das zweite Obergeschoß dem
Zentrum des Hauses bewußt ferner gerückt sind.
Was aber ist das Merkwürdige an diesem
Haus, das von Raum zu Raum durch seine
Stille und verhaltene Sachlichkeit, durch
Schlichtheit und Beherrschtheit in allem Bei-
werkartigen mehr und mehr fesselt? Das dem
Besucher fortschreitend vertrauter und sympa-
thischer wird, das einem stillen, einfachen, edlen
Menschen gleicht, der nicht blendet, sondern
seinen Wert wie eine heimliche Krone trägt?
Ist nicht das Bild der Räume ein mannigfaltiges
und wechselndes? Hat man nicht in der großen,
als Bibliothek ausgebauten Wohnhalle einen
ganz anderen Raumeindruck als etwa in dem
kreisrunden, achtachsigen Speisezimmer oder
in dem durch Säulenstellungen unterteilten
rechteckigen Musikzimmer? Gewiß; und den-
noch — das eben ist das Merkwürdige und
ungemein Anziehende an dem Hause — geht
durch alle Räume ein einheitlicher Zug. Es ist
überall die besondere Stimmung, die nur diesem
Hause gehört, hervorgerufen durch die Bau-
und Wohngesinnung des Bauherrn und die ein-
fühlende Kunst des Architekten, der hier etwas
entstehen ließ, was eben auch nur für dieses
Haus gedacht und erdacht ist. Diese spezi-
fische Stimmung ist so konsequent durchge-
47
JOSEF
WACKERLE.
RELIEF
AUS DF.R
BIBLIOTHEK.
DAS HAUS L. IN HAMBURG.
Zur inneren Ausgestaltung des räumlich reich
bedachten Hauses wurde der Münchner
Architekt Professor Eduard Pfeiffer berufen,
mit Recht hochgeschätzt um mancher außer-
ordentlichen, aus dem Geist dieser Zeit gebore-
nen und doch ganz in individuellste Originalität
getauchten Gestaltung und Ausformungswillen.
Als Pfeiffer den Auftrag übernahm, stand der
Außenbau schon fertig; der Künstler hatte also
mit Gegebenheiten zu rechnen. Doch war es
möglich, da und dort noch eine Abänderung zu
treffen, so daß trotzdem seine besonderen Bau-
absichten, die mit denen des Bauherrn konform
gingen, zur Geltung kamen. Pfeiffer ging von
den örtlichen Lebensgewohnheiten und per-
sönlichen Neigungen des Bauherrn aus. Ham-
burger Patriziertum; draußen Wasser und hohe
Luft, der Wind von der See, der Park und
Garten, drinnen kultivierteste Lebensgewohn-
heiten, die Pflege edler Musik, die Freude an
schönen Büchern, der Komfort einer verfeiner-
ten Lebenshaltung, die indessen in maßvoller
Zucht sich jeder lauten Auswirkung begibt,
die gastlich und gesellig ist, ohne die Grenze
einer gewissen Zurückhaltung zu überschreiten.
_ In guten und klaren Grundrissen wurden die
vier Geschosse in ihren Funktionen an sich und
unter einander festgelegt. Das Untergeschoß
gehört den Wirtschafts- und Dienerschafts-
raumen. Das durch eine vorgelegte Terrasse
hochgenommene Erdgeschoß dient der häus-
lichen Geselligkeit und den familiären Wohn-
zwecken. Das erste Obergeschoß beherbergt,
jn klarer Scheidung, aber doch auch in glück-
licher Kommunikation, auf der einen Seite die
Schlafzimmer der Dame und des Herrn samt
den dazugehörigen Bädern und Nebenräumen,
auf der anderen Seite die Schlaf- und Wohn-
räume der Kinder. Ein zweites Obergeschoß
ist für Gäste eingerichtet. Es ist Vorsorge ge-
troffen, daß Erdgeschoß und erstes Oberge-
schoß in enger Verbindung stehen, während das
Untergeschoß und das zweite Obergeschoß dem
Zentrum des Hauses bewußt ferner gerückt sind.
Was aber ist das Merkwürdige an diesem
Haus, das von Raum zu Raum durch seine
Stille und verhaltene Sachlichkeit, durch
Schlichtheit und Beherrschtheit in allem Bei-
werkartigen mehr und mehr fesselt? Das dem
Besucher fortschreitend vertrauter und sympa-
thischer wird, das einem stillen, einfachen, edlen
Menschen gleicht, der nicht blendet, sondern
seinen Wert wie eine heimliche Krone trägt?
Ist nicht das Bild der Räume ein mannigfaltiges
und wechselndes? Hat man nicht in der großen,
als Bibliothek ausgebauten Wohnhalle einen
ganz anderen Raumeindruck als etwa in dem
kreisrunden, achtachsigen Speisezimmer oder
in dem durch Säulenstellungen unterteilten
rechteckigen Musikzimmer? Gewiß; und den-
noch — das eben ist das Merkwürdige und
ungemein Anziehende an dem Hause — geht
durch alle Räume ein einheitlicher Zug. Es ist
überall die besondere Stimmung, die nur diesem
Hause gehört, hervorgerufen durch die Bau-
und Wohngesinnung des Bauherrn und die ein-
fühlende Kunst des Architekten, der hier etwas
entstehen ließ, was eben auch nur für dieses
Haus gedacht und erdacht ist. Diese spezi-
fische Stimmung ist so konsequent durchge-
47