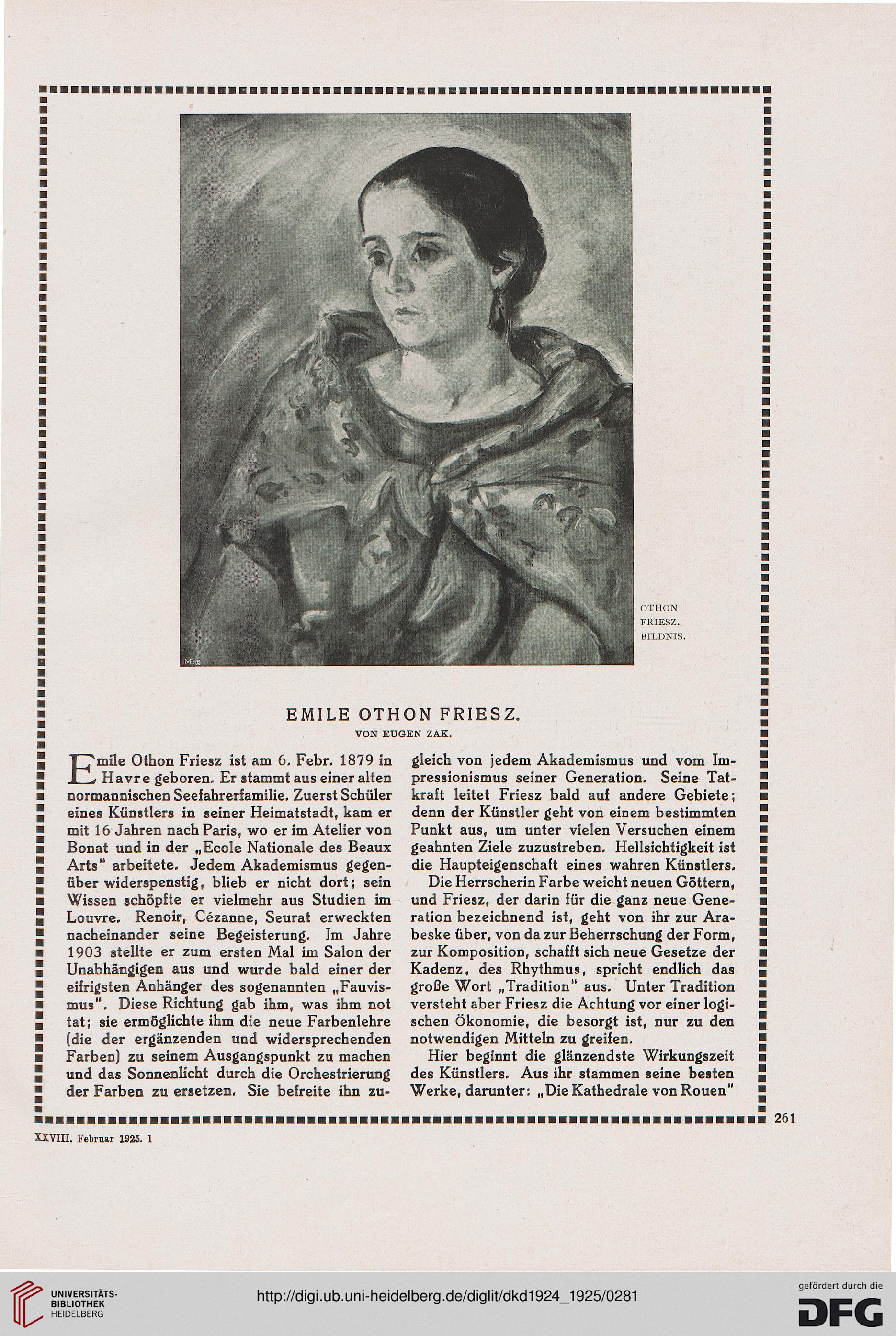EMILE OTHON FRIESZ.
VON EUGEN ZAK.
Emile Othon Friesz ist am 6. Febr. 1879 in
Havr e geboren. Er stammt aus einer alten
normannischen Seefahrerfamilie. Zuerst Schüler
eines Künstlers in seiner Heimatstadt, kam er
mit 16 Jahren nach Paris, wo er im Atelier von
Bonat und in der „Ecole Nationale des Beaux
Arts" arbeitete. Jedem Akademismus gegen-
über widerspenstig, blieb er nicht dort; sein
Wissen schöpfte er vielmehr aus Studien im
Louvre. Renoir, Cezanne, Seurat erweckten
nacheinander seine Begeisterung. Im Jahre
1903 stellte er zum ersten Mal im Salon der
Unabhängigen aus und wurde bald einer der
eifrigsten Anhänger des sogenannten „Fauvis-
mus", Diese Richtung gab ihm, was ihm not
tat; sie ermöglichte ihm die neue Farbenlehre
(die der ergänzenden und widersprechenden
Farben) zu seinem Ausgangspunkt zu machen
und das Sonnenlicht durch die Orchestrierung
der Farben zu ersetzen. Sie befreite ihn zu-
gleich von jedem Akademismus und vom Im-
pressionismus seiner Generation. Seine Tat-
kraft leitet Friesz bald auf andere Gebiete;
denn der Künstler geht von einem bestimmten
Punkt aus, um unter vielen Versuchen einem
geahnten Ziele zuzustreben. Hellsichtigkeit ist
die Haupteigenschaft eines wahren Künstlers.
Die Herrscherin Farbe weicht neuen Göttern,
und Friesz, der darin für die ganz neue Gene-
ration bezeichnend ist, geht von ihr zur Ara-
beske über, von da zur Beherrschung der Form,
zur Komposition, schafft sich neue Gesetze der
Kadenz, des Rhythmus, spricht endlich das
große Wort „Tradition" aus. Unter Tradition
versteht aber Friesz die Achtung vor einer logi-
schen Ökonomie, die besorgt ist, nur zu den
notwendigen Mitteln zu greifen.
Hier beginnt die glänzendste Wirkungszeit
des Künstlers. Aus ihr stammen seine besten
Werke, darunter: „Die Kathedrale von Rouen"
XXVIII. Februar 1925. 1
VON EUGEN ZAK.
Emile Othon Friesz ist am 6. Febr. 1879 in
Havr e geboren. Er stammt aus einer alten
normannischen Seefahrerfamilie. Zuerst Schüler
eines Künstlers in seiner Heimatstadt, kam er
mit 16 Jahren nach Paris, wo er im Atelier von
Bonat und in der „Ecole Nationale des Beaux
Arts" arbeitete. Jedem Akademismus gegen-
über widerspenstig, blieb er nicht dort; sein
Wissen schöpfte er vielmehr aus Studien im
Louvre. Renoir, Cezanne, Seurat erweckten
nacheinander seine Begeisterung. Im Jahre
1903 stellte er zum ersten Mal im Salon der
Unabhängigen aus und wurde bald einer der
eifrigsten Anhänger des sogenannten „Fauvis-
mus", Diese Richtung gab ihm, was ihm not
tat; sie ermöglichte ihm die neue Farbenlehre
(die der ergänzenden und widersprechenden
Farben) zu seinem Ausgangspunkt zu machen
und das Sonnenlicht durch die Orchestrierung
der Farben zu ersetzen. Sie befreite ihn zu-
gleich von jedem Akademismus und vom Im-
pressionismus seiner Generation. Seine Tat-
kraft leitet Friesz bald auf andere Gebiete;
denn der Künstler geht von einem bestimmten
Punkt aus, um unter vielen Versuchen einem
geahnten Ziele zuzustreben. Hellsichtigkeit ist
die Haupteigenschaft eines wahren Künstlers.
Die Herrscherin Farbe weicht neuen Göttern,
und Friesz, der darin für die ganz neue Gene-
ration bezeichnend ist, geht von ihr zur Ara-
beske über, von da zur Beherrschung der Form,
zur Komposition, schafft sich neue Gesetze der
Kadenz, des Rhythmus, spricht endlich das
große Wort „Tradition" aus. Unter Tradition
versteht aber Friesz die Achtung vor einer logi-
schen Ökonomie, die besorgt ist, nur zu den
notwendigen Mitteln zu greifen.
Hier beginnt die glänzendste Wirkungszeit
des Künstlers. Aus ihr stammen seine besten
Werke, darunter: „Die Kathedrale von Rouen"
XXVIII. Februar 1925. 1