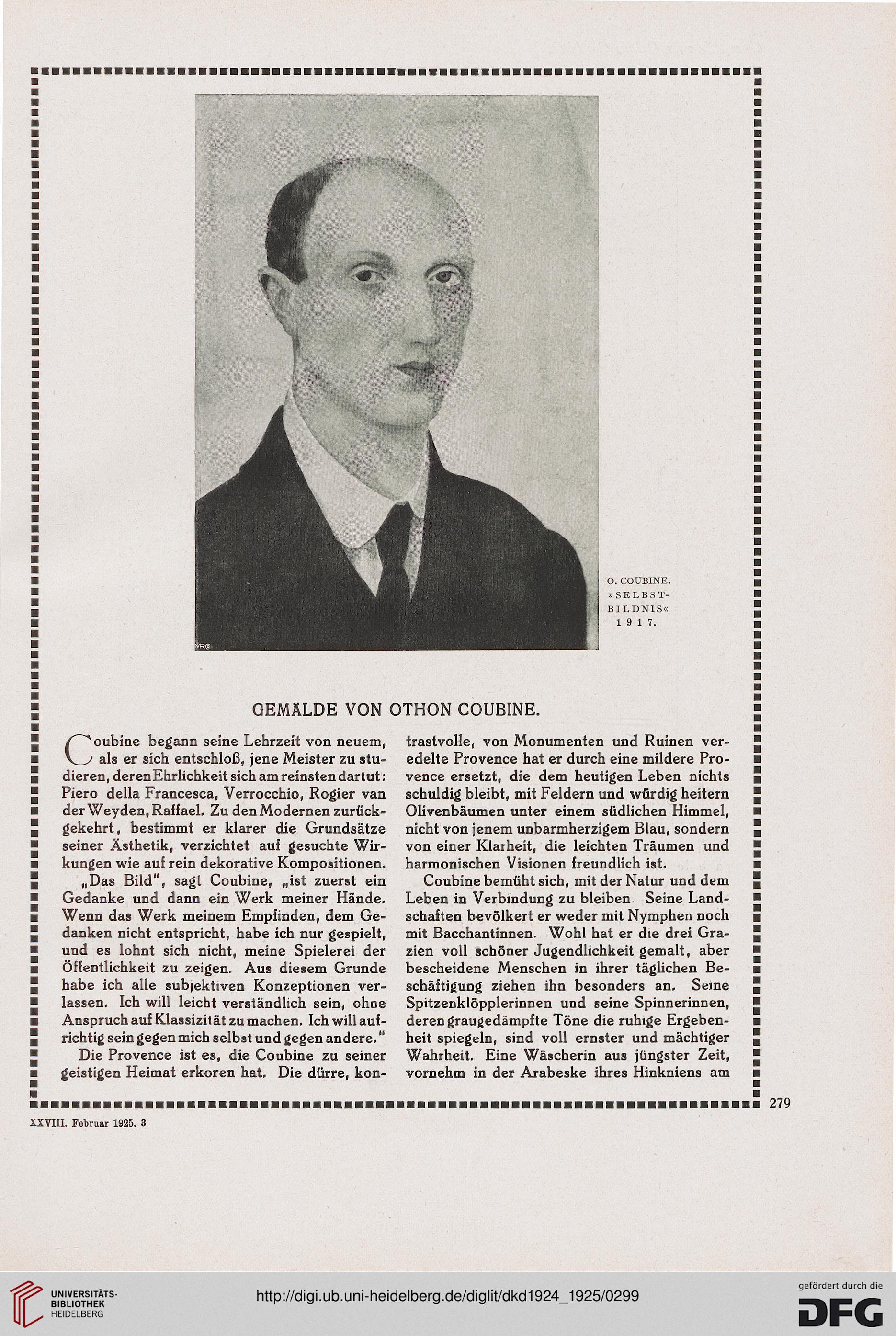O. COUBINE.
»SELBST-
BILDNIS«
19 17.
GEMÄLDE VON OTHON COUBINE.
Coubine begann seine Lehrzeit von neuem,
als er sich entschloß, jene Meister zu stu-
dieren, deren Ehrlichkeit sich am reinsten dartut:
Piero della Francesca, Verrocchio, Rogier van
der Weyden, Raff ael. Zu den Modernen zurück-
gekehrt, bestimmt er klarer die Grundsätze
seiner Ästhetik, verzichtet auf gesuchte Wir-
kungen wie auf rein dekorative Kompositionen.
„Das Bild", sagt Coubine, „ist zuerst ein
Gedanke und dann ein Werk meiner Hände.
Wenn das Werk meinem Empfinden, dem Ge-
danken nicht entspricht, habe ich nur gespielt,
und es lohnt sich nicht, meine Spielerei der
Öffentlichkeit zu zeigen. Aus diesem Grunde
habe ich alle subjektiven Konzeptionen ver-
lassen. Ich will leicht verständlich sein, ohne
Anspruch auf Klassizität zu machen. Ich will auf-
richtig sein gegen mich selbst und gegen andere."
Die Provence ist es, die Coubine zu seiner
geistigen Heimat erkoren hat. Die dürre, kon-
trastvolle, von Monumenten und Ruinen ver-
edelte Provence hat er durch eine mildere Pro-
vence ersetzt, die dem heutigen Leben nichts
schuldig bleibt, mit Feldern und würdig heitern
Olivenbäumen unter einem südlichen Himmel,
nicht von jenem unbarmherzigem Blau, sondern
von einer Klarheit, die leichten Träumen und
harmonischen Visionen freundlich ist.
Coubine bemüht sich, mit der Natur und dem
Leben in Verbindung zu bleiben Seine Land-
schaften bevölkert er weder mit Nymphen noch
mit Bacchantinnen. Wohl hat er die drei Gra-
zien voll schöner Jugendlichkeit gemalt, aber
bescheidene Menschen in ihrer täglichen Be-
schäftigung ziehen ihn besonders an. Seine
Spitzenklöpplerinnen und seine Spinnerinnen,
deren graußedämpfte Töne die ruhige Ergeben-
heit spiegeln, sind voll ernster und mächtiger
Wahrheit. Eine Wäscherin aus jüngster Zeit,
vornehm in der Arabeske ihres Hinkniens am
XXVIII. Februar 1925. 3
»SELBST-
BILDNIS«
19 17.
GEMÄLDE VON OTHON COUBINE.
Coubine begann seine Lehrzeit von neuem,
als er sich entschloß, jene Meister zu stu-
dieren, deren Ehrlichkeit sich am reinsten dartut:
Piero della Francesca, Verrocchio, Rogier van
der Weyden, Raff ael. Zu den Modernen zurück-
gekehrt, bestimmt er klarer die Grundsätze
seiner Ästhetik, verzichtet auf gesuchte Wir-
kungen wie auf rein dekorative Kompositionen.
„Das Bild", sagt Coubine, „ist zuerst ein
Gedanke und dann ein Werk meiner Hände.
Wenn das Werk meinem Empfinden, dem Ge-
danken nicht entspricht, habe ich nur gespielt,
und es lohnt sich nicht, meine Spielerei der
Öffentlichkeit zu zeigen. Aus diesem Grunde
habe ich alle subjektiven Konzeptionen ver-
lassen. Ich will leicht verständlich sein, ohne
Anspruch auf Klassizität zu machen. Ich will auf-
richtig sein gegen mich selbst und gegen andere."
Die Provence ist es, die Coubine zu seiner
geistigen Heimat erkoren hat. Die dürre, kon-
trastvolle, von Monumenten und Ruinen ver-
edelte Provence hat er durch eine mildere Pro-
vence ersetzt, die dem heutigen Leben nichts
schuldig bleibt, mit Feldern und würdig heitern
Olivenbäumen unter einem südlichen Himmel,
nicht von jenem unbarmherzigem Blau, sondern
von einer Klarheit, die leichten Träumen und
harmonischen Visionen freundlich ist.
Coubine bemüht sich, mit der Natur und dem
Leben in Verbindung zu bleiben Seine Land-
schaften bevölkert er weder mit Nymphen noch
mit Bacchantinnen. Wohl hat er die drei Gra-
zien voll schöner Jugendlichkeit gemalt, aber
bescheidene Menschen in ihrer täglichen Be-
schäftigung ziehen ihn besonders an. Seine
Spitzenklöpplerinnen und seine Spinnerinnen,
deren graußedämpfte Töne die ruhige Ergeben-
heit spiegeln, sind voll ernster und mächtiger
Wahrheit. Eine Wäscherin aus jüngster Zeit,
vornehm in der Arabeske ihres Hinkniens am
XXVIII. Februar 1925. 3