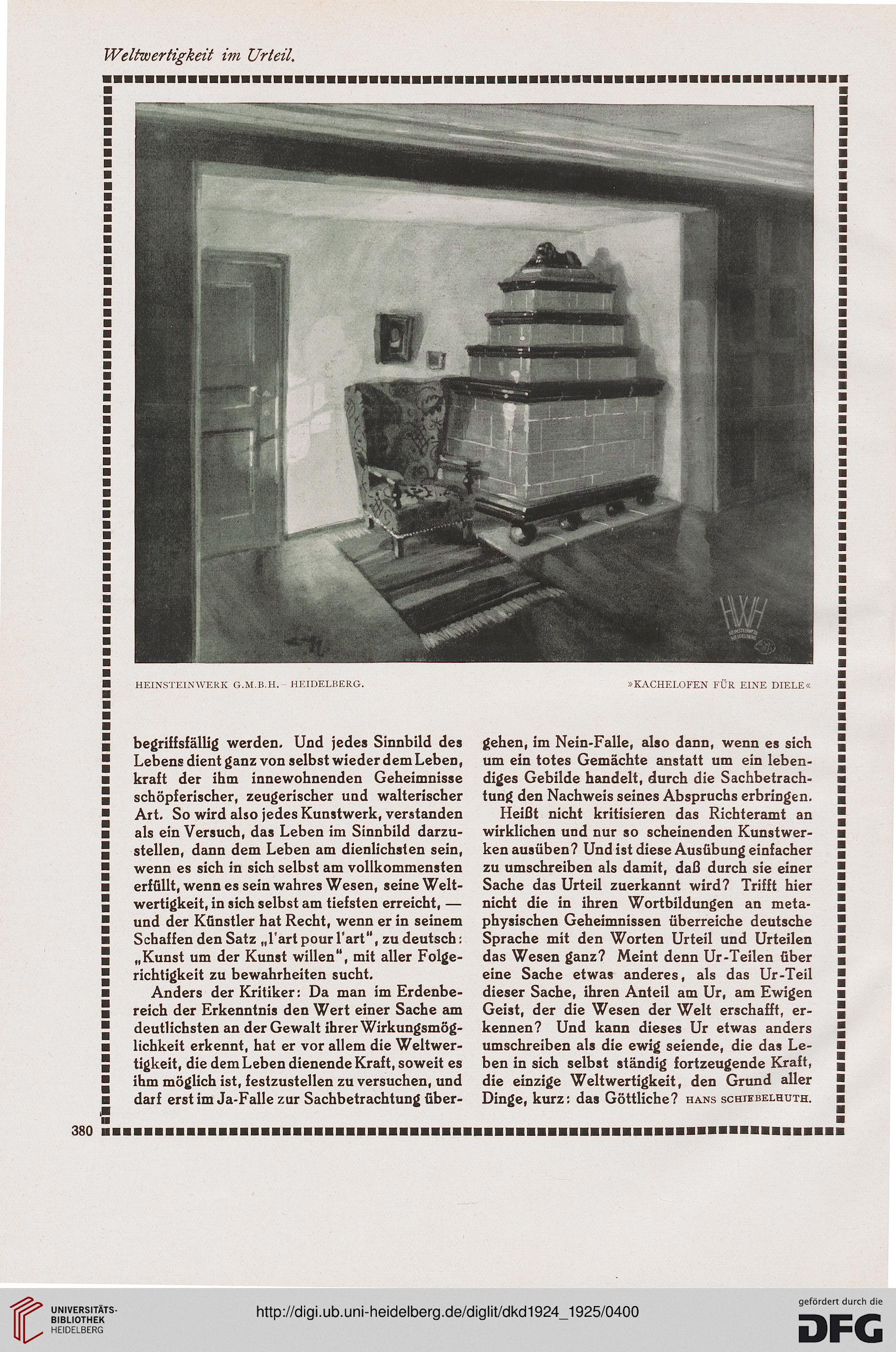Weltwertigkeit im Urteil.
HEINSTEINWERK G.M.B.H. HEIDELBERG.
»KACHELOFEN FÜR EINE DIELE«
begriffsfällig werden. Und jedes Sinnbild des
Lebens dient ganz von selbst wieder dem Leben,
kraft der ihm innewohnenden Geheimnisse
schöpferischer, zeugerischer und walterischer
Art. So wird also jedes Kunstwerk, verstanden
als ein Versuch, das Leben im Sinnbild darzu-
stellen, dann dem Leben am dienlichsten sein,
wenn es sich in sich selbst am vollkommensten
erfüllt, wenn es sein wahres Wesen, seine Welt-
wertigkeit, in sich selbst am tiefsten erreicht, —
und der Künstler hat Recht, wenn er in seinem
Schaffen den Satz „1 art pour l'art", zu deutsch:
„Kunst um der Kunst willen", mit aller Folge-
richtigkeit zu bewahrheiten sucht.
Anders der Kritiker: Da man im Erdenbe-
reich der Erkenntnis den Wert einer Sache am
deutlichsten an der Gewalt ihrer Wirkungsmög-
lichkeit erkennt, hat er vor allem die Weltwer-
tigkeit, die dem Leben dienende Kraft, soweit es
ihm möglich ist, festzustellen zu versuchen, und
darf erst im Ja-Falle zur Sachbetrachtung über-
gehen, im Nein-Falle, also dann, wenn es sich
um ein totes Gemächte anstatt um ein leben-
diges Gebilde handelt, durch die Sachbetrach-
tung den Nachweis seines Abspruchs erbringen.
Heißt nicht kritisieren das Richteramt an
wirklichen und nur so scheinenden Kunstwer-
ken ausüben? Und ist diese Ausübung einfacher
zu umschreiben als damit, daß durch sie einer
Sache das Urteil zuerkannt wird? Trifft hier
nicht die in ihren Wortbildungen an meta-
physischen Geheimnissen überreiche deutsche
Sprache mit den Worten Urteil und Urteilen
das Wesen ganz? Meint denn Ur-Teilen über
eine Sache etwas anderes, als das Ur-Teil
dieser Sache, ihren Anteil am Ur, am Ewigen
Geist, der die Wesen der Welt erschafft, er-
kennen? Und kann dieses Ur etwas anders
umschreiben als die ewig seiende, die das Le-
ben in sich selbst ständig fortzeugende Kraft,
die einzige Weltwertigkeit, den Grund aller
Dinge, kurz: das Göttliche? hans schiebelhuth.
HEINSTEINWERK G.M.B.H. HEIDELBERG.
»KACHELOFEN FÜR EINE DIELE«
begriffsfällig werden. Und jedes Sinnbild des
Lebens dient ganz von selbst wieder dem Leben,
kraft der ihm innewohnenden Geheimnisse
schöpferischer, zeugerischer und walterischer
Art. So wird also jedes Kunstwerk, verstanden
als ein Versuch, das Leben im Sinnbild darzu-
stellen, dann dem Leben am dienlichsten sein,
wenn es sich in sich selbst am vollkommensten
erfüllt, wenn es sein wahres Wesen, seine Welt-
wertigkeit, in sich selbst am tiefsten erreicht, —
und der Künstler hat Recht, wenn er in seinem
Schaffen den Satz „1 art pour l'art", zu deutsch:
„Kunst um der Kunst willen", mit aller Folge-
richtigkeit zu bewahrheiten sucht.
Anders der Kritiker: Da man im Erdenbe-
reich der Erkenntnis den Wert einer Sache am
deutlichsten an der Gewalt ihrer Wirkungsmög-
lichkeit erkennt, hat er vor allem die Weltwer-
tigkeit, die dem Leben dienende Kraft, soweit es
ihm möglich ist, festzustellen zu versuchen, und
darf erst im Ja-Falle zur Sachbetrachtung über-
gehen, im Nein-Falle, also dann, wenn es sich
um ein totes Gemächte anstatt um ein leben-
diges Gebilde handelt, durch die Sachbetrach-
tung den Nachweis seines Abspruchs erbringen.
Heißt nicht kritisieren das Richteramt an
wirklichen und nur so scheinenden Kunstwer-
ken ausüben? Und ist diese Ausübung einfacher
zu umschreiben als damit, daß durch sie einer
Sache das Urteil zuerkannt wird? Trifft hier
nicht die in ihren Wortbildungen an meta-
physischen Geheimnissen überreiche deutsche
Sprache mit den Worten Urteil und Urteilen
das Wesen ganz? Meint denn Ur-Teilen über
eine Sache etwas anderes, als das Ur-Teil
dieser Sache, ihren Anteil am Ur, am Ewigen
Geist, der die Wesen der Welt erschafft, er-
kennen? Und kann dieses Ur etwas anders
umschreiben als die ewig seiende, die das Le-
ben in sich selbst ständig fortzeugende Kraft,
die einzige Weltwertigkeit, den Grund aller
Dinge, kurz: das Göttliche? hans schiebelhuth.