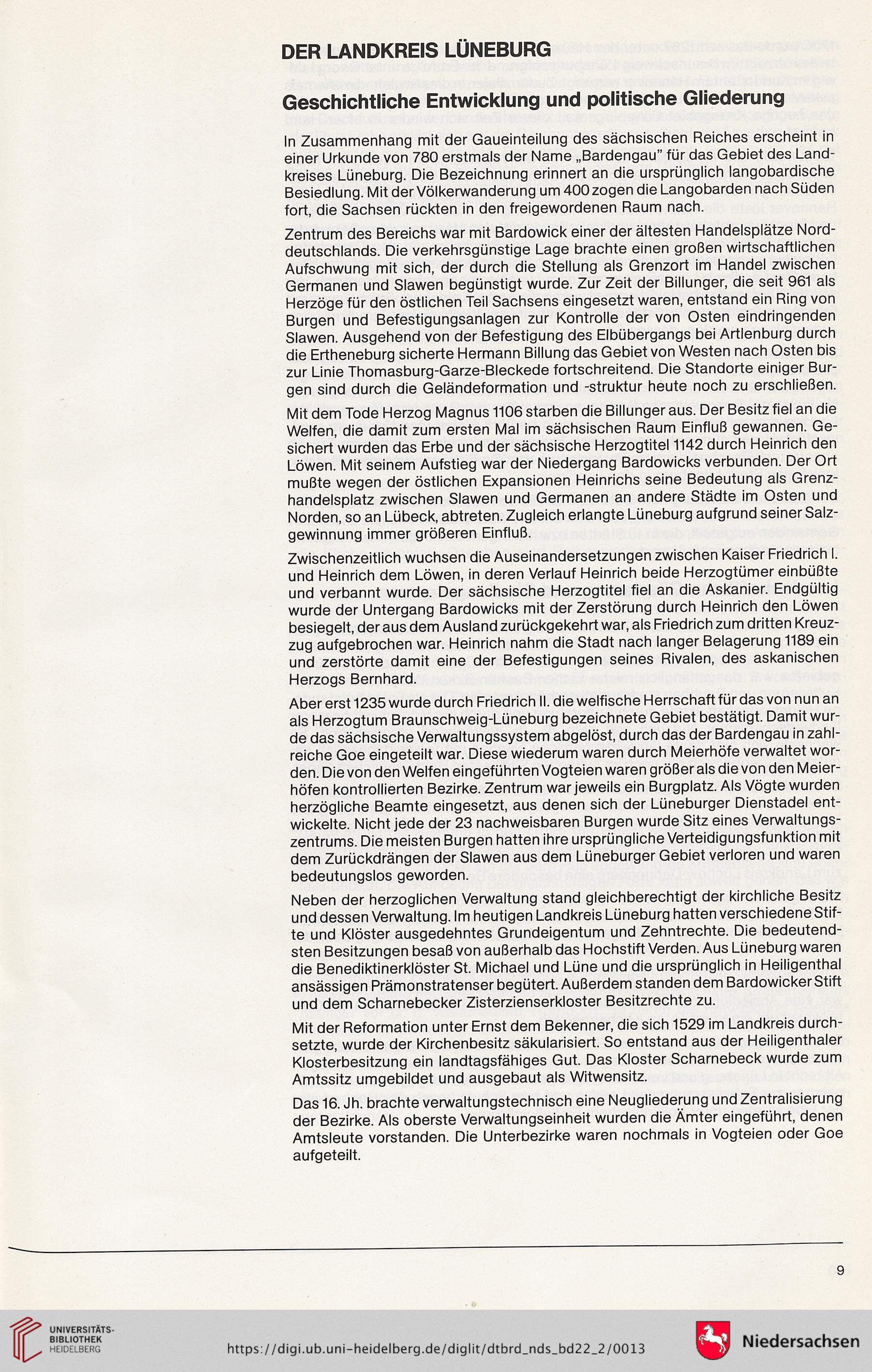DER LANDKREIS LÜNEBURG
Geschichtliche Entwicklung und politische Gliederung
In Zusammenhang mit der Gaueinteilung des sächsischen Reiches erscheint in
einer Urkunde von 780 erstmals der Name „Bardengau” für das Gebiet des Land-
kreises Lüneburg. Die Bezeichnung erinnert an die ursprünglich langobardische
Besiedlung. Mit der Völkerwanderung um 400 zogen die Langobarden nach Süden
fort, die Sachsen rückten in den freigewordenen Raum nach.
Zentrum des Bereichs war mit Bardowick einer der ältesten Handelsplätze Nord-
deutschlands. Die verkehrsgünstige Lage brachte einen großen wirtschaftlichen
Aufschwung mit sich, der durch die Stellung als Grenzort im Handel zwischen
Germanen und Slawen begünstigt wurde. Zur Zeit der Billunger, die seit 961 als
Herzöge für den östlichen Teil Sachsens eingesetzt waren, entstand ein Ring von
Burgen und Befestigungsanlagen zur Kontrolle der von Osten eindringenden
Slawen. Ausgehend von der Befestigung des Elbübergangs bei Artlenburg durch
die Ertheneburg sicherte Hermann Billung das Gebiet von Westen nach Osten bis
zur Linie Thomasburg-Garze-Bleckede fortschreitend. Die Standorte einiger Bur-
gen sind durch die Geländeformation und -Struktur heute noch zu erschließen.
Mit dem Tode Herzog Magnus 1106 starben die Billunger aus. Der Besitz fiel an die
Welfen, die damit zum ersten Mal im sächsischen Raum Einfluß gewannen. Ge-
sichert wurden das Erbe und der sächsische Herzogtitel 1142 durch Heinrich den
Löwen. Mit seinem Aufstieg war der Niedergang Bardowicks verbunden. Der Ort
mußte wegen der östlichen Expansionen Heinrichs seine Bedeutung als Grenz-
handelsplatz zwischen Slawen und Germanen an andere Städte im Osten und
Norden, so an Lübeck, abtreten. Zugleich erlangte Lüneburg aufgrund seiner Salz-
gewinnung immer größeren Einfluß.
Zwischenzeitlich wuchsen die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Friedrich I.
und Heinrich dem Löwen, in deren Verlauf Heinrich beide Herzogtümer einbüßte
und verbannt wurde. Der sächsische Herzogtitel fiel an die Askanier. Endgültig
wurde der Untergang Bardowicks mit der Zerstörung durch Heinrich den Löwen
besiegelt, der aus dem Ausland zurückgekehrt war, als Friedrich zum dritten Kreuz-
zug aufgebrochen war. Heinrich nahm die Stadt nach langer Belagerung 1189 ein
und zerstörte damit eine der Befestigungen seines Rivalen, des askanischen
Herzogs Bernhard.
Aber erst 1235 wurde durch Friedrich II. die welfische Herrschaft für das von nun an
als Herzogtum Braunschweig-Lüneburg bezeichnete Gebiet bestätigt. Damit wur-
de das sächsische Verwaltungssystem abgelöst, durch das der Bardengau in zahl-
reiche Goe eingeteilt war. Diese wiederum waren durch Meierhöfe verwaltet wor-
den. Die von den Welfen eingeführten Vogteien waren größer als die von den Meier-
höfen kontrollierten Bezirke. Zentrum war jeweils ein Burgplatz. Als Vögte wurden
herzogliche Beamte eingesetzt, aus denen sich der Lüneburger Dienstadel ent-
wickelte. Nicht jede der 23 nachweisbaren Burgen wurde Sitz eines Verwaltungs-
zentrums. Die meisten Burgen hatten ihre ursprüngliche Verteidigungsfunktion mit
dem Zurückdrängen der Slawen aus dem Lüneburger Gebiet verloren und waren
bedeutungslos geworden.
Neben der herzoglichen Verwaltung stand gleichberechtigt der kirchliche Besitz
und dessen Verwaltung. Im heutigen Landkreis Lüneburg hatten verschiedene Stif-
te und Klöster ausgedehntes Grundeigentum und Zehntrechte. Die bedeutend-
sten Besitzungen besaß von außerhalb das Hochstift Verden. Aus Lüneburg waren
die Benediktinerklöster St. Michael und Lüne und die ursprünglich in Heiligenthal
ansässigen Prämonstratenser begütert. Außerdem standen dem Bardowicker Stift
und dem Scharnebecker Zisterzienserkloster Besitzrechte zu.
Mit der Reformation unter Ernst dem Bekenner, die sich 1529 im Landkreis durch-
setzte, wurde der Kirchenbesitz säkularisiert. So entstand aus der Heiligenthaler
Klosterbesitzung ein landtagsfähiges Gut. Das Kloster Scharnebeck wurde zum
Amtssitz umgebildet und ausgebaut als Witwensitz.
Das 16. Jh. brachte verwaltungstechnisch eine Neugliederung und Zentralisierung
der Bezirke. Als oberste Verwaltungseinheit wurden die Ämter eingeführt, denen
Amtsleute vorstanden. Die Unterbezirke waren nochmals in Vogteien oder Goe
aufgeteilt.
9
Geschichtliche Entwicklung und politische Gliederung
In Zusammenhang mit der Gaueinteilung des sächsischen Reiches erscheint in
einer Urkunde von 780 erstmals der Name „Bardengau” für das Gebiet des Land-
kreises Lüneburg. Die Bezeichnung erinnert an die ursprünglich langobardische
Besiedlung. Mit der Völkerwanderung um 400 zogen die Langobarden nach Süden
fort, die Sachsen rückten in den freigewordenen Raum nach.
Zentrum des Bereichs war mit Bardowick einer der ältesten Handelsplätze Nord-
deutschlands. Die verkehrsgünstige Lage brachte einen großen wirtschaftlichen
Aufschwung mit sich, der durch die Stellung als Grenzort im Handel zwischen
Germanen und Slawen begünstigt wurde. Zur Zeit der Billunger, die seit 961 als
Herzöge für den östlichen Teil Sachsens eingesetzt waren, entstand ein Ring von
Burgen und Befestigungsanlagen zur Kontrolle der von Osten eindringenden
Slawen. Ausgehend von der Befestigung des Elbübergangs bei Artlenburg durch
die Ertheneburg sicherte Hermann Billung das Gebiet von Westen nach Osten bis
zur Linie Thomasburg-Garze-Bleckede fortschreitend. Die Standorte einiger Bur-
gen sind durch die Geländeformation und -Struktur heute noch zu erschließen.
Mit dem Tode Herzog Magnus 1106 starben die Billunger aus. Der Besitz fiel an die
Welfen, die damit zum ersten Mal im sächsischen Raum Einfluß gewannen. Ge-
sichert wurden das Erbe und der sächsische Herzogtitel 1142 durch Heinrich den
Löwen. Mit seinem Aufstieg war der Niedergang Bardowicks verbunden. Der Ort
mußte wegen der östlichen Expansionen Heinrichs seine Bedeutung als Grenz-
handelsplatz zwischen Slawen und Germanen an andere Städte im Osten und
Norden, so an Lübeck, abtreten. Zugleich erlangte Lüneburg aufgrund seiner Salz-
gewinnung immer größeren Einfluß.
Zwischenzeitlich wuchsen die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Friedrich I.
und Heinrich dem Löwen, in deren Verlauf Heinrich beide Herzogtümer einbüßte
und verbannt wurde. Der sächsische Herzogtitel fiel an die Askanier. Endgültig
wurde der Untergang Bardowicks mit der Zerstörung durch Heinrich den Löwen
besiegelt, der aus dem Ausland zurückgekehrt war, als Friedrich zum dritten Kreuz-
zug aufgebrochen war. Heinrich nahm die Stadt nach langer Belagerung 1189 ein
und zerstörte damit eine der Befestigungen seines Rivalen, des askanischen
Herzogs Bernhard.
Aber erst 1235 wurde durch Friedrich II. die welfische Herrschaft für das von nun an
als Herzogtum Braunschweig-Lüneburg bezeichnete Gebiet bestätigt. Damit wur-
de das sächsische Verwaltungssystem abgelöst, durch das der Bardengau in zahl-
reiche Goe eingeteilt war. Diese wiederum waren durch Meierhöfe verwaltet wor-
den. Die von den Welfen eingeführten Vogteien waren größer als die von den Meier-
höfen kontrollierten Bezirke. Zentrum war jeweils ein Burgplatz. Als Vögte wurden
herzogliche Beamte eingesetzt, aus denen sich der Lüneburger Dienstadel ent-
wickelte. Nicht jede der 23 nachweisbaren Burgen wurde Sitz eines Verwaltungs-
zentrums. Die meisten Burgen hatten ihre ursprüngliche Verteidigungsfunktion mit
dem Zurückdrängen der Slawen aus dem Lüneburger Gebiet verloren und waren
bedeutungslos geworden.
Neben der herzoglichen Verwaltung stand gleichberechtigt der kirchliche Besitz
und dessen Verwaltung. Im heutigen Landkreis Lüneburg hatten verschiedene Stif-
te und Klöster ausgedehntes Grundeigentum und Zehntrechte. Die bedeutend-
sten Besitzungen besaß von außerhalb das Hochstift Verden. Aus Lüneburg waren
die Benediktinerklöster St. Michael und Lüne und die ursprünglich in Heiligenthal
ansässigen Prämonstratenser begütert. Außerdem standen dem Bardowicker Stift
und dem Scharnebecker Zisterzienserkloster Besitzrechte zu.
Mit der Reformation unter Ernst dem Bekenner, die sich 1529 im Landkreis durch-
setzte, wurde der Kirchenbesitz säkularisiert. So entstand aus der Heiligenthaler
Klosterbesitzung ein landtagsfähiges Gut. Das Kloster Scharnebeck wurde zum
Amtssitz umgebildet und ausgebaut als Witwensitz.
Das 16. Jh. brachte verwaltungstechnisch eine Neugliederung und Zentralisierung
der Bezirke. Als oberste Verwaltungseinheit wurden die Ämter eingeführt, denen
Amtsleute vorstanden. Die Unterbezirke waren nochmals in Vogteien oder Goe
aufgeteilt.
9