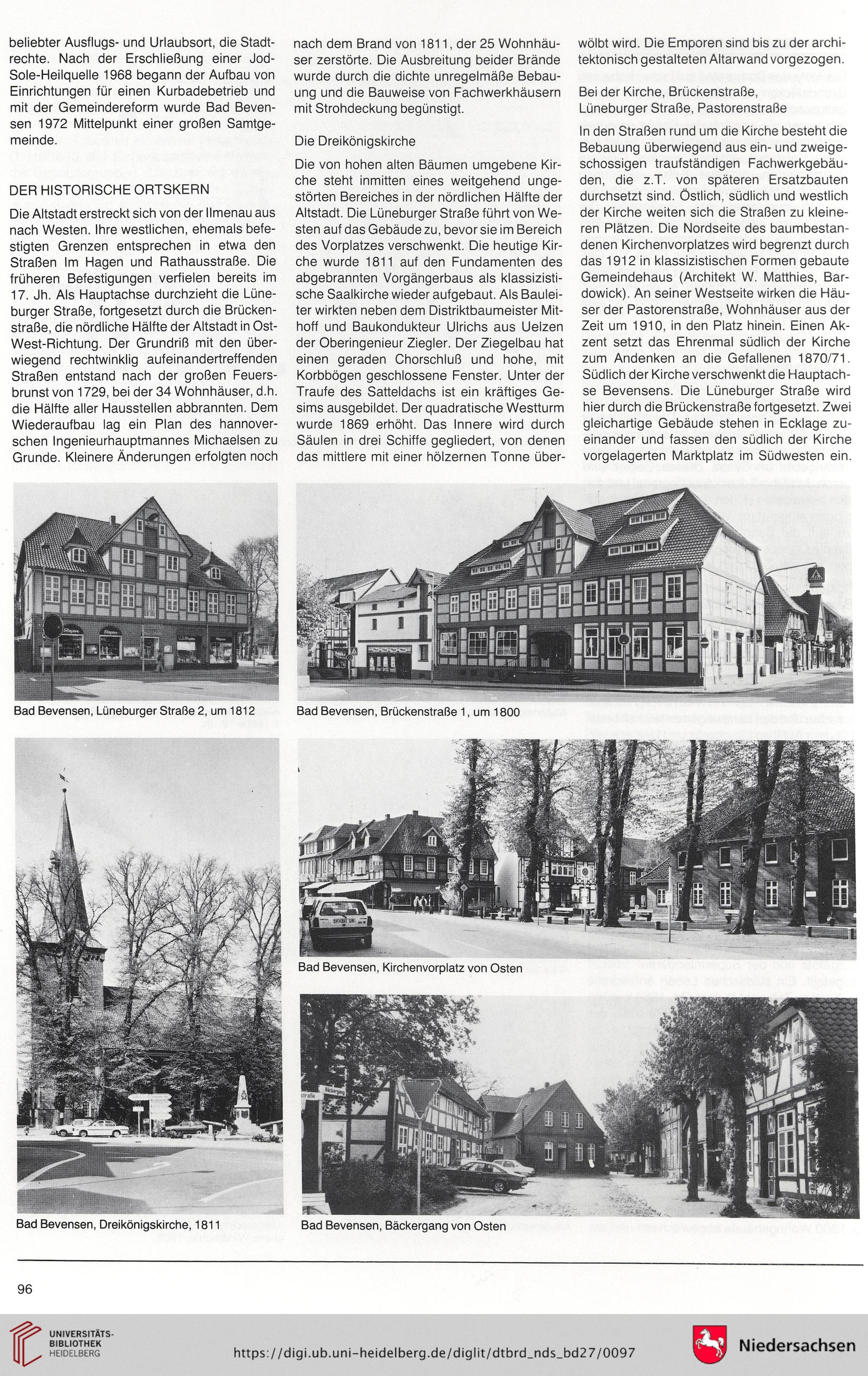beliebter Ausflugs- und Urlaubsort, die Stadt-
rechte. Nach der Erschließung einer Jod-
Sole-Heilquelle 1968 begann der Aufbau von
Einrichtungen für einen Kurbadebetrieb und
mit der Gemeindereform wurde Bad Beven-
sen 1972 Mittelpunkt einer großen Samtge-
meinde.
DER HISTORISCHE ORTSKERN
Die Altstadt erstreckt sich von der Ilmenau aus
nach Westen. Ihre westlichen, ehemals befe-
stigten Grenzen entsprechen in etwa den
Straßen Im Hagen und Rathausstraße. Die
früheren Befestigungen verfielen bereits im
17. Jh. Als Hauptachse durchzieht die Lüne-
burger Straße, fortgesetzt durch die Brücken-
straße, die nördliche Hälfte der Altstadt in Ost-
West-Richtung. Der Grundriß mit den über-
wiegend rechtwinklig aufeinandertreffenden
Straßen entstand nach der großen Feuers-
brunst von 1729, bei der 34 Wohnhäuser, d.h.
die Hälfte aller Hausstellen abbrannten. Dem
Wiederaufbau lag ein Plan des hannover-
schen Ingenieurhauptmannes Michaelsen zu
Grunde. Kleinere Änderungen erfolgten noch
nach dem Brand von 1811, der 25 Wohnhäu-
ser zerstörte. Die Ausbreitung beider Brände
wurde durch die dichte unregelmäße Bebau-
ung und die Bauweise von Fachwerkhäusern
mit Strohdeckung begünstigt.
Die Dreikönigskirche
Die von hohen alten Bäumen umgebene Kir-
che steht inmitten eines weitgehend unge-
störten Bereiches in der nördlichen Hälfte der
Altstadt. Die Lüneburger Straße führt von We-
sten auf das Gebäude zu, bevor sie im Bereich
des Vorplatzes verschwenkt. Die heutige Kir-
che wurde 1811 auf den Fundamenten des
abgebrannten Vorgängerbaus als klassizisti-
sche Saalkirche wieder aufgebaut. Als Baulei-
ter wirkten neben dem Distriktbaumeister Mit-
hoff und Baukondukteur Ulrichs aus Uelzen
der Oberingenieur Ziegler. Der Ziegelbau hat
einen geraden Chorschluß und hohe, mit
Korbbögen geschlossene Fenster. Unter der
Traufe des Satteldachs ist ein kräftiges Ge-
sims ausgebildet. Der quadratische Westturm
wurde 1869 erhöht. Das Innere wird durch
Säulen in drei Schiffe gegliedert, von denen
das mittlere mit einer hölzernen Tonne über-
wölbt wird. Die Emporen sind bis zu der archi-
tektonisch gestalteten Altarwand vorgezogen.
Bei der Kirche, BrücKenstraße,
Lüneburger Straße, Pastorenstraße
In den Straßen rund um die Kirche besteht die
Bebauung überwiegend aus ein- und zweige-
schossigen traufständigen Fachwerkgebäu-
den, die z.T. von späteren Ersatzbauten
durchsetzt sind. Östlich, südlich und westlich
der Kirche weiten sich die Straßen zu kleine-
ren Plätzen. Die Nordseite des baumbestan-
denen Kirchenvorplatzes wird begrenzt durch
das 1912 in klassizistischen Formen gebaute
Gemeindehaus (Architekt W. Matthies, Bar-
dowick). An seiner Westseite wirken die Häu-
ser der Pastorenstraße, Wohnhäuser aus der
Zeit um 1910, in den Platz hinein. Einen Ak-
zent setzt das Ehrenmal südlich der Kirche
zum Andenken an die Gefallenen 1870/71.
Südlich der Kirche verschwenkt die Hauptach-
se Bevensens. Die Lüneburger Straße wird
hier durch die Brückenstraße fortgesetzt. Zwei
gleichartige Gebäude stehen in Ecklage zu-
einander und fassen den südlich der Kirche
vorgelagerten Marktplatz im Südwesten ein.
Bad Bevensen, Lüneburger Straße 2, um 1812 Bad Bevensen, Brückenstraße 1, um 1800
Bad Bevensen, Dreikönigskirche, 1811 Bad Bevensen, Bäckergang von Osten
96
rechte. Nach der Erschließung einer Jod-
Sole-Heilquelle 1968 begann der Aufbau von
Einrichtungen für einen Kurbadebetrieb und
mit der Gemeindereform wurde Bad Beven-
sen 1972 Mittelpunkt einer großen Samtge-
meinde.
DER HISTORISCHE ORTSKERN
Die Altstadt erstreckt sich von der Ilmenau aus
nach Westen. Ihre westlichen, ehemals befe-
stigten Grenzen entsprechen in etwa den
Straßen Im Hagen und Rathausstraße. Die
früheren Befestigungen verfielen bereits im
17. Jh. Als Hauptachse durchzieht die Lüne-
burger Straße, fortgesetzt durch die Brücken-
straße, die nördliche Hälfte der Altstadt in Ost-
West-Richtung. Der Grundriß mit den über-
wiegend rechtwinklig aufeinandertreffenden
Straßen entstand nach der großen Feuers-
brunst von 1729, bei der 34 Wohnhäuser, d.h.
die Hälfte aller Hausstellen abbrannten. Dem
Wiederaufbau lag ein Plan des hannover-
schen Ingenieurhauptmannes Michaelsen zu
Grunde. Kleinere Änderungen erfolgten noch
nach dem Brand von 1811, der 25 Wohnhäu-
ser zerstörte. Die Ausbreitung beider Brände
wurde durch die dichte unregelmäße Bebau-
ung und die Bauweise von Fachwerkhäusern
mit Strohdeckung begünstigt.
Die Dreikönigskirche
Die von hohen alten Bäumen umgebene Kir-
che steht inmitten eines weitgehend unge-
störten Bereiches in der nördlichen Hälfte der
Altstadt. Die Lüneburger Straße führt von We-
sten auf das Gebäude zu, bevor sie im Bereich
des Vorplatzes verschwenkt. Die heutige Kir-
che wurde 1811 auf den Fundamenten des
abgebrannten Vorgängerbaus als klassizisti-
sche Saalkirche wieder aufgebaut. Als Baulei-
ter wirkten neben dem Distriktbaumeister Mit-
hoff und Baukondukteur Ulrichs aus Uelzen
der Oberingenieur Ziegler. Der Ziegelbau hat
einen geraden Chorschluß und hohe, mit
Korbbögen geschlossene Fenster. Unter der
Traufe des Satteldachs ist ein kräftiges Ge-
sims ausgebildet. Der quadratische Westturm
wurde 1869 erhöht. Das Innere wird durch
Säulen in drei Schiffe gegliedert, von denen
das mittlere mit einer hölzernen Tonne über-
wölbt wird. Die Emporen sind bis zu der archi-
tektonisch gestalteten Altarwand vorgezogen.
Bei der Kirche, BrücKenstraße,
Lüneburger Straße, Pastorenstraße
In den Straßen rund um die Kirche besteht die
Bebauung überwiegend aus ein- und zweige-
schossigen traufständigen Fachwerkgebäu-
den, die z.T. von späteren Ersatzbauten
durchsetzt sind. Östlich, südlich und westlich
der Kirche weiten sich die Straßen zu kleine-
ren Plätzen. Die Nordseite des baumbestan-
denen Kirchenvorplatzes wird begrenzt durch
das 1912 in klassizistischen Formen gebaute
Gemeindehaus (Architekt W. Matthies, Bar-
dowick). An seiner Westseite wirken die Häu-
ser der Pastorenstraße, Wohnhäuser aus der
Zeit um 1910, in den Platz hinein. Einen Ak-
zent setzt das Ehrenmal südlich der Kirche
zum Andenken an die Gefallenen 1870/71.
Südlich der Kirche verschwenkt die Hauptach-
se Bevensens. Die Lüneburger Straße wird
hier durch die Brückenstraße fortgesetzt. Zwei
gleichartige Gebäude stehen in Ecklage zu-
einander und fassen den südlich der Kirche
vorgelagerten Marktplatz im Südwesten ein.
Bad Bevensen, Lüneburger Straße 2, um 1812 Bad Bevensen, Brückenstraße 1, um 1800
Bad Bevensen, Dreikönigskirche, 1811 Bad Bevensen, Bäckergang von Osten
96