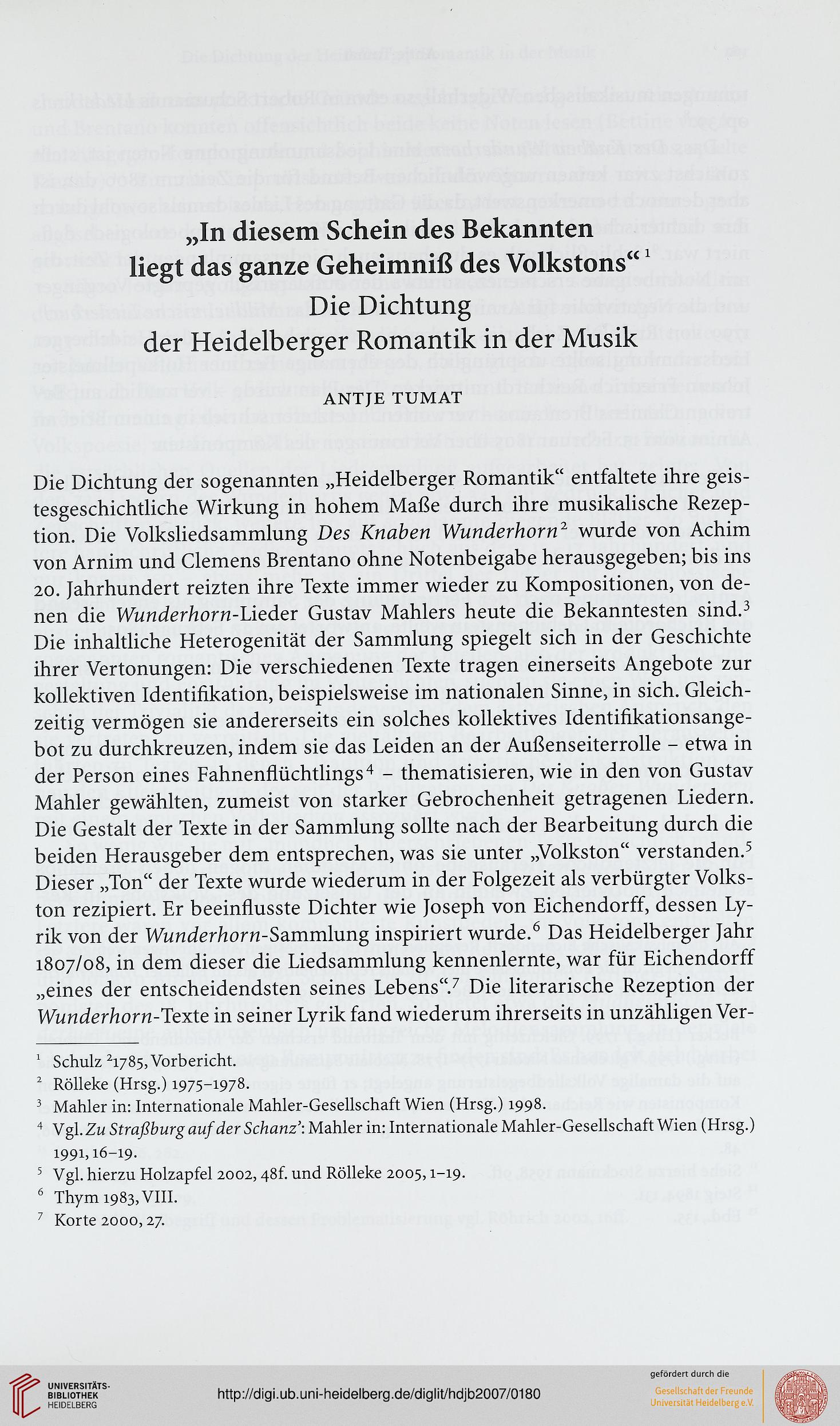„In diesem Schein des Bekannten
liegt das ganze Geheimniß des Volkstons"1
Die Dichtung
der Heidelberger Romantik in der Musik
ANTJE TUMAT
Die Dichtung der sogenannten „Heidelberger Romantik" entfaltete ihre geis-
tesgeschichtliche Wirkung in hohem Maße durch ihre musikalische Rezep-
tion. Die Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn2 wurde von Achim
von Arnim und Clemens Brentano ohne Notenbeigabe herausgegeben; bis ins
20. Jahrhundert reizten ihre Texte immer wieder zu Kompositionen, von de-
nen die Wunderhorn-Lieder Gustav Mahlers heute die Bekanntesten sind.3
Die inhaltliche Heterogenität der Sammlung spiegelt sich in der Geschichte
ihrer Vertonungen: Die verschiedenen Texte tragen einerseits Angebote zur
kollektiven Identifikation, beispielsweise im nationalen Sinne, in sich. Gleich-
zeitig vermögen sie andererseits ein solches kollektives Identifikationsange-
bot zu durchkreuzen, indem sie das Leiden an der Außenseiterrolle - etwa in
der Person eines Fahnenflüchtlings4 - thematisieren, wie in den von Gustav
Mahler gewählten, zumeist von starker Gebrochenheit getragenen Liedern.
Die Gestalt der Texte in der Sammlung sollte nach der Bearbeitung durch die
beiden Herausgeber dem entsprechen, was sie unter „Volkston" verstanden.5
Dieser „Ton" der Texte wurde wiederum in der Folgezeit als verbürgter Volks-
ton rezipiert. Er beeinflusste Dichter wie Joseph von Eichendorff, dessen Ly-
rik von der Wunderhorn-Sammlung inspiriert wurde.6 Das Heidelberger Jahr
1807/08, in dem dieser die Liedsammlung kennenlernte, war für Eichendorff
„eines der entscheidendsten seines Lebens".7 Die literarische Rezeption der
Wunderhorn-Texte in seiner Lyrik fand wiederum ihrerseits in unzähligen Ver-
1 Schulz 2i785, Vorbericht.
2 Rölleke (Hrsg.) 1975-1978.
3 Mahler in: Internationale Mahler-Gesellschaft Wien (Hrsg.) 1998.
4 Vgl. Zw Straßburg auf der Schanz': Mahler in: Internationale Mahler-Gesellschaft Wien (Hrsg.)
1991,16-19.
5 Vgl. hierzu Holzapfel 2002,48f. und Rölleke 2005,1-19.
6 Thym 1983, VIII.
7 Körte 2000,27.
liegt das ganze Geheimniß des Volkstons"1
Die Dichtung
der Heidelberger Romantik in der Musik
ANTJE TUMAT
Die Dichtung der sogenannten „Heidelberger Romantik" entfaltete ihre geis-
tesgeschichtliche Wirkung in hohem Maße durch ihre musikalische Rezep-
tion. Die Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn2 wurde von Achim
von Arnim und Clemens Brentano ohne Notenbeigabe herausgegeben; bis ins
20. Jahrhundert reizten ihre Texte immer wieder zu Kompositionen, von de-
nen die Wunderhorn-Lieder Gustav Mahlers heute die Bekanntesten sind.3
Die inhaltliche Heterogenität der Sammlung spiegelt sich in der Geschichte
ihrer Vertonungen: Die verschiedenen Texte tragen einerseits Angebote zur
kollektiven Identifikation, beispielsweise im nationalen Sinne, in sich. Gleich-
zeitig vermögen sie andererseits ein solches kollektives Identifikationsange-
bot zu durchkreuzen, indem sie das Leiden an der Außenseiterrolle - etwa in
der Person eines Fahnenflüchtlings4 - thematisieren, wie in den von Gustav
Mahler gewählten, zumeist von starker Gebrochenheit getragenen Liedern.
Die Gestalt der Texte in der Sammlung sollte nach der Bearbeitung durch die
beiden Herausgeber dem entsprechen, was sie unter „Volkston" verstanden.5
Dieser „Ton" der Texte wurde wiederum in der Folgezeit als verbürgter Volks-
ton rezipiert. Er beeinflusste Dichter wie Joseph von Eichendorff, dessen Ly-
rik von der Wunderhorn-Sammlung inspiriert wurde.6 Das Heidelberger Jahr
1807/08, in dem dieser die Liedsammlung kennenlernte, war für Eichendorff
„eines der entscheidendsten seines Lebens".7 Die literarische Rezeption der
Wunderhorn-Texte in seiner Lyrik fand wiederum ihrerseits in unzähligen Ver-
1 Schulz 2i785, Vorbericht.
2 Rölleke (Hrsg.) 1975-1978.
3 Mahler in: Internationale Mahler-Gesellschaft Wien (Hrsg.) 1998.
4 Vgl. Zw Straßburg auf der Schanz': Mahler in: Internationale Mahler-Gesellschaft Wien (Hrsg.)
1991,16-19.
5 Vgl. hierzu Holzapfel 2002,48f. und Rölleke 2005,1-19.
6 Thym 1983, VIII.
7 Körte 2000,27.