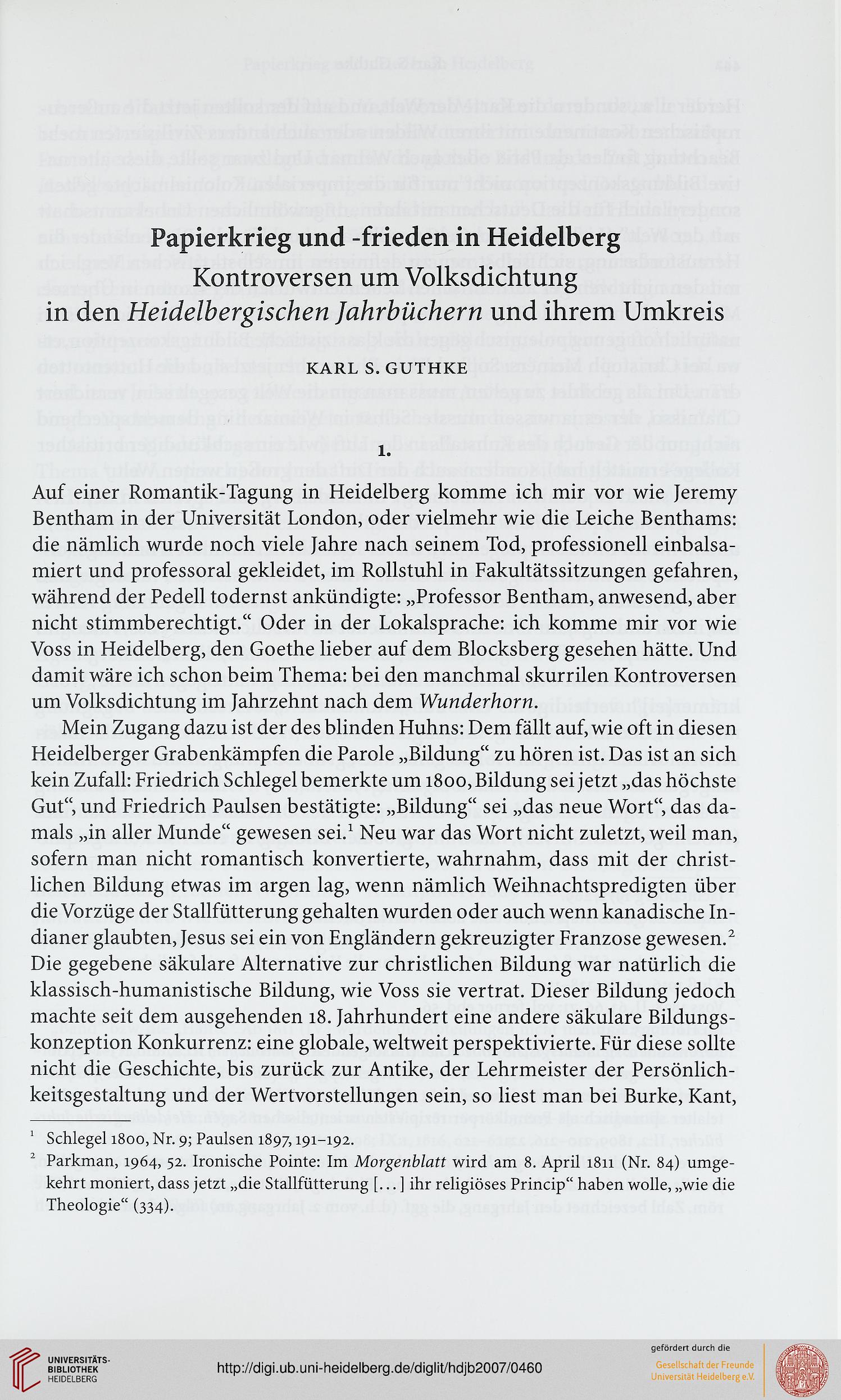Papierkrieg und -frieden in Heidelberg
Kontroversen um Volksdichtung
in den Heidelbergischen Jahrbüchern und ihrem Umkreis
KARL S. GUTHKE
1.
Auf einer Romantik-Tagung in Heidelberg komme ich mir vor wie Jeremy
Bentham in der Universität London, oder vielmehr wie die Leiche Benthams:
die nämlich wurde noch viele Jahre nach seinem Tod, professionell einbalsa-
miert und professoral gekleidet, im Rollstuhl in Fakultätssitzungen gefahren,
während der Pedell todernst ankündigte: „Professor Bentham, anwesend, aber
nicht stimmberechtigt." Oder in der Lokalsprache: ich komme mir vor wie
Voss in Heidelberg, den Goethe lieber auf dem Blocksberg gesehen hätte. Und
damit wäre ich schon beim Thema: bei den manchmal skurrilen Kontroversen
um Volksdichtung im Jahrzehnt nach dem Wunderhorn.
Mein Zugang dazu ist der des blinden Huhns: Dem fällt auf, wie oft in diesen
Heidelberger Grabenkämpfen die Parole „Bildung" zu hören ist. Das ist an sich
kein Zufall: Friedrich Schlegel bemerkte um 1800, Bildung sei jetzt „das höchste
Gut", und Friedrich Paulsen bestätigte: „Bildung" sei „das neue Wort", das da-
mals „in aller Munde" gewesen sei.1 Neu war das Wort nicht zuletzt, weil man,
sofern man nicht romantisch konvertierte, wahrnahm, dass mit der christ-
lichen Bildung etwas im argen lag, wenn nämlich Weihnachtspredigten über
die Vorzüge der Stallfütterung gehalten wurden oder auch wenn kanadische In-
dianer glaubten, Jesus sei ein von Engländern gekreuzigter Franzose gewesen.2
Die gegebene säkulare Alternative zur christlichen Bildung war natürlich die
klassisch-humanistische Bildung, wie Voss sie vertrat. Dieser Bildung jedoch
machte seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert eine andere säkulare Bildungs-
konzeption Konkurrenz: eine globale, weltweit perspektivierte. Für diese sollte
nicht die Geschichte, bis zurück zur Antike, der Lehrmeister der Persönlich-
keitsgestaltung und der Wertvorstellungen sein, so liest man bei Burke, Kant,
1 Schlegel 1800, Nr. 9; Paulsen 1897,191-192.
2 Parkman, 1964, 52. Ironische Pointe: Im Morgenblatt wird am 8. April 1811 (Nr. 84) umge-
kehrt moniert, dass jetzt „die Stallfütterung [... ] ihr religiöses Princip" haben wolle, „wie die
Theologie" (334).
Kontroversen um Volksdichtung
in den Heidelbergischen Jahrbüchern und ihrem Umkreis
KARL S. GUTHKE
1.
Auf einer Romantik-Tagung in Heidelberg komme ich mir vor wie Jeremy
Bentham in der Universität London, oder vielmehr wie die Leiche Benthams:
die nämlich wurde noch viele Jahre nach seinem Tod, professionell einbalsa-
miert und professoral gekleidet, im Rollstuhl in Fakultätssitzungen gefahren,
während der Pedell todernst ankündigte: „Professor Bentham, anwesend, aber
nicht stimmberechtigt." Oder in der Lokalsprache: ich komme mir vor wie
Voss in Heidelberg, den Goethe lieber auf dem Blocksberg gesehen hätte. Und
damit wäre ich schon beim Thema: bei den manchmal skurrilen Kontroversen
um Volksdichtung im Jahrzehnt nach dem Wunderhorn.
Mein Zugang dazu ist der des blinden Huhns: Dem fällt auf, wie oft in diesen
Heidelberger Grabenkämpfen die Parole „Bildung" zu hören ist. Das ist an sich
kein Zufall: Friedrich Schlegel bemerkte um 1800, Bildung sei jetzt „das höchste
Gut", und Friedrich Paulsen bestätigte: „Bildung" sei „das neue Wort", das da-
mals „in aller Munde" gewesen sei.1 Neu war das Wort nicht zuletzt, weil man,
sofern man nicht romantisch konvertierte, wahrnahm, dass mit der christ-
lichen Bildung etwas im argen lag, wenn nämlich Weihnachtspredigten über
die Vorzüge der Stallfütterung gehalten wurden oder auch wenn kanadische In-
dianer glaubten, Jesus sei ein von Engländern gekreuzigter Franzose gewesen.2
Die gegebene säkulare Alternative zur christlichen Bildung war natürlich die
klassisch-humanistische Bildung, wie Voss sie vertrat. Dieser Bildung jedoch
machte seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert eine andere säkulare Bildungs-
konzeption Konkurrenz: eine globale, weltweit perspektivierte. Für diese sollte
nicht die Geschichte, bis zurück zur Antike, der Lehrmeister der Persönlich-
keitsgestaltung und der Wertvorstellungen sein, so liest man bei Burke, Kant,
1 Schlegel 1800, Nr. 9; Paulsen 1897,191-192.
2 Parkman, 1964, 52. Ironische Pointe: Im Morgenblatt wird am 8. April 1811 (Nr. 84) umge-
kehrt moniert, dass jetzt „die Stallfütterung [... ] ihr religiöses Princip" haben wolle, „wie die
Theologie" (334).