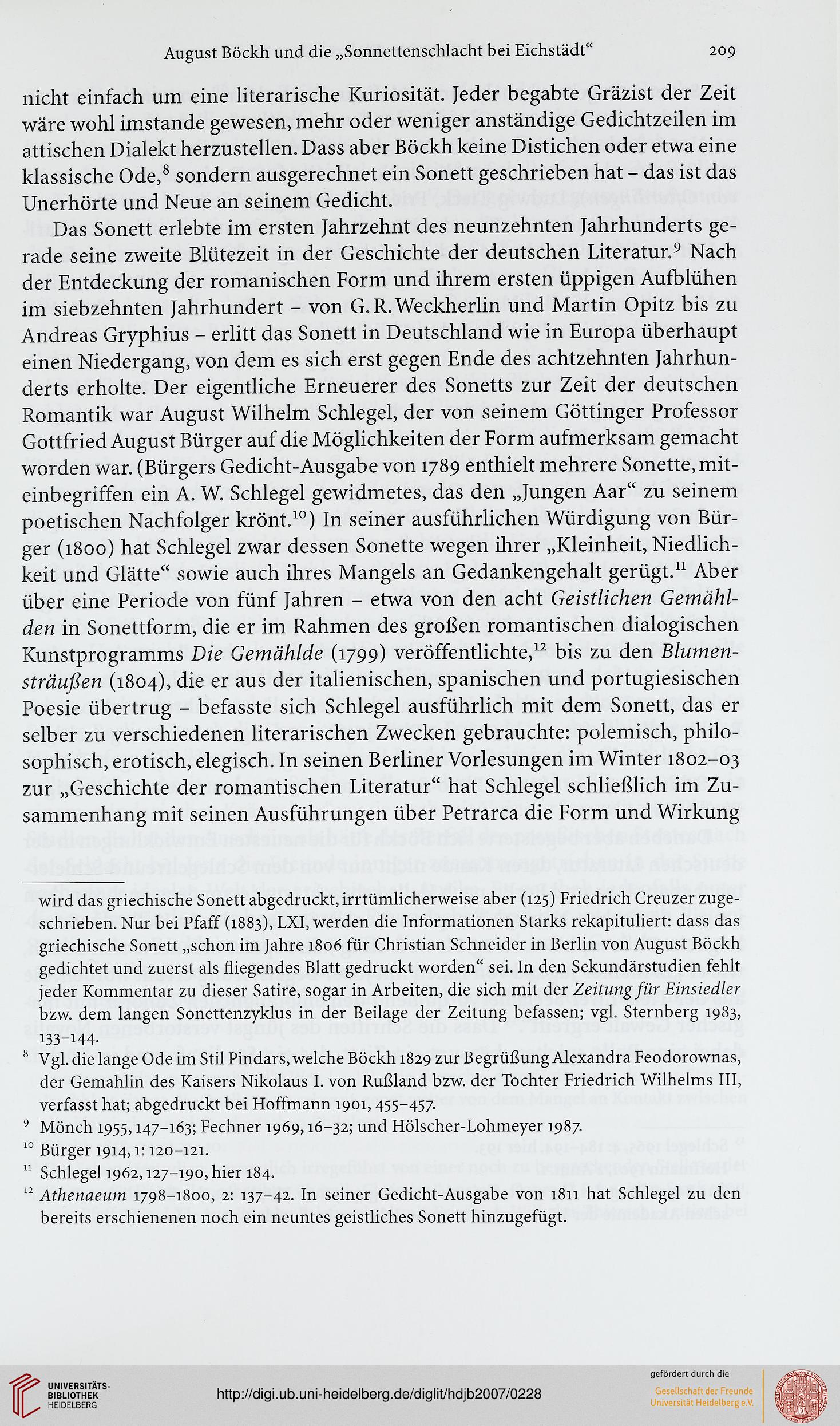August Böckh und die „Sonnettenschlacht bei Eichstädt"
209
nicht einfach um eine literarische Kuriosität. Jeder begabte Gräzist der Zeit
wäre wohl imstande gewesen, mehr oder weniger anständige Gedichtzeilen im
attischen Dialekt herzustellen. Dass aber Böckh keine Distichen oder etwa eine
klassische Ode,8 sondern ausgerechnet ein Sonett geschrieben hat - das ist das
Unerhörte und Neue an seinem Gedicht.
Das Sonett erlebte im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts ge-
rade seine zweite Blütezeit in der Geschichte der deutschen Literatur.9 Nach
der Entdeckung der romanischen Form und ihrem ersten üppigen Aufblühen
im siebzehnten Jahrhundert - von G.R. Weckherlin und Martin Opitz bis zu
Andreas Gryphius - erlitt das Sonett in Deutschland wie in Europa überhaupt
einen Niedergang, von dem es sich erst gegen Ende des achtzehnten Jahrhun-
derts erholte. Der eigentliche Erneuerer des Sonetts zur Zeit der deutschen
Romantik war August Wilhelm Schlegel, der von seinem Göttinger Professor
Gottfried August Bürger auf die Möglichkeiten der Form aufmerksam gemacht
worden war. (Bürgers Gedicht-Ausgabe von 1789 enthielt mehrere Sonette, mit-
einbegriffen ein A. W. Schlegel gewidmetes, das den „Jungen Aar" zu seinem
poetischen Nachfolger krönt.10) In seiner ausführlichen Würdigung von Bür-
ger (1800) hat Schlegel zwar dessen Sonette wegen ihrer „Kleinheit, Niedlich-
keit und Glätte" sowie auch ihres Mangels an Gedankengehalt gerügt.11 Aber
über eine Periode von fünf Jahren - etwa von den acht Geistlichen Gemähl-
den in Sonettform, die er im Rahmen des großen romantischen dialogischen
Kunstprogramms Die Gemähide (1799) veröffentlichte,12 bis zu den Blumen-
sträußen (1804), die er aus der italienischen, spanischen und portugiesischen
Poesie übertrug - befasste sich Schlegel ausführlich mit dem Sonett, das er
selber zu verschiedenen literarischen Zwecken gebrauchte: polemisch, philo-
sophisch, erotisch, elegisch. In seinen Berliner Vorlesungen im Winter 1802-03
zur „Geschichte der romantischen Literatur" hat Schlegel schließlich im Zu-
sammenhang mit seinen Ausführungen über Petrarca die Form und Wirkung
wird das griechische Sonett abgedruckt, irrtümlicherweise aber (125) Friedrich Creuzer zuge-
schrieben. Nur bei Pfaff (1883), LXI, werden die Informationen Starks rekapituliert: dass das
griechische Sonett „schon im Jahre 1806 für Christian Schneider in Berlin von August Böckh
gedichtet und zuerst als fliegendes Blatt gedruckt worden" sei. In den Sekundärstudien fehlt
jeder Kommentar zu dieser Satire, sogar in Arbeiten, die sich mit der Zeitung für Einsiedler
bzw. dem langen Sonettenzyklus in der Beilage der Zeitung befassen; vgl. Sternberg 1983,
133-144.
8 Vgl. die lange Ode im Stil Pindars, welche Böckh 1829 zur Begrüßung Alexandra Feodorownas,
der Gemahlin des Kaisers Nikolaus I. von Rußland bzw. der Tochter Friedrich Wilhelms III,
verfasst hat; abgedruckt bei Hoffmann 1901,455-457.
9 Mönch 1955,147-163; Fechner 1969,16-32; und Hölscher-Lohmeyer 1987.
10 Bürger 1914,1:120-121.
11 Schlegel 1962,127-190, hier 184.
12 Athenaeum 1798-1800, 2: 137-42. In seiner Gedicht-Ausgabe von 1811 hat Schlegel zu den
bereits erschienenen noch ein neuntes geistliches Sonett hinzugefügt.
209
nicht einfach um eine literarische Kuriosität. Jeder begabte Gräzist der Zeit
wäre wohl imstande gewesen, mehr oder weniger anständige Gedichtzeilen im
attischen Dialekt herzustellen. Dass aber Böckh keine Distichen oder etwa eine
klassische Ode,8 sondern ausgerechnet ein Sonett geschrieben hat - das ist das
Unerhörte und Neue an seinem Gedicht.
Das Sonett erlebte im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts ge-
rade seine zweite Blütezeit in der Geschichte der deutschen Literatur.9 Nach
der Entdeckung der romanischen Form und ihrem ersten üppigen Aufblühen
im siebzehnten Jahrhundert - von G.R. Weckherlin und Martin Opitz bis zu
Andreas Gryphius - erlitt das Sonett in Deutschland wie in Europa überhaupt
einen Niedergang, von dem es sich erst gegen Ende des achtzehnten Jahrhun-
derts erholte. Der eigentliche Erneuerer des Sonetts zur Zeit der deutschen
Romantik war August Wilhelm Schlegel, der von seinem Göttinger Professor
Gottfried August Bürger auf die Möglichkeiten der Form aufmerksam gemacht
worden war. (Bürgers Gedicht-Ausgabe von 1789 enthielt mehrere Sonette, mit-
einbegriffen ein A. W. Schlegel gewidmetes, das den „Jungen Aar" zu seinem
poetischen Nachfolger krönt.10) In seiner ausführlichen Würdigung von Bür-
ger (1800) hat Schlegel zwar dessen Sonette wegen ihrer „Kleinheit, Niedlich-
keit und Glätte" sowie auch ihres Mangels an Gedankengehalt gerügt.11 Aber
über eine Periode von fünf Jahren - etwa von den acht Geistlichen Gemähl-
den in Sonettform, die er im Rahmen des großen romantischen dialogischen
Kunstprogramms Die Gemähide (1799) veröffentlichte,12 bis zu den Blumen-
sträußen (1804), die er aus der italienischen, spanischen und portugiesischen
Poesie übertrug - befasste sich Schlegel ausführlich mit dem Sonett, das er
selber zu verschiedenen literarischen Zwecken gebrauchte: polemisch, philo-
sophisch, erotisch, elegisch. In seinen Berliner Vorlesungen im Winter 1802-03
zur „Geschichte der romantischen Literatur" hat Schlegel schließlich im Zu-
sammenhang mit seinen Ausführungen über Petrarca die Form und Wirkung
wird das griechische Sonett abgedruckt, irrtümlicherweise aber (125) Friedrich Creuzer zuge-
schrieben. Nur bei Pfaff (1883), LXI, werden die Informationen Starks rekapituliert: dass das
griechische Sonett „schon im Jahre 1806 für Christian Schneider in Berlin von August Böckh
gedichtet und zuerst als fliegendes Blatt gedruckt worden" sei. In den Sekundärstudien fehlt
jeder Kommentar zu dieser Satire, sogar in Arbeiten, die sich mit der Zeitung für Einsiedler
bzw. dem langen Sonettenzyklus in der Beilage der Zeitung befassen; vgl. Sternberg 1983,
133-144.
8 Vgl. die lange Ode im Stil Pindars, welche Böckh 1829 zur Begrüßung Alexandra Feodorownas,
der Gemahlin des Kaisers Nikolaus I. von Rußland bzw. der Tochter Friedrich Wilhelms III,
verfasst hat; abgedruckt bei Hoffmann 1901,455-457.
9 Mönch 1955,147-163; Fechner 1969,16-32; und Hölscher-Lohmeyer 1987.
10 Bürger 1914,1:120-121.
11 Schlegel 1962,127-190, hier 184.
12 Athenaeum 1798-1800, 2: 137-42. In seiner Gedicht-Ausgabe von 1811 hat Schlegel zu den
bereits erschienenen noch ein neuntes geistliches Sonett hinzugefügt.