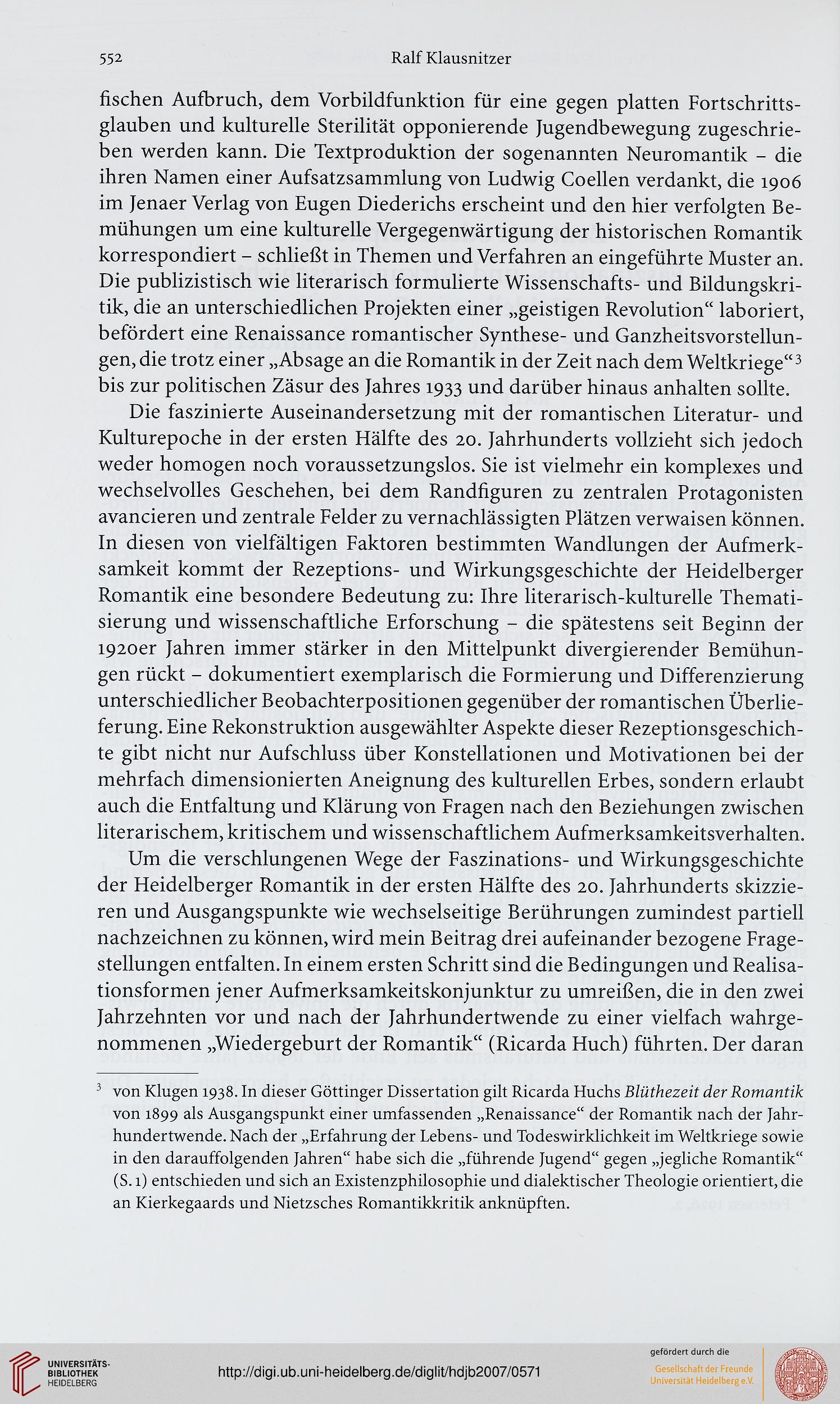552
Ralf Klausnitzer
fischen Aufbruch, dem Vorbildfunktion für eine gegen platten Fortschritts-
glauben und kulturelle Sterilität opponierende Jugendbewegung zugeschrie-
ben werden kann. Die Textproduktion der sogenannten Neuromantik - die
ihren Namen einer Aufsatzsammlung von Ludwig Coellen verdankt, die 1906
im Jenaer Verlag von Eugen Diederichs erscheint und den hier verfolgten Be-
mühungen um eine kulturelle Vergegenwärtigung der historischen Romantik
korrespondiert - schließt in Themen und Verfahren an eingeführte Muster an.
Die publizistisch wie literarisch formulierte Wissenschafts- und Bildungskri-
tik, die an unterschiedlichen Projekten einer „geistigen Revolution" laboriert,
befördert eine Renaissance romantischer Synthese- und Ganzheitsvorstellun-
gen, die trotz einer „Absage an die Romantik in der Zeit nach dem Weltkriege"3
bis zur politischen Zäsur des Jahres 1933 und darüber hinaus anhalten sollte.
Die faszinierte Auseinandersetzung mit der romantischen Literatur- und
Kulturepoche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzieht sich jedoch
weder homogen noch voraussetzungslos. Sie ist vielmehr ein komplexes und
wechselvolles Geschehen, bei dem Randfiguren zu zentralen Protagonisten
avancieren und zentrale Felder zu vernachlässigten Plätzen verwaisen können.
In diesen von vielfältigen Faktoren bestimmten Wandlungen der Aufmerk-
samkeit kommt der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Heidelberger
Romantik eine besondere Bedeutung zu: Ihre literarisch-kulturelle Themati-
sierung und wissenschaftliche Erforschung - die spätestens seit Beginn der
1920er Jahren immer stärker in den Mittelpunkt divergierender Bemühun-
gen rückt - dokumentiert exemplarisch die Formierung und Differenzierung
unterschiedlicher Beobachterpositionen gegenüber der romantischen Überlie-
ferung. Eine Rekonstruktion ausgewählter Aspekte dieser Rezeptionsgeschich-
te gibt nicht nur Aufschluss über Konstellationen und Motivationen bei der
mehrfach dimensionierten Aneignung des kulturellen Erbes, sondern erlaubt
auch die Entfaltung und Klärung von Fragen nach den Beziehungen zwischen
literarischem, kritischem und wissenschaftlichem Aufmerksamkeitsverhalten.
Um die verschlungenen Wege der Faszinations- und Wirkungsgeschichte
der Heidelberger Romantik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts skizzie-
ren und Ausgangspunkte wie wechselseitige Berührungen zumindest partiell
nachzeichnen zu können, wird mein Beitrag drei aufeinander bezogene Frage-
stellungen entfalten. In einem ersten Schritt sind die Bedingungen und Realisa-
tionsformen jener Aufmerksamkeitskonjunktur zu umreißen, die in den zwei
Jahrzehnten vor und nach der Jahrhundertwende zu einer vielfach wahrge-
nommenen „Wiedergeburt der Romantik" (Ricarda Huch) führten. Der daran
3 von Klugen 1938. In dieser Göttinger Dissertation gilt Ricarda Huchs Blüthezeit der Romantik
von 1899 als Ausgangspunkt einer umfassenden „Renaissance" der Romantik nach der Jahr-
hundertwende. Nach der „Erfahrung der Lebens- und Todeswirklichkeit im Weltkriege sowie
in den darauffolgenden Jahren" habe sich die „führende Jugend" gegen „jegliche Romantik"
(S. 1) entschieden und sich an Existenzphilosophie und dialektischer Theologie orientiert, die
an Kierkegaards und Nietzsches Romantikkritik anknüpften.
Ralf Klausnitzer
fischen Aufbruch, dem Vorbildfunktion für eine gegen platten Fortschritts-
glauben und kulturelle Sterilität opponierende Jugendbewegung zugeschrie-
ben werden kann. Die Textproduktion der sogenannten Neuromantik - die
ihren Namen einer Aufsatzsammlung von Ludwig Coellen verdankt, die 1906
im Jenaer Verlag von Eugen Diederichs erscheint und den hier verfolgten Be-
mühungen um eine kulturelle Vergegenwärtigung der historischen Romantik
korrespondiert - schließt in Themen und Verfahren an eingeführte Muster an.
Die publizistisch wie literarisch formulierte Wissenschafts- und Bildungskri-
tik, die an unterschiedlichen Projekten einer „geistigen Revolution" laboriert,
befördert eine Renaissance romantischer Synthese- und Ganzheitsvorstellun-
gen, die trotz einer „Absage an die Romantik in der Zeit nach dem Weltkriege"3
bis zur politischen Zäsur des Jahres 1933 und darüber hinaus anhalten sollte.
Die faszinierte Auseinandersetzung mit der romantischen Literatur- und
Kulturepoche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzieht sich jedoch
weder homogen noch voraussetzungslos. Sie ist vielmehr ein komplexes und
wechselvolles Geschehen, bei dem Randfiguren zu zentralen Protagonisten
avancieren und zentrale Felder zu vernachlässigten Plätzen verwaisen können.
In diesen von vielfältigen Faktoren bestimmten Wandlungen der Aufmerk-
samkeit kommt der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Heidelberger
Romantik eine besondere Bedeutung zu: Ihre literarisch-kulturelle Themati-
sierung und wissenschaftliche Erforschung - die spätestens seit Beginn der
1920er Jahren immer stärker in den Mittelpunkt divergierender Bemühun-
gen rückt - dokumentiert exemplarisch die Formierung und Differenzierung
unterschiedlicher Beobachterpositionen gegenüber der romantischen Überlie-
ferung. Eine Rekonstruktion ausgewählter Aspekte dieser Rezeptionsgeschich-
te gibt nicht nur Aufschluss über Konstellationen und Motivationen bei der
mehrfach dimensionierten Aneignung des kulturellen Erbes, sondern erlaubt
auch die Entfaltung und Klärung von Fragen nach den Beziehungen zwischen
literarischem, kritischem und wissenschaftlichem Aufmerksamkeitsverhalten.
Um die verschlungenen Wege der Faszinations- und Wirkungsgeschichte
der Heidelberger Romantik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts skizzie-
ren und Ausgangspunkte wie wechselseitige Berührungen zumindest partiell
nachzeichnen zu können, wird mein Beitrag drei aufeinander bezogene Frage-
stellungen entfalten. In einem ersten Schritt sind die Bedingungen und Realisa-
tionsformen jener Aufmerksamkeitskonjunktur zu umreißen, die in den zwei
Jahrzehnten vor und nach der Jahrhundertwende zu einer vielfach wahrge-
nommenen „Wiedergeburt der Romantik" (Ricarda Huch) führten. Der daran
3 von Klugen 1938. In dieser Göttinger Dissertation gilt Ricarda Huchs Blüthezeit der Romantik
von 1899 als Ausgangspunkt einer umfassenden „Renaissance" der Romantik nach der Jahr-
hundertwende. Nach der „Erfahrung der Lebens- und Todeswirklichkeit im Weltkriege sowie
in den darauffolgenden Jahren" habe sich die „führende Jugend" gegen „jegliche Romantik"
(S. 1) entschieden und sich an Existenzphilosophie und dialektischer Theologie orientiert, die
an Kierkegaards und Nietzsches Romantikkritik anknüpften.