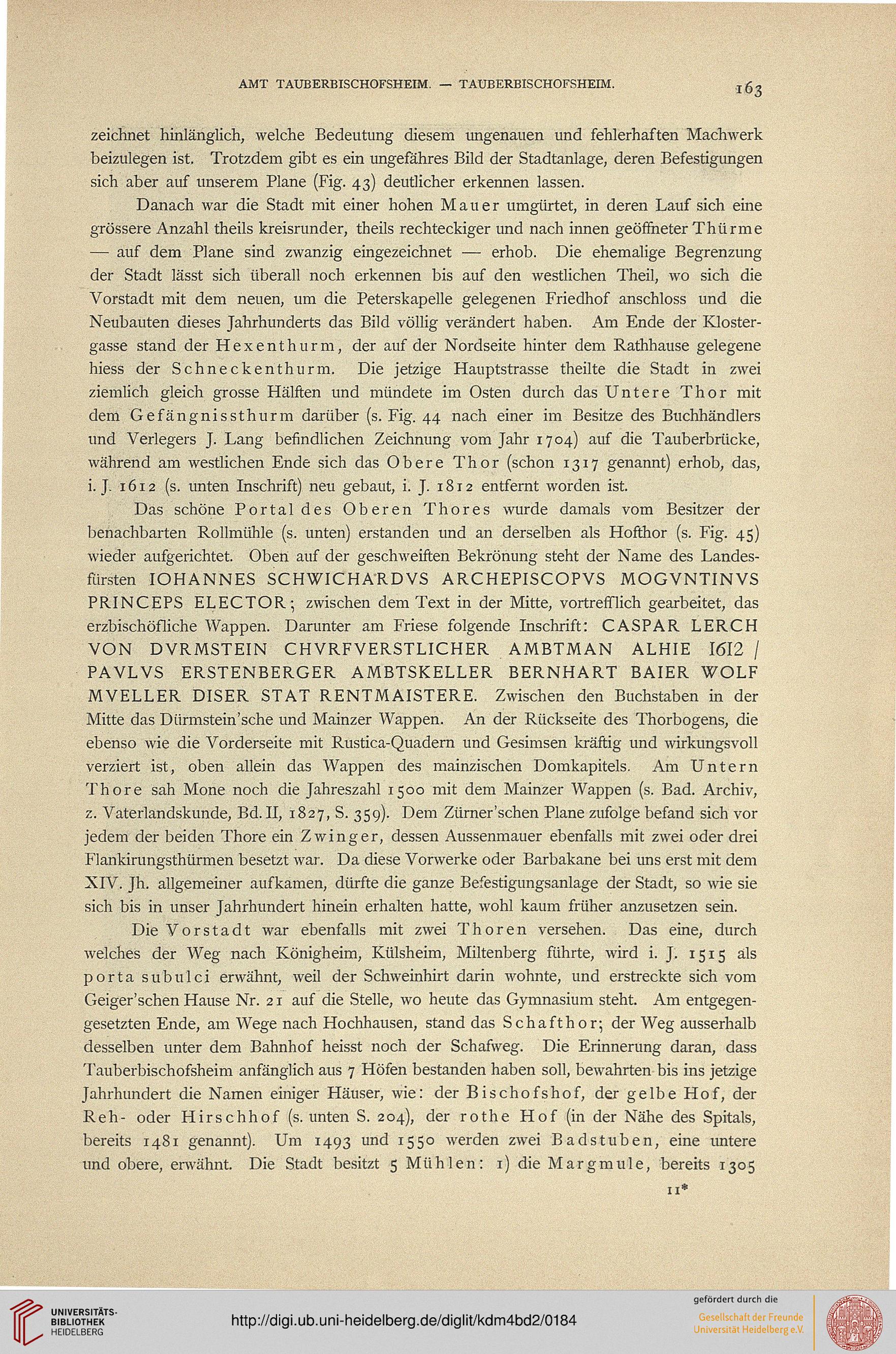AMT TAUBERBISCHOFSHEIM. — TAUBERBISCHOFSHEIM.
163
zeichnet hinlänglich, welche Bedeutung diesem ungenauen und fehlerhaften Machwerk
beizulegen ist. Trotzdem gibt es ein ungefähres Bild der Stadtanlage, deren Befestigungen
sich aber auf unserem Plane (Fig. 43) deutlicher erkennen lassen.
Danach war die Stadt mit einer hohen Mauer umgürtet, in deren Lauf sich eine
grössere Anzahl theils kreisrunder, theils rechteckiger und nach innen geöffneter Thürme
— auf dem Plane sind zwanzig eingezeichnet — erhob. Die ehemalige Begrenzung
der Stadt lässt sich überall noch erkennen bis auf den westlichen Theil, wo sich die
Vorstadt mit dem neuen, um die Peterskapelle gelegenen Friedhof anschloss und die
Neubauten dieses Jahrhunderts das Bild völlig verändert haben. Am Ende der Kloster-
gasse stand der Hexenthurm, der auf der Nordseite hinter dem Rathhause gelegene
hiess der Schneckenthurm. Die jetzige Hauptstrasse theilte die Stadt in zwei
ziemlich gleich grosse Hälften und mündete im Osten durch das Untere Thor mit
dem Gefängnissthurm darüber (s. Fig. 44 nach einer im Besitze des Buchhändlers
und Verlegers J. Lang befindlichen Zeichnung vom Jahr 1704) auf die Tauberbrücke,
während am westlichen Ende sich das Obere Thor (schon 1317 genannt) erhob, das,
i. J. 1612 (s. unten Inschrift) neu gebaut, i. J. 1812 entfernt worden ist.
Das schöne Portal des Oberen Thores wurde damals vom Besitzer der
benachbarten Rollmühle (s. unten) erstanden und an derselben als Hofthor (s. Fig. 45)
wieder aufgerichtet. Oben auf der geschweiften Bekrönung steht der Name des Landes-
fürsten IOHANNES SCHWICHARDVS ARCHEPISCOPVS MOGVNTINVS
PRINCEPS ELECTOR; zwischen dem Text in der Mitte, vortrefflich gearbeitet, das
erzbischöfliche Wappen. Darunter am Friese folgende Inschrift: CASPAR LERCH
VON DVRMSTEIN CHVRFVERSTLICHER AMBTMAN ALHIE 1612 /
PAVLVS ERSTENBERGER AMBTSKELLER BERNHART BAIER WOLF
MVELLER DISER STAT RENTMAISTERE. Zwischen den Buchstaben in der
Mitte das Dürmstein'sche und Mainzer Wappen. An der Rückseite des Thorbogens, die
ebenso wie die Vorderseite mit Rustica-Quadern und Gesimsen kräftig und wirkungsvoll
verziert ist, oben allein das Wappen des mainzischen Domkapitels. Am Untern
Thore sah Mone noch die Jahreszahl 1500 mit dem Mainzer Wappen (s. Bad. Archiv,
z. Vaterlandskunde, Bd. II, 1827, S. 359). Dem Zürner'schen Plane zufolge befand sich vor
jedem der beiden Thore ein Zwinger, dessen Aussenmauer ebenfalls mit zwei oder drei
Flankirungsthürmen besetzt war. Da diese Vorwerke oder Barbakane bei uns erst mit dem
XIV. Jh. allgemeiner aufkamen, dürfte die ganze Befestigungsanlage der Stadt, so wie sie
sich bis in unser Jahrhundert hinein erhalten hatte, wohl kaum früher anzusetzen sein.
Die Vorstadt war ebenfalls mit zwei Thoren versehen. Das eine, durch
welches der Weg nach Königheim, Külsheim, Miltenberg führte, wird i. J. 1515 als
porta subulci erwähnt, weil der Schweinhirt darin wohnte, und erstreckte sich vom
Geiger'schen Hause Nr. 21 auf die Stelle, wo heute das Gymnasium steht. Am entgegen-
gesetzten Ende, am Wege nach Hochhausen, stand das Schafthor; der Weg ausserhalb
desselben unter dem Bahnhof heisst noch der Schafweg. Die Erinnerung daran, dass
Tauberbischofsheim anfänglich aus 7 Höfen bestanden haben soll, bewahrten bis ins jetzige
Jahrhundert die Namen einiger Häuser, wie: der Bischofshof, der gelbe Hof, der
Reh- oder Hirschhof (s. unten S. 204), der rothe Hof (in der Nähe des Spitals,
bereits 1481 genannt). Um 1493 und 1550 werden zwei Badstuben, eine untere
und obere, erwähnt. Die Stadt besitzt 5 Mühlen: 1) die Margmule, bereits 1305
11*
163
zeichnet hinlänglich, welche Bedeutung diesem ungenauen und fehlerhaften Machwerk
beizulegen ist. Trotzdem gibt es ein ungefähres Bild der Stadtanlage, deren Befestigungen
sich aber auf unserem Plane (Fig. 43) deutlicher erkennen lassen.
Danach war die Stadt mit einer hohen Mauer umgürtet, in deren Lauf sich eine
grössere Anzahl theils kreisrunder, theils rechteckiger und nach innen geöffneter Thürme
— auf dem Plane sind zwanzig eingezeichnet — erhob. Die ehemalige Begrenzung
der Stadt lässt sich überall noch erkennen bis auf den westlichen Theil, wo sich die
Vorstadt mit dem neuen, um die Peterskapelle gelegenen Friedhof anschloss und die
Neubauten dieses Jahrhunderts das Bild völlig verändert haben. Am Ende der Kloster-
gasse stand der Hexenthurm, der auf der Nordseite hinter dem Rathhause gelegene
hiess der Schneckenthurm. Die jetzige Hauptstrasse theilte die Stadt in zwei
ziemlich gleich grosse Hälften und mündete im Osten durch das Untere Thor mit
dem Gefängnissthurm darüber (s. Fig. 44 nach einer im Besitze des Buchhändlers
und Verlegers J. Lang befindlichen Zeichnung vom Jahr 1704) auf die Tauberbrücke,
während am westlichen Ende sich das Obere Thor (schon 1317 genannt) erhob, das,
i. J. 1612 (s. unten Inschrift) neu gebaut, i. J. 1812 entfernt worden ist.
Das schöne Portal des Oberen Thores wurde damals vom Besitzer der
benachbarten Rollmühle (s. unten) erstanden und an derselben als Hofthor (s. Fig. 45)
wieder aufgerichtet. Oben auf der geschweiften Bekrönung steht der Name des Landes-
fürsten IOHANNES SCHWICHARDVS ARCHEPISCOPVS MOGVNTINVS
PRINCEPS ELECTOR; zwischen dem Text in der Mitte, vortrefflich gearbeitet, das
erzbischöfliche Wappen. Darunter am Friese folgende Inschrift: CASPAR LERCH
VON DVRMSTEIN CHVRFVERSTLICHER AMBTMAN ALHIE 1612 /
PAVLVS ERSTENBERGER AMBTSKELLER BERNHART BAIER WOLF
MVELLER DISER STAT RENTMAISTERE. Zwischen den Buchstaben in der
Mitte das Dürmstein'sche und Mainzer Wappen. An der Rückseite des Thorbogens, die
ebenso wie die Vorderseite mit Rustica-Quadern und Gesimsen kräftig und wirkungsvoll
verziert ist, oben allein das Wappen des mainzischen Domkapitels. Am Untern
Thore sah Mone noch die Jahreszahl 1500 mit dem Mainzer Wappen (s. Bad. Archiv,
z. Vaterlandskunde, Bd. II, 1827, S. 359). Dem Zürner'schen Plane zufolge befand sich vor
jedem der beiden Thore ein Zwinger, dessen Aussenmauer ebenfalls mit zwei oder drei
Flankirungsthürmen besetzt war. Da diese Vorwerke oder Barbakane bei uns erst mit dem
XIV. Jh. allgemeiner aufkamen, dürfte die ganze Befestigungsanlage der Stadt, so wie sie
sich bis in unser Jahrhundert hinein erhalten hatte, wohl kaum früher anzusetzen sein.
Die Vorstadt war ebenfalls mit zwei Thoren versehen. Das eine, durch
welches der Weg nach Königheim, Külsheim, Miltenberg führte, wird i. J. 1515 als
porta subulci erwähnt, weil der Schweinhirt darin wohnte, und erstreckte sich vom
Geiger'schen Hause Nr. 21 auf die Stelle, wo heute das Gymnasium steht. Am entgegen-
gesetzten Ende, am Wege nach Hochhausen, stand das Schafthor; der Weg ausserhalb
desselben unter dem Bahnhof heisst noch der Schafweg. Die Erinnerung daran, dass
Tauberbischofsheim anfänglich aus 7 Höfen bestanden haben soll, bewahrten bis ins jetzige
Jahrhundert die Namen einiger Häuser, wie: der Bischofshof, der gelbe Hof, der
Reh- oder Hirschhof (s. unten S. 204), der rothe Hof (in der Nähe des Spitals,
bereits 1481 genannt). Um 1493 und 1550 werden zwei Badstuben, eine untere
und obere, erwähnt. Die Stadt besitzt 5 Mühlen: 1) die Margmule, bereits 1305
11*