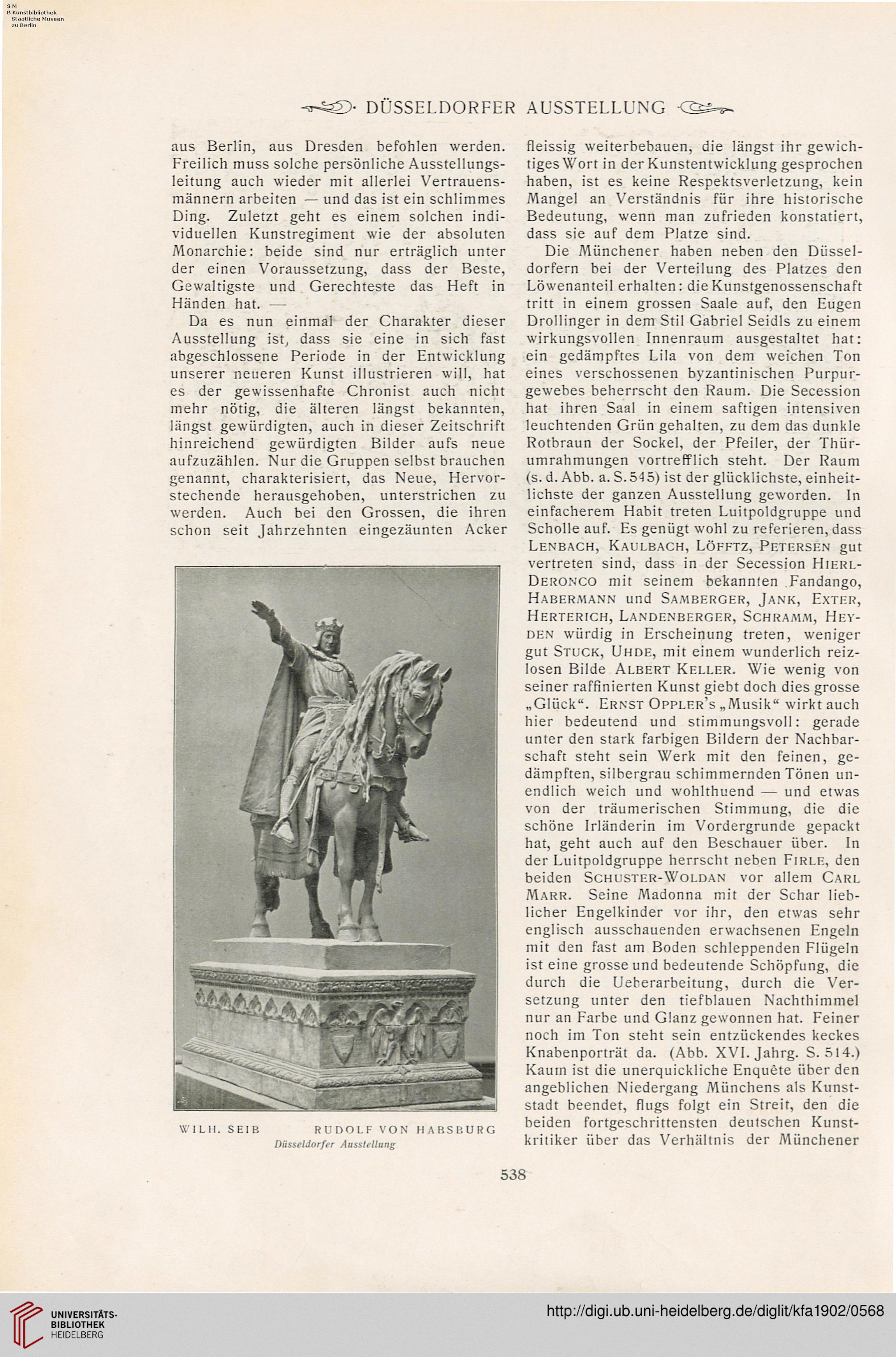-a-4g> DÜSSELDORFER AUSSTELLUNG -CSs^-
aus Berlin, aus Dresden befohlen werden.
Freilich muss solche persönliche Ausstellungs-
leitung auch wieder mit allerlei Vertrauens-
männern arbeiten — und das ist ein schlimmes
Ding. Zuletzt geht es einem solchen indi-
viduellen Kunstregiment wie der absoluten
Monarchie: beide sind nur erträglich unter
der einen Voraussetzung, dass der Beste,
Gewaltigste und Gerechteste das Heft in
Händen hat. —
Da es nun einmal der Charakter dieser
Ausstellung ist, dass sie eine in sich fast
abgeschlossene Periode in der Entwicklung
unserer neueren Kunst illustrieren will, hat
es der gewissenhafte Chronist auch nicht
mehr nötig, die älteren längst bekannten,
längst gewürdigten, auch in dieser Zeitschrift
hinreichend gewürdigten Bilder aufs neue
aufzuzählen. Nur die Gruppen selbst brauchen
genannt, charakterisiert, das Neue, Hervor-
stechende herausgehoben, unterstrichen zu
werden. Auch bei den Grossen, die ihren
schon seit Jahrzehnten eingezäunten Acker
w ilh. seib rudolf von habsburg
Düsseldorfer Ausstellung
fleissig weiterbebauen, die längst ihr gewich-
tiges Wort in der Kunstentwicklung gesprochen
haben, ist es keine Respektsverletzung, kein
Mangel an Verständnis für ihre historische
Bedeutung, wenn man zufrieden konstatiert,
dass sie auf dem Platze sind.
Die Münchener haben neben den Düssel-
dorfern bei der Verteilung des Platzes den
Löwenanteil erhalten: die Kunstgenossenschaft
tritt in einem grossen Saale auf, den Eugen
Drollinger in dem Stil Gabriel Seidls zu einem
wirkungsvollen Innenraum ausgestaltet hat:
ein gedämpftes Lila von dem weichen Ton
eines verschossenen byzantinischen Purpur-
gewebes beherrscht den Raum. Die Secession
hat ihren Saal in einem saftigen intensiven
leuchtenden Grün gehalten, zu dem das dunkle
Rotbraun der Sockel, der Pfeiler, der Thür-
umrahmungen vortrefflich steht. Der Raum
(s.d. Abb. a.S.545) ist der glücklichste, einheit-
lichste der ganzen Ausstellung geworden. In
einfacherem Habit treten Luitpoldgruppe und
Scholle auf. Es genügt wohl zu referieren, dass
Lenbach, Kaulbach, Löfftz, Petersen gut
vertreten sind, dass in der Secession Hierl-
Deronco mit seinem bekannten Fandango,
Haber.mann und Samberger, Jank, Exter,
Herterich, Landenberger, Schramm, Hey-
den würdig in Erscheinung treten, weniger
gut Stuck, Uhde, mit einem wunderlich reiz-
losen Bilde Albert Keller. Wie wenig von
seiner raffinierten Kunst giebt doch dies grosse
„Glück". Ernst Oppler's „Musik" wirktauch
hier bedeutend und stimmungsvoll: gerade
unter den stark farbigen Bildern der Nachbar-
schaft steht sein Werk mit den feinen, ge-
dämpften, silbergrau schimmernden Tönen un-
endlich weich und wohlthuend — und etwas
von der träumerischen Stimmung, die die
schöne Irländerin im Vordergrunde gepackt
hat, geht auch auf den Beschauer über. In
der Luitpoldgruppe herrscht neben Firle, den
beiden Schuster-Woldan vor allem Carl
Marr. Seine Madonna mit der Schar lieb-
licher Engelkinder vor ihr, den etwas sehr
englisch ausschauenden erwachsenen Engeln
mit den fast am Boden schleppenden Flügeln
ist eine grosse und bedeutende Schöpfung, die
durch die Ueberarbeitung, durch die Ver-
setzung unter den tiefblauen Nachthimmel
nur an Farbe und Glanz gewonnen hat. Feiner
noch im Ton steht sein entzückendes keckes
Knabenporträt da. (Abb. XVI. Jahrg. S. 514.)
Kaum ist die unerquickliche Enquete über den
angeblichen Niedergang Münchens als Kunst-
stadt beendet, flugs folgt ein Streit, den die
beiden fortgeschrittensten deutschen Kunst-
kritiker über das Verhältnis der Münchener
538
aus Berlin, aus Dresden befohlen werden.
Freilich muss solche persönliche Ausstellungs-
leitung auch wieder mit allerlei Vertrauens-
männern arbeiten — und das ist ein schlimmes
Ding. Zuletzt geht es einem solchen indi-
viduellen Kunstregiment wie der absoluten
Monarchie: beide sind nur erträglich unter
der einen Voraussetzung, dass der Beste,
Gewaltigste und Gerechteste das Heft in
Händen hat. —
Da es nun einmal der Charakter dieser
Ausstellung ist, dass sie eine in sich fast
abgeschlossene Periode in der Entwicklung
unserer neueren Kunst illustrieren will, hat
es der gewissenhafte Chronist auch nicht
mehr nötig, die älteren längst bekannten,
längst gewürdigten, auch in dieser Zeitschrift
hinreichend gewürdigten Bilder aufs neue
aufzuzählen. Nur die Gruppen selbst brauchen
genannt, charakterisiert, das Neue, Hervor-
stechende herausgehoben, unterstrichen zu
werden. Auch bei den Grossen, die ihren
schon seit Jahrzehnten eingezäunten Acker
w ilh. seib rudolf von habsburg
Düsseldorfer Ausstellung
fleissig weiterbebauen, die längst ihr gewich-
tiges Wort in der Kunstentwicklung gesprochen
haben, ist es keine Respektsverletzung, kein
Mangel an Verständnis für ihre historische
Bedeutung, wenn man zufrieden konstatiert,
dass sie auf dem Platze sind.
Die Münchener haben neben den Düssel-
dorfern bei der Verteilung des Platzes den
Löwenanteil erhalten: die Kunstgenossenschaft
tritt in einem grossen Saale auf, den Eugen
Drollinger in dem Stil Gabriel Seidls zu einem
wirkungsvollen Innenraum ausgestaltet hat:
ein gedämpftes Lila von dem weichen Ton
eines verschossenen byzantinischen Purpur-
gewebes beherrscht den Raum. Die Secession
hat ihren Saal in einem saftigen intensiven
leuchtenden Grün gehalten, zu dem das dunkle
Rotbraun der Sockel, der Pfeiler, der Thür-
umrahmungen vortrefflich steht. Der Raum
(s.d. Abb. a.S.545) ist der glücklichste, einheit-
lichste der ganzen Ausstellung geworden. In
einfacherem Habit treten Luitpoldgruppe und
Scholle auf. Es genügt wohl zu referieren, dass
Lenbach, Kaulbach, Löfftz, Petersen gut
vertreten sind, dass in der Secession Hierl-
Deronco mit seinem bekannten Fandango,
Haber.mann und Samberger, Jank, Exter,
Herterich, Landenberger, Schramm, Hey-
den würdig in Erscheinung treten, weniger
gut Stuck, Uhde, mit einem wunderlich reiz-
losen Bilde Albert Keller. Wie wenig von
seiner raffinierten Kunst giebt doch dies grosse
„Glück". Ernst Oppler's „Musik" wirktauch
hier bedeutend und stimmungsvoll: gerade
unter den stark farbigen Bildern der Nachbar-
schaft steht sein Werk mit den feinen, ge-
dämpften, silbergrau schimmernden Tönen un-
endlich weich und wohlthuend — und etwas
von der träumerischen Stimmung, die die
schöne Irländerin im Vordergrunde gepackt
hat, geht auch auf den Beschauer über. In
der Luitpoldgruppe herrscht neben Firle, den
beiden Schuster-Woldan vor allem Carl
Marr. Seine Madonna mit der Schar lieb-
licher Engelkinder vor ihr, den etwas sehr
englisch ausschauenden erwachsenen Engeln
mit den fast am Boden schleppenden Flügeln
ist eine grosse und bedeutende Schöpfung, die
durch die Ueberarbeitung, durch die Ver-
setzung unter den tiefblauen Nachthimmel
nur an Farbe und Glanz gewonnen hat. Feiner
noch im Ton steht sein entzückendes keckes
Knabenporträt da. (Abb. XVI. Jahrg. S. 514.)
Kaum ist die unerquickliche Enquete über den
angeblichen Niedergang Münchens als Kunst-
stadt beendet, flugs folgt ein Streit, den die
beiden fortgeschrittensten deutschen Kunst-
kritiker über das Verhältnis der Münchener
538