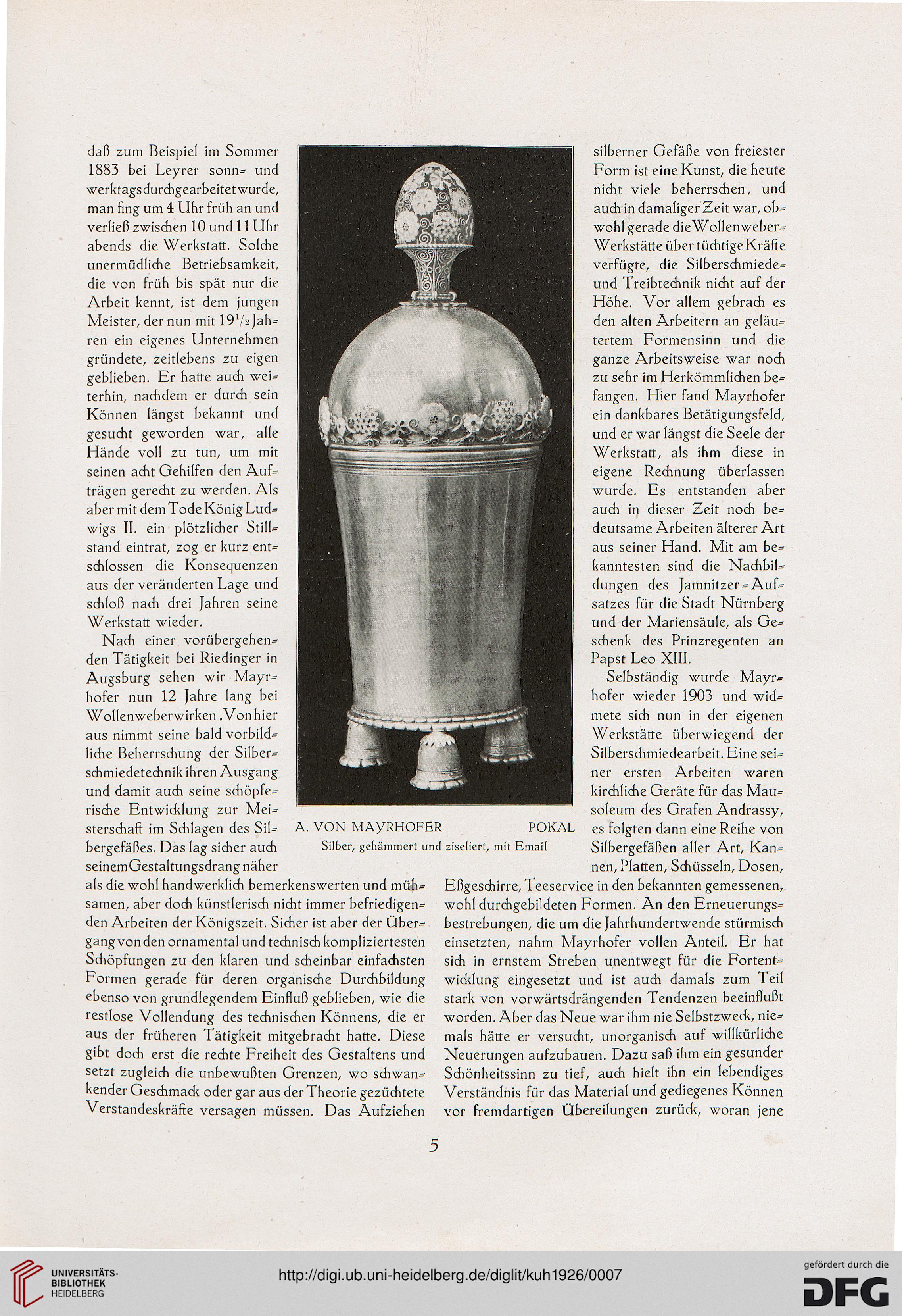daß zum Beispiel im Sommer
1883 bei Leyrer sonn« und
werktags durchgearbeitet wurde,
man fing um 4 Uhr früh an und
verließ zwischen 10 und 11 Uhr
abends die Werkstatt. Solche
unermüdliche Betriebsamkeit,
die von früh bis spät nur die
Arbeit kennt, ist dem jungen
Meister, der nun mit 191/s Jah-
ren ein eigenes Unternehmen
gründete, zeitlebens zu eigen
geblieben. Er hatte auch wei-
terhin, nachdem er durch sein
Können längst bekannt und
gesucht geworden war, alle
Hände voll zu tun, um mit
seinen acht Gehilfen den Auf-
trägen gerecht zu werden. Als
aber mit dem Tode König Lud-
wigs II. ein plötzlicher Still-
stand eintrat, zog er kurz ent-
schlössen die Konsequenzen
aus der veränderten Lage und
schloß nach drei Jahren seine
Werkstatt wieder.
Nach einer vorübergehen^
den Tätigkeit bei Riedinger in
Augsburg sehen wir Mayr-
hofer nun 12 Jahre lang bei
Wollen weberwirken Von hier
aus nimmt seine bald vorbilde
liehe Beherrschung der Silber-
schmiedetechnik ihren Ausgang
und damit auch seine schöpfe^
rische Entwidmung zur Mei-
sterschaft im Schlagen des Sil-
bergefäßes. Das lag sicher auch
seinemGestaltungsdrang näher
als die wohl handwerklich bemerkenswerten und müh-
samen, aber doch künstlerisch nicht immer befriedigen^
den Arbeiten der Königszeit. Sicher ist aber der Qber-
gang von den ornamental und technisch kompliziertesten
Schöpfungen zu den klaren und scheinbar einfachsten
Formen gerade für deren organische Durchbildung
ebenso von grundlegendem Einfluß geblieben, wie die
restlose Vollendung des technischen Könnens, die er
aus der früheren Tätigkeit mitgebracht hatte. Diese
gibt doch erst die rechte Freiheit des Gestaltens und
setzt zugleich die unbewußten Grenzen, wo schwan-
kender Geschmadi oder gar aus der Theorie gezüchtete
silberner Gefäße von freiester
Form ist eine Kunst, die heute
nicht viele beherrschen, und
auch in damaliger Zeit war, ob-
wohl gerade dieWollenweber^
Werkstätte über tüchtige Kräfte
verfügte, die Silberschmiede^
und Treibtechnik nicht auf der
Höhe. Vor allem gebrach es
den alten Arbeitern an geläu-
tertem Formensinn und die
ganze Arbeitsweise war noch
zu sehr im Herkömmlichen be-
fangen. Hier fand Mayrhofer
ein dankbares Betätigungsfeld,
und er war längst die Seele der
Werkstatt, als ihm diese in
eigene Rechnung überlassen
wurde. Es entstanden aber
auch in dieser Zeit noch be-
deutsame Arbeiten älterer Art
aus seiner Hand. Mit am be-
kanntesten sind die NachbiU
düngen des Jamnitzer = Auf-
satzes für die Stadt Nürnberg
und der Mariensäule, als Ge-
schenk des Prinzregenten an
Papst Leo XIII.
Selbständig wurde Mayr-
hofer wieder 1903 und wid-
mete sich nun in der eigenen
Werkstätte überwiegend der
Silberschmiedearbeit. Eine sei-
ner ersten Arbeiten waren
kirchliche Geräte für das Mau-
soleum des Grafen Andrassy,
Verstandeskräfte versagen müssen. Das Aufziehen
A. VON MAYRHOFER POKAL es folgten dann eine Reihe von
Silber, gehämmert und ziseliert, mit Email Silbergefäßen aller Art, Kan-
nen, Platten, Schüsseln, Dosen,
Eßgeschirre, Teeservice in den bekannten gemessenen,
wohl durchgebildeten Formen. An den Erneuerungs-
bestrebungen, die um die Jahrhundertwende stürmisch
einsetzten, nahm Mayrhofer vollen Anteil. Er hat
sich in ernstem Streben unentwegt für die Fortent*
wicklung eingesetzt und ist auch damals zum Teil
stark von vorwärtsdrängenden Tendenzen beeinflußt
worden. Aber das Neue war ihm nie Selbstzweck, nie-
mals hätte er versucht, unorganisch auf willkürliche
Neuerungen aufzubauen. Dazu saß ihm ein gesunder
Schönheitssinn zu tief, auch hielt ihn ein lebendiges
Verständnis für das Material und gediegenes Können
vor fremdartigen Übereilungen zurüd<, woran jene
5
1883 bei Leyrer sonn« und
werktags durchgearbeitet wurde,
man fing um 4 Uhr früh an und
verließ zwischen 10 und 11 Uhr
abends die Werkstatt. Solche
unermüdliche Betriebsamkeit,
die von früh bis spät nur die
Arbeit kennt, ist dem jungen
Meister, der nun mit 191/s Jah-
ren ein eigenes Unternehmen
gründete, zeitlebens zu eigen
geblieben. Er hatte auch wei-
terhin, nachdem er durch sein
Können längst bekannt und
gesucht geworden war, alle
Hände voll zu tun, um mit
seinen acht Gehilfen den Auf-
trägen gerecht zu werden. Als
aber mit dem Tode König Lud-
wigs II. ein plötzlicher Still-
stand eintrat, zog er kurz ent-
schlössen die Konsequenzen
aus der veränderten Lage und
schloß nach drei Jahren seine
Werkstatt wieder.
Nach einer vorübergehen^
den Tätigkeit bei Riedinger in
Augsburg sehen wir Mayr-
hofer nun 12 Jahre lang bei
Wollen weberwirken Von hier
aus nimmt seine bald vorbilde
liehe Beherrschung der Silber-
schmiedetechnik ihren Ausgang
und damit auch seine schöpfe^
rische Entwidmung zur Mei-
sterschaft im Schlagen des Sil-
bergefäßes. Das lag sicher auch
seinemGestaltungsdrang näher
als die wohl handwerklich bemerkenswerten und müh-
samen, aber doch künstlerisch nicht immer befriedigen^
den Arbeiten der Königszeit. Sicher ist aber der Qber-
gang von den ornamental und technisch kompliziertesten
Schöpfungen zu den klaren und scheinbar einfachsten
Formen gerade für deren organische Durchbildung
ebenso von grundlegendem Einfluß geblieben, wie die
restlose Vollendung des technischen Könnens, die er
aus der früheren Tätigkeit mitgebracht hatte. Diese
gibt doch erst die rechte Freiheit des Gestaltens und
setzt zugleich die unbewußten Grenzen, wo schwan-
kender Geschmadi oder gar aus der Theorie gezüchtete
silberner Gefäße von freiester
Form ist eine Kunst, die heute
nicht viele beherrschen, und
auch in damaliger Zeit war, ob-
wohl gerade dieWollenweber^
Werkstätte über tüchtige Kräfte
verfügte, die Silberschmiede^
und Treibtechnik nicht auf der
Höhe. Vor allem gebrach es
den alten Arbeitern an geläu-
tertem Formensinn und die
ganze Arbeitsweise war noch
zu sehr im Herkömmlichen be-
fangen. Hier fand Mayrhofer
ein dankbares Betätigungsfeld,
und er war längst die Seele der
Werkstatt, als ihm diese in
eigene Rechnung überlassen
wurde. Es entstanden aber
auch in dieser Zeit noch be-
deutsame Arbeiten älterer Art
aus seiner Hand. Mit am be-
kanntesten sind die NachbiU
düngen des Jamnitzer = Auf-
satzes für die Stadt Nürnberg
und der Mariensäule, als Ge-
schenk des Prinzregenten an
Papst Leo XIII.
Selbständig wurde Mayr-
hofer wieder 1903 und wid-
mete sich nun in der eigenen
Werkstätte überwiegend der
Silberschmiedearbeit. Eine sei-
ner ersten Arbeiten waren
kirchliche Geräte für das Mau-
soleum des Grafen Andrassy,
Verstandeskräfte versagen müssen. Das Aufziehen
A. VON MAYRHOFER POKAL es folgten dann eine Reihe von
Silber, gehämmert und ziseliert, mit Email Silbergefäßen aller Art, Kan-
nen, Platten, Schüsseln, Dosen,
Eßgeschirre, Teeservice in den bekannten gemessenen,
wohl durchgebildeten Formen. An den Erneuerungs-
bestrebungen, die um die Jahrhundertwende stürmisch
einsetzten, nahm Mayrhofer vollen Anteil. Er hat
sich in ernstem Streben unentwegt für die Fortent*
wicklung eingesetzt und ist auch damals zum Teil
stark von vorwärtsdrängenden Tendenzen beeinflußt
worden. Aber das Neue war ihm nie Selbstzweck, nie-
mals hätte er versucht, unorganisch auf willkürliche
Neuerungen aufzubauen. Dazu saß ihm ein gesunder
Schönheitssinn zu tief, auch hielt ihn ein lebendiges
Verständnis für das Material und gediegenes Können
vor fremdartigen Übereilungen zurüd<, woran jene
5