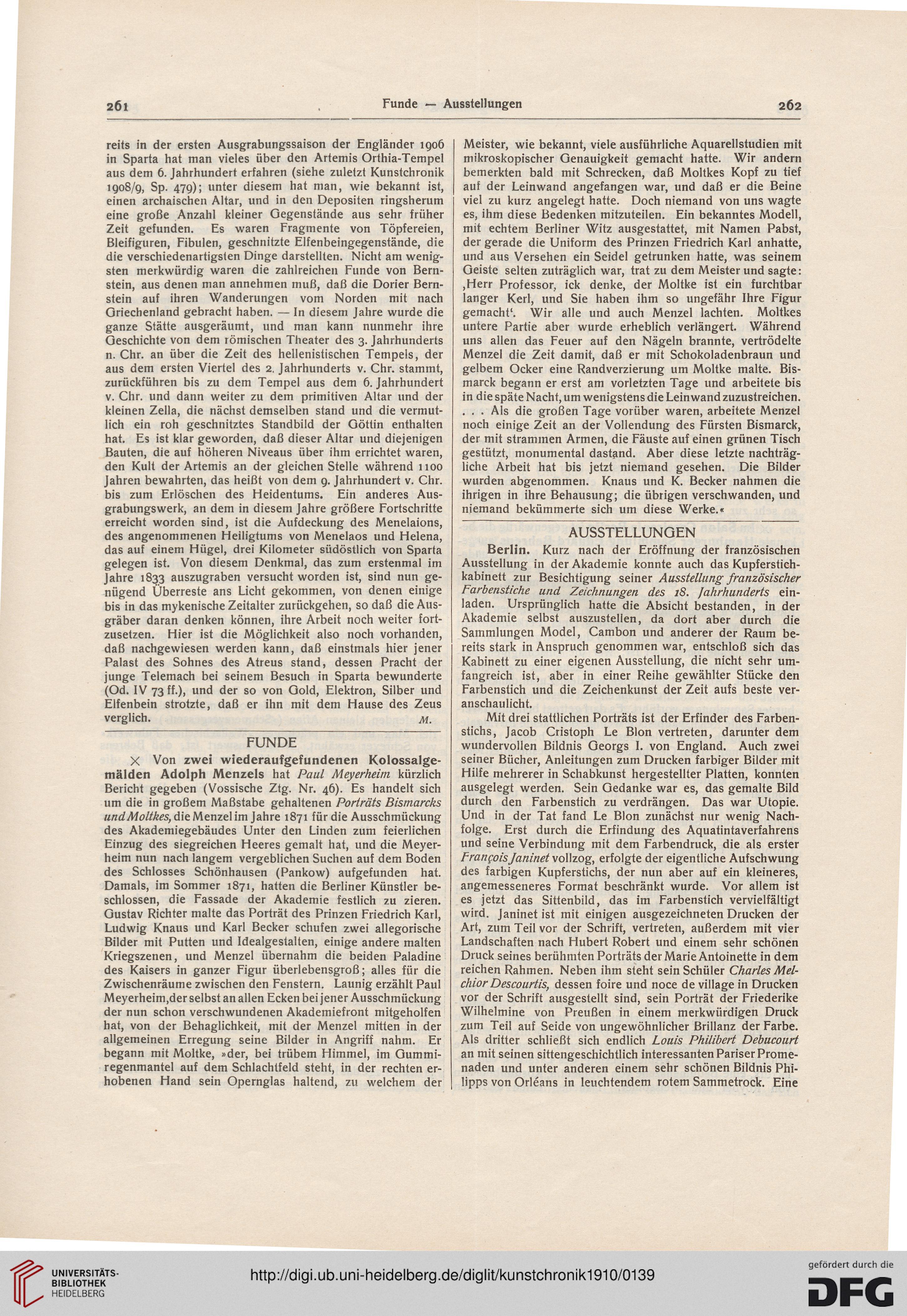26l
Funde — Ausstellungen
262
reits in der ersten Ausgrabungssaison der Engländer igoö
in Sparta hat man vieles über den Artemis Orthia-Tempel
aus dem 6. Jahrhundert erfahren (siehe zuletzt Kunstchronik
1908/g, Sp. 479); unter diesem hat man, wie bekannt ist,
einen archaischen Altar, und in den Depositen ringsherum
eine große Anzahl kleiner Gegenstände aus sehr früher
Zeit gefunden. Es waren Fragmente von Töpfereien,
Bleifiguren, Fibulen, geschnitzte Elfenbeingegenstände, die
die verschiedenartigsten Dinge darstellten. Nicht am wenig-
sten merkwürdig waren die zahlreichen Funde von Bern-
stein, aus denen man annehmen muß, daß die Dorier Bern-
stein auf ihren Wanderungen vom Norden mit nach
Griechenland gebracht haben. — In diesem Jahre wurde die
ganze Stätte ausgeräumt, und man kann nunmehr ihre
Geschichte von dem römischen Theater des 3. Jahrhunderts
n. Chr. an über die Zeit des hellenistischen Tempels, der
aus dem ersten Viertel des 2. Jahrhunderts v. Chr. stammt,
zurückführen bis zu dem Tempel aus dem 6. Jahrhundert
v. Chr. und dann weiter zu dem primitiven Altar und der
kleinen Zella, die nächst demselben stand und die vermut-
lich ein roh geschnitztes Standbild der Göttin enthalten
hat. Es ist klar geworden, daß dieser Altar und diejenigen
Bauten, die auf höheren Niveaus über ihm errichtet waren,
den Kult der Artemis an der gleichen Stelle während 1100
Jahren bewahrten, das heißt von dem 9. Jahrhundert v. Chr.
bis zum Erlöschen des Heidentums. Ein anderes Aus-
grabungswerk, an dem in diesem Jahre größere Fortschritte
erreicht worden sind, ist die Aufdeckung des Menelaions,
des angenommenen Heiligtums von Menelaos und Helena,
das auf einem Hügel, drei Kilometer südöstlich von Sparta
gelegen ist. Von diesem Denkmal, das zum erstenmal im
Jahre 1833 auszugraben versucht worden ist, sind nun ge-
nügend Überreste ans Licht gekommen, von denen einige
bis in das mykenische Zeitalter zurückgehen, so daß die Aus-
gräber daran denken können, ihre Arbeit noch weiter fort-
zusetzen. Hier ist die Möglichkeit also noch vorhanden,
daß nachgewiesen werden kann, daß einstmals hier jener
Palast des Sohnes des Atreus stand, dessen Pracht der
junge Telemach bei seinem Besuch in Sparta bewunderte
(Od. IV 73 ff.), und der so von Gold, Elektron, Silber und
Elfenbein strotzte, daß er ihn mit dem Hause des Zeus
verglich. m.
FUNDE
X Von zwei wiederaufgefundenen Kolossalge-
mälden Adolph Menzels hat Paul Meyerheim kürzlich
Bericht gegeben (Vossische Ztg. Nr. 46). Es handelt sich
um die in großem Maßstabe gehaltenen Porträts Bismarcks
undMoltkes, die Menzel im Jahre 1871 für die Ausschmückung
des Akademiegebäudes Unter den Linden zum feierlichen
Einzug des siegreichen Heeres gemalt hat, und die Meyer-
heim nun nach langem vergeblichen Suchen auf dem Boden
des Schlosses Schönhausen (Pankow) aufgefunden hat.
Damals, im Sommer 1871, hatten die Berliner Künstler be-
schlossen, die Fassade der Akademie festlich zu zieren.
Gustav Richter malte das Porträt des Prinzen Friedrich Karl,
Ludwig Knaus und Karl Becker schufen zwei allegorische
Bilder mit Putten und Idealgestalten, einige andere malten
Kriegszenen, und Menzel übernahm die beiden Paladine
des Kaisers in ganzer Figur überlebensgroß; alles für die
Zwischenräume zwischen den Fenstern. Launig erzählt Paul
Meyerheim.der selbst an allen Ecken bei jener Ausschmückung
der nun schon verschwundenen Akademiefront mitgeholfen
hat, von der Behaglichkeit, mit der Menzel mitten in der
allgemeinen Erregung seine Bilder in Angriff nahm. Er
begann mit Moltke, »der, bei trübem Himmel, im Gummi-
regenmantel auf dem Schlachtfeld steht, in der rechten er-
hobenen Hand sein Opernglas haltend, zu welchem der
Meister, wie bekannt, viele ausführliche Aquarellstudien mit
mikroskopischer Genauigkeit gemacht hatte. Wir andern
bemerkten bald mit Schrecken, daß Moltkes Kopf zu tief
auf der Leinwand angefangen war, und daß er die Beine
viel zu kurz angelegt hatte. Doch niemand von uns wagte
es, ihm diese Bedenken mitzuteilen. Ein bekanntes Modell,
mit echtem Berliner Witz ausgestattet, mit Namen Pabst,
der gerade die Uniform des Prinzen Friedrich Karl anhatte,
und aus Versehen ein Seidel getrunken hatte, was seinem
Geiste selten zuträglich war, trat zu dem Meister und sagte:
.Herr Professor, ick denke, der Moltke ist ein furchtbar
langer Kerl, und Sie haben ihm so ungefähr Ihre Figur
gemacht'. Wir alle und auch Menzel lachten. Moltkes
untere Partie aber wurde erheblich verlängert. Während
uns allen das Feuer auf den Nägeln brannte, vertrödelte
Menzel die Zeit damit, daß er mit Schokoladenbraun und
gelbem Ocker eine Randverzierung um Moltke malte. Bis-
marck begann er erst am vorletzten Tage und arbeitete bis
in die späte Nacht, um wenigstens die Leinwand zuzustreichen.
. . . Als die großen Tage vorüber waren, arbeitete Menzel
noch einige Zeit an der Vollendung des Fürsten Bismarck,
der mit strammen Armen, die Fäuste auf einen grünen Tisch
gestützt, monumental dastand. Aber diese letzte nachträg-
liche Arbeit hat bis jetzt niemand gesehen. Die Bilder
wurden abgenommen. Knaus und K. Becker nahmen die
ihrigen in ihre Behausung; die übrigen verschwanden, und
niemand bekümmerte sich um diese Werke.«
AUSSTELLUNGEN
Berlin. Kurz nach der Eröffnung der französischen
Ausstellung in der Akademie konnte auch das Kupferstich-
kabinett zur Besichtigung seiner Ausstellung französischer
Farbenstiche und Zeichnungen des 18. Jahrhunderts ein-
laden. Ursprünglich hatte die Absicht bestanden, in der
Akademie selbst auszustehen, da dort aber durch die
Sammlungen Model, Cambon und anderer der Raum be-
reits stark in Anspruch genommen war, entschloß sich das
Kabinett zu einer eigenen Ausstellung, die nicht sehr um-
fangreich ist, aber in einer Reihe gewählter Stücke den
Farbenstich und die Zeichenkunst der Zeit aufs beste ver-
anschaulicht.
Mit drei stattlichen Porträts ist der Erfinder des Farben-
stichs, Jacob Cristoph Le Blon vertreten, darunter dem
wundervollen Bildnis Georgs I. von England. Auch zwei
seiner Bücher, Anleitungen zum Drucken farbiger Bilder mit
Hilfe mehrerer in Schabkunst hergestellter Platten, konnten
ausgelegt werden. Sein Gedanke war es, das gemalte Bild
durch den Farbenstich zu verdrängen. Das war Utopie.
Und in der Tat fand Le Blon zunächst nur wenig Nach-
folge. Erst durch die Erfindung des Aquatintaverfahrens
und seine Verbindung mit dem Farbendruck, die als erster
FrancoisJaninet vollzog, erfolgte der eigentliche Aufschwung
des farbigen Kupferstichs, der nun aber auf ein kleineres,
angemesseneres Format beschränkt wurde. Vor allem ist
es jetzt das Sittenbild, das im Farbenstich vervielfältigt
wird. Janinet ist mit einigen ausgezeichneten Drucken der
Art, zum Teil vor der Schrift, vertreten, außerdem mit vier
Landschaften nach Hubert Robert und einem sehr schönen
Druck seines berühmten Porträts der Marie Antoinette in dem
reichen Rahmen. Neben ihm steht sein Schüler Charles Mel-
chior Descourtis, dessen foire und noce de village in Drucken
vor der Schrift ausgestellt sind, sein Porträt der Friederike
Wilhelmine von Preußen in einem merkwürdigen Druck
zum Teil auf Seide von ungewöhnlicher Brillanz der Farbe.
Als dritter schließt sich endlich Louis Philibert Debucourt
an mit seinen sittengeschichtlich interessanten Pariser Prome-
naden und unter anderen einem sehr schönen Bildnis Phi-
lipps von Orleans in leuchtendem rotem Sammetrock. Eine
Funde — Ausstellungen
262
reits in der ersten Ausgrabungssaison der Engländer igoö
in Sparta hat man vieles über den Artemis Orthia-Tempel
aus dem 6. Jahrhundert erfahren (siehe zuletzt Kunstchronik
1908/g, Sp. 479); unter diesem hat man, wie bekannt ist,
einen archaischen Altar, und in den Depositen ringsherum
eine große Anzahl kleiner Gegenstände aus sehr früher
Zeit gefunden. Es waren Fragmente von Töpfereien,
Bleifiguren, Fibulen, geschnitzte Elfenbeingegenstände, die
die verschiedenartigsten Dinge darstellten. Nicht am wenig-
sten merkwürdig waren die zahlreichen Funde von Bern-
stein, aus denen man annehmen muß, daß die Dorier Bern-
stein auf ihren Wanderungen vom Norden mit nach
Griechenland gebracht haben. — In diesem Jahre wurde die
ganze Stätte ausgeräumt, und man kann nunmehr ihre
Geschichte von dem römischen Theater des 3. Jahrhunderts
n. Chr. an über die Zeit des hellenistischen Tempels, der
aus dem ersten Viertel des 2. Jahrhunderts v. Chr. stammt,
zurückführen bis zu dem Tempel aus dem 6. Jahrhundert
v. Chr. und dann weiter zu dem primitiven Altar und der
kleinen Zella, die nächst demselben stand und die vermut-
lich ein roh geschnitztes Standbild der Göttin enthalten
hat. Es ist klar geworden, daß dieser Altar und diejenigen
Bauten, die auf höheren Niveaus über ihm errichtet waren,
den Kult der Artemis an der gleichen Stelle während 1100
Jahren bewahrten, das heißt von dem 9. Jahrhundert v. Chr.
bis zum Erlöschen des Heidentums. Ein anderes Aus-
grabungswerk, an dem in diesem Jahre größere Fortschritte
erreicht worden sind, ist die Aufdeckung des Menelaions,
des angenommenen Heiligtums von Menelaos und Helena,
das auf einem Hügel, drei Kilometer südöstlich von Sparta
gelegen ist. Von diesem Denkmal, das zum erstenmal im
Jahre 1833 auszugraben versucht worden ist, sind nun ge-
nügend Überreste ans Licht gekommen, von denen einige
bis in das mykenische Zeitalter zurückgehen, so daß die Aus-
gräber daran denken können, ihre Arbeit noch weiter fort-
zusetzen. Hier ist die Möglichkeit also noch vorhanden,
daß nachgewiesen werden kann, daß einstmals hier jener
Palast des Sohnes des Atreus stand, dessen Pracht der
junge Telemach bei seinem Besuch in Sparta bewunderte
(Od. IV 73 ff.), und der so von Gold, Elektron, Silber und
Elfenbein strotzte, daß er ihn mit dem Hause des Zeus
verglich. m.
FUNDE
X Von zwei wiederaufgefundenen Kolossalge-
mälden Adolph Menzels hat Paul Meyerheim kürzlich
Bericht gegeben (Vossische Ztg. Nr. 46). Es handelt sich
um die in großem Maßstabe gehaltenen Porträts Bismarcks
undMoltkes, die Menzel im Jahre 1871 für die Ausschmückung
des Akademiegebäudes Unter den Linden zum feierlichen
Einzug des siegreichen Heeres gemalt hat, und die Meyer-
heim nun nach langem vergeblichen Suchen auf dem Boden
des Schlosses Schönhausen (Pankow) aufgefunden hat.
Damals, im Sommer 1871, hatten die Berliner Künstler be-
schlossen, die Fassade der Akademie festlich zu zieren.
Gustav Richter malte das Porträt des Prinzen Friedrich Karl,
Ludwig Knaus und Karl Becker schufen zwei allegorische
Bilder mit Putten und Idealgestalten, einige andere malten
Kriegszenen, und Menzel übernahm die beiden Paladine
des Kaisers in ganzer Figur überlebensgroß; alles für die
Zwischenräume zwischen den Fenstern. Launig erzählt Paul
Meyerheim.der selbst an allen Ecken bei jener Ausschmückung
der nun schon verschwundenen Akademiefront mitgeholfen
hat, von der Behaglichkeit, mit der Menzel mitten in der
allgemeinen Erregung seine Bilder in Angriff nahm. Er
begann mit Moltke, »der, bei trübem Himmel, im Gummi-
regenmantel auf dem Schlachtfeld steht, in der rechten er-
hobenen Hand sein Opernglas haltend, zu welchem der
Meister, wie bekannt, viele ausführliche Aquarellstudien mit
mikroskopischer Genauigkeit gemacht hatte. Wir andern
bemerkten bald mit Schrecken, daß Moltkes Kopf zu tief
auf der Leinwand angefangen war, und daß er die Beine
viel zu kurz angelegt hatte. Doch niemand von uns wagte
es, ihm diese Bedenken mitzuteilen. Ein bekanntes Modell,
mit echtem Berliner Witz ausgestattet, mit Namen Pabst,
der gerade die Uniform des Prinzen Friedrich Karl anhatte,
und aus Versehen ein Seidel getrunken hatte, was seinem
Geiste selten zuträglich war, trat zu dem Meister und sagte:
.Herr Professor, ick denke, der Moltke ist ein furchtbar
langer Kerl, und Sie haben ihm so ungefähr Ihre Figur
gemacht'. Wir alle und auch Menzel lachten. Moltkes
untere Partie aber wurde erheblich verlängert. Während
uns allen das Feuer auf den Nägeln brannte, vertrödelte
Menzel die Zeit damit, daß er mit Schokoladenbraun und
gelbem Ocker eine Randverzierung um Moltke malte. Bis-
marck begann er erst am vorletzten Tage und arbeitete bis
in die späte Nacht, um wenigstens die Leinwand zuzustreichen.
. . . Als die großen Tage vorüber waren, arbeitete Menzel
noch einige Zeit an der Vollendung des Fürsten Bismarck,
der mit strammen Armen, die Fäuste auf einen grünen Tisch
gestützt, monumental dastand. Aber diese letzte nachträg-
liche Arbeit hat bis jetzt niemand gesehen. Die Bilder
wurden abgenommen. Knaus und K. Becker nahmen die
ihrigen in ihre Behausung; die übrigen verschwanden, und
niemand bekümmerte sich um diese Werke.«
AUSSTELLUNGEN
Berlin. Kurz nach der Eröffnung der französischen
Ausstellung in der Akademie konnte auch das Kupferstich-
kabinett zur Besichtigung seiner Ausstellung französischer
Farbenstiche und Zeichnungen des 18. Jahrhunderts ein-
laden. Ursprünglich hatte die Absicht bestanden, in der
Akademie selbst auszustehen, da dort aber durch die
Sammlungen Model, Cambon und anderer der Raum be-
reits stark in Anspruch genommen war, entschloß sich das
Kabinett zu einer eigenen Ausstellung, die nicht sehr um-
fangreich ist, aber in einer Reihe gewählter Stücke den
Farbenstich und die Zeichenkunst der Zeit aufs beste ver-
anschaulicht.
Mit drei stattlichen Porträts ist der Erfinder des Farben-
stichs, Jacob Cristoph Le Blon vertreten, darunter dem
wundervollen Bildnis Georgs I. von England. Auch zwei
seiner Bücher, Anleitungen zum Drucken farbiger Bilder mit
Hilfe mehrerer in Schabkunst hergestellter Platten, konnten
ausgelegt werden. Sein Gedanke war es, das gemalte Bild
durch den Farbenstich zu verdrängen. Das war Utopie.
Und in der Tat fand Le Blon zunächst nur wenig Nach-
folge. Erst durch die Erfindung des Aquatintaverfahrens
und seine Verbindung mit dem Farbendruck, die als erster
FrancoisJaninet vollzog, erfolgte der eigentliche Aufschwung
des farbigen Kupferstichs, der nun aber auf ein kleineres,
angemesseneres Format beschränkt wurde. Vor allem ist
es jetzt das Sittenbild, das im Farbenstich vervielfältigt
wird. Janinet ist mit einigen ausgezeichneten Drucken der
Art, zum Teil vor der Schrift, vertreten, außerdem mit vier
Landschaften nach Hubert Robert und einem sehr schönen
Druck seines berühmten Porträts der Marie Antoinette in dem
reichen Rahmen. Neben ihm steht sein Schüler Charles Mel-
chior Descourtis, dessen foire und noce de village in Drucken
vor der Schrift ausgestellt sind, sein Porträt der Friederike
Wilhelmine von Preußen in einem merkwürdigen Druck
zum Teil auf Seide von ungewöhnlicher Brillanz der Farbe.
Als dritter schließt sich endlich Louis Philibert Debucourt
an mit seinen sittengeschichtlich interessanten Pariser Prome-
naden und unter anderen einem sehr schönen Bildnis Phi-
lipps von Orleans in leuchtendem rotem Sammetrock. Eine