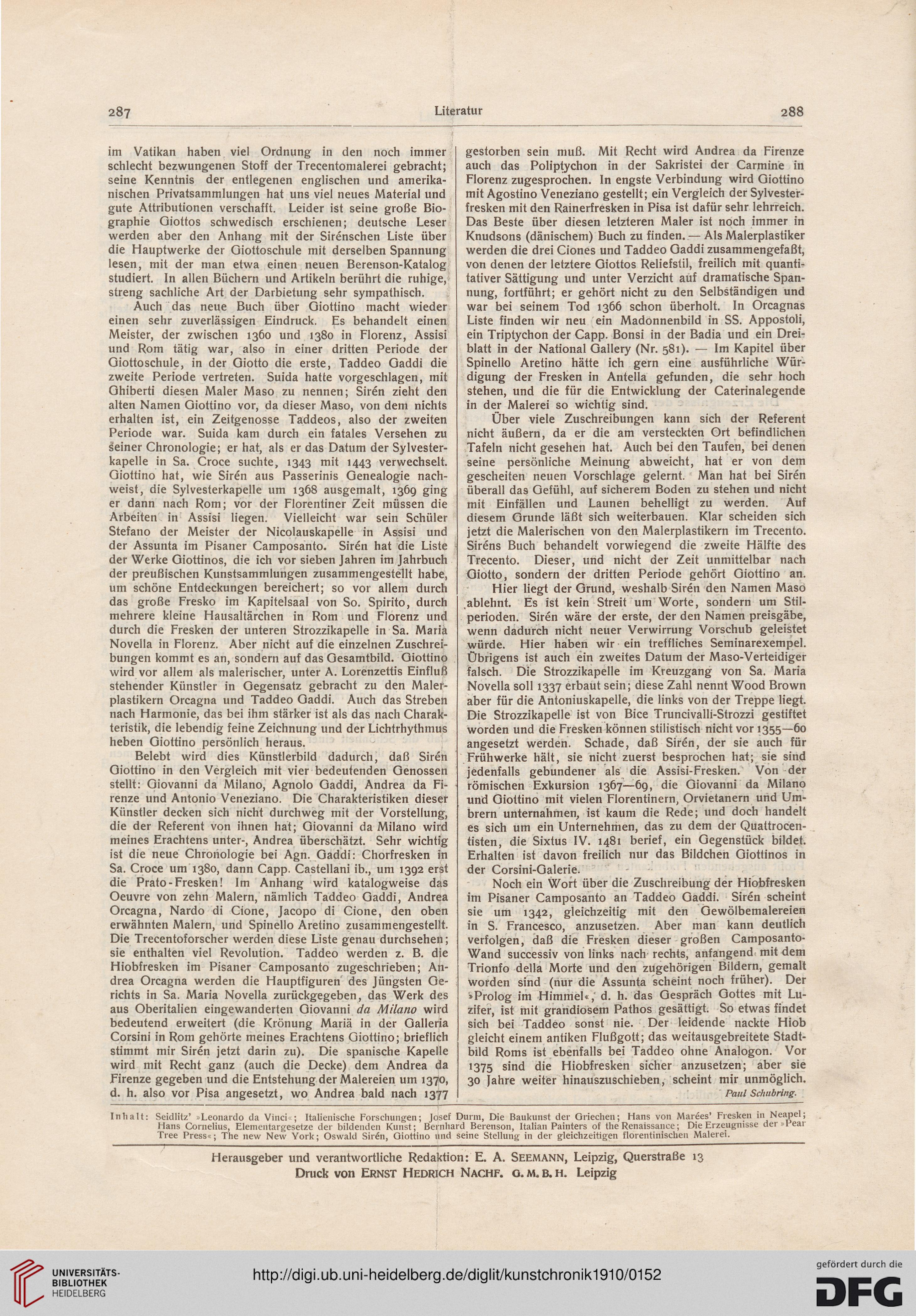287
Literatur
288
im Vatikan haben viel Ordnung in den noch immer
schlecht bezwungenen Stoff der Trecentomalerei gebracht;
seine Kenntnis der entlegenen englischen und amerika-
nischen Privatsammlungen hat uns viel neues Material und
gute Attributionen verschafft. Leider ist seine große Bio-
graphie Qiottos schwedisch erschienen; deutsche Leser
werden aber den Anhang mit der Sirenschen Liste über
die Hauptwerke der Giottoschule mit derselben Spannung
lesen, mit der man etwa einen neuen Berenson-Katalog
studiert. In allen Büchern und Artikeln berührt die ruhige,
streng sachliche Art der Darbietung sehr sympathisch.
Auch das neue Buch über Giottino macht wieder
einen sehr zuverlässigen Eindruck. Es behandelt einen
Meister, der zwischen 1360 und 1380 in Florenz, Assisi
und Rom tätig war, also in einer dritten Periode der
Giottoschule, in der Giotto die erste, Taddeo Gaddi die
zweite Periode vertreten. Suida hatte vorgeschlagen, mit
Ghiberti diesen Maler Maso zu nennen; Siren zieht den
alten Namen Giottino vor, da dieser Maso, von dem nichts
erhalten ist, ein Zeitgenosse Taddeos, also der zweiten
Periode war. Suida kam durch ein fatales Versehen zu
seiner Chronologie; er hat, als er das Datum der Sylvester-
kapelle in Sa. Croce suchte, 1343 mit 1443 verwechselt.
Giottino hat, wie Siren aus Passerinis Genealogie nach-
weist, die Sylvesterkapelle um 1368 ausgemalt, 1369 ging
er dann nach Rom; vor der Florentiner Zeit müssen die
Arbeiten in Assisi liegen. Vielleicht war sein Schüler
Stefano der Meister der Nicolauskapelle in Assisi und
der Assunta im Pisaner Camposanto. Sir£n hat die Liste
der Werke Giottinos, die ich vor sieben Jahren im Jahrbuch
der preußischen Kunstsammlungen zusammengestellt habe,
um schöne Entdeckungen bereichert; so vor allem durch
das große Fresko im Kapitelsaal von So. Spirito, durch
mehrere kleine Hausaltärchen in Rom und Florenz und
durch die Fresken der unteren Strozzikapelle in Sa. Maria
Novella in Florenz. Aber nicht auf die einzelnen Zuschrei-
bungen kommt es an, sondern auf das Gesamtbild. Giottino
wird vor allem als malerischer, unter A. Lorenzettis Einfluß
stehender Künstler in Gegensatz gebracht zu den Maler-
plastikern Orcagna und Taddeo Gaddi. Auch das Streben
nach Harmonie, das bei ihm stärker ist als das nach Charak-
teristik, die lebendig feine Zeichnung und der Lichtrhythmus
heben Giottino persönlich heraus.
Belebt wird dies Künstlerbild dadurch, daß Siren
Giottino in den Vergleich mit vier bedeutenden Genossen
stellt: Giovanni da Milano, Agnolo Gaddi, Andrea da Fi-
renze und Antonio Veneziano. Die Charakteristiken dieser
Künstler decken sich nicht durchweg mit der Vorstellung,
die der Referent von ihnen hat; Giovanni da Milano wird
meines Erachtens unter-, Andrea überschätzt. Sehr wichtig
ist die neue Chronologie bei Agn. Gaddi: Chorfresken in
Sa. Croce um 1380, dann Capp. Castellani ib., um 1392 erst
die Prato-Fresken! Im Anhang wird katalogweise das
Oeuvre von zehn Malern, nämlich Taddeo Gaddi, Andrea
Orcagna, Nardo di Cione, Jacopo di Cione, den oben
erwähnten Malern, und Spinello Aretino zusammengestellt.
Die Trecentoforscher werden diese Liste genau durchsehen;
sie enthalten viel Revolution. Taddeo werden z. B. die
Hiobfresken im Pisaner Camposanto zugeschrieben; An-
drea Orcagna werden die Hauptfiguren des Jüngsten Ge-
richts in Sa. Maria Novella zurückgegeben, das Werk des
aus Oberitalien eingewanderten Giovanni da Milano wird
bedeutend erweitert (die Krönung Mariä in der Galleria
Corsini in Rom gehörte meines Erachtens Giottino; brieflich
stimmt mir Siren jetzt darin zu). Die spanische Kapelle
wird mit Recht ganz (auch die Decke) dem Andrea da
Firenze gegeben und die Entstehung der Malereien um 1370,
d. h. also vor Pisa angesetzt, wo Andrea bald nach 1377
gestorben sein muß. Mit Recht wird Andrea da Firenze
auch das Poliptychon in der Sakristei der Carmine in
Florenz zugesprochen. In engste Verbindung wird Giottino
mit Agostino Veneziano gestellt; ein Vergleich der Sylvester-
fresken mit den Rainerfresken in Pisa ist dafür sehr lehrreich.
Das Beste über diesen letzteren Maler ist noch immer in
Knudsons (dänischem) Buch zu finden. — Als Malerplastiker
werden die drei Ciones und Taddeo Gaddi zusammengefaßt,
von denen der letztere Giottos Reliefstil, freilich mit quanti-
tativer Sättigung und unter Verzicht auf dramatische Span-
nung, fortführt; er gehört nicht zu den Selbständigen und
war bei seinem Tod 1366 schon überholt. In Orcagnas
Liste finden wir neu ein Madonnenbild in SS. Appostoli,
ein Triptychon der Capp. Bonsi in der Badia und ein Drei-
blatt in der National Gallery (Nr. 581). — Im Kapitel über
Spinello Aretino hätte ich gern eine ausführliche Wür-
digung der Fresken in Antella gefunden, die sehr hoch
stehen, und die für die Entwicklung der Caterinalegende
in der Malerei so wichtig sind.
Über viele Zuschreibungen kann sich der Referent
nicht äußern, da er die am versteckten Ort befindlichen
Tafeln nicht gesehen hat. Auch bei den Taufen, bei denen
seine persönliche Meinung abweicht, hat er von dem
gescheiten neuen Vorschlage gelernt. Man hat bei Siren
überall das Gefühl, auf sicherem Boden zu stehen und nicht
mit Einfällen und Launen behelligt zu werden. Auf
diesem Grunde läßt sich weiterbauen. Klar scheiden sich
jetzt die Malerischen von den Malerplastikern im Trecento.
Sirens Buch behandelt vorwiegend die zweite Hälfte des
Trecento. Dieser, und nicht der Zeit unmittelbar nach
Giotto, sondern der dritten Periode gehört Giottino an.
Hier liegt der Grund, weshalb Siren den Namen Maso
.ablehnt. Es ist kein Streit um Worte, sondern um Stil-
perioden. Siren wäre der erste, der den Namen preisgäbe,
wenn dadurch nicht neuer Verwirrung Vorschub geleistet
würde. Hier haben wir ein treffliches Seminarexempel.
Übrigens ist auch ein zweites Datum der Maso-Verteidiger
falsch. Die Strozzikapelle im Kreuzgang von Sa. Maria
Novella soll 1337 erbaut sein; diese Zahl nennt Wood Brown
aber für die Antoniuskapelle, die links von der Treppe liegt.
Die Strozzikapelle ist von Bice Truncivalli-Strozzi gestiftet
worden und die Fresken können stilistisch nicht vor 1355—60
angesetzt werden. Schade, daß Siren, der sie auch für
Frühwerke hält, sie nicht zuerst besprochen hat; sie sind
jedenfalls gebundener als die Assisi-Fresken. Von der
römischen Exkursion 1367—69, die Giovanni da Milano
und Giottino mit vielen Florentinern, Orvietanern und Um-
brern unternahmen, ist kaum die Rede; und doch handelt
es sich um ein Unternehmen, das zu dem der Quattrocen-
tisten, die Sixtus IV. 1481 berief, ein Gegenstück bildet.
Erhalten ist davon freilich nur das Bildchen Giottinos in
der Corsini-Galerie.
Noch ein Wort über die Zuschreibung der Hiobfresken
im Pisaner Camposanto an Taddeo Gaddi. Siren scheint
sie um 1342, gleichzeitig mit den Gewölbemalereien
in S. Francesco, anzusetzen. Aber man kann deutlich
verfolgen, daß die Fresken dieser großen Camposanto-
Wand successiv von links nach rechts, anfangend mit dem
Trionfo della Morte und den zugehörigen Bildern, gemalt
worden sind (nur die Assunta scheint noch früher). Der
»Prolog im Himmel«, d. h. das Gespräch Gottes mit Lu-
zifer, ist mit grandiosem Pathos gesättigt. So etwas findet
sich bei Taddeo sonst nie. Der leidende nackte Hiob
gleicht einem antiken Flußgott; das weitausgebreitete Stadt-
bild Roms ist ebenfalls bei Taddeo ohne Analogon. Vor
1375 sind die Hiobfresken sicher anzusetzen; aber sie
30 fahre weiter hinauszuschieben, scheint mir unmöglich.
Paul Schubring.
Inhalt: Seidlitz' »Leonardo da Vinci ; Italienische Forschungen; Josef Durra, Die Baukunst der Griechen; Hans von Marees' Fresken in Neapel;
Hans Cornelius, Elementargesetze der bildenden Kunst; Bernhard Berenson, Italian Painters of the Renaissance; Die Erzeugnisse der»lear
Tree Press«; The new New York; Oswald Sirin, Giottino und seine Stellung in der gleichzeitigen florentinischen Malerei.
Herausgeber und verantwortliche Redaktion: E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13
Druck von Ernst Hedrich Nachf. o. m. b. h. Leipzig
Literatur
288
im Vatikan haben viel Ordnung in den noch immer
schlecht bezwungenen Stoff der Trecentomalerei gebracht;
seine Kenntnis der entlegenen englischen und amerika-
nischen Privatsammlungen hat uns viel neues Material und
gute Attributionen verschafft. Leider ist seine große Bio-
graphie Qiottos schwedisch erschienen; deutsche Leser
werden aber den Anhang mit der Sirenschen Liste über
die Hauptwerke der Giottoschule mit derselben Spannung
lesen, mit der man etwa einen neuen Berenson-Katalog
studiert. In allen Büchern und Artikeln berührt die ruhige,
streng sachliche Art der Darbietung sehr sympathisch.
Auch das neue Buch über Giottino macht wieder
einen sehr zuverlässigen Eindruck. Es behandelt einen
Meister, der zwischen 1360 und 1380 in Florenz, Assisi
und Rom tätig war, also in einer dritten Periode der
Giottoschule, in der Giotto die erste, Taddeo Gaddi die
zweite Periode vertreten. Suida hatte vorgeschlagen, mit
Ghiberti diesen Maler Maso zu nennen; Siren zieht den
alten Namen Giottino vor, da dieser Maso, von dem nichts
erhalten ist, ein Zeitgenosse Taddeos, also der zweiten
Periode war. Suida kam durch ein fatales Versehen zu
seiner Chronologie; er hat, als er das Datum der Sylvester-
kapelle in Sa. Croce suchte, 1343 mit 1443 verwechselt.
Giottino hat, wie Siren aus Passerinis Genealogie nach-
weist, die Sylvesterkapelle um 1368 ausgemalt, 1369 ging
er dann nach Rom; vor der Florentiner Zeit müssen die
Arbeiten in Assisi liegen. Vielleicht war sein Schüler
Stefano der Meister der Nicolauskapelle in Assisi und
der Assunta im Pisaner Camposanto. Sir£n hat die Liste
der Werke Giottinos, die ich vor sieben Jahren im Jahrbuch
der preußischen Kunstsammlungen zusammengestellt habe,
um schöne Entdeckungen bereichert; so vor allem durch
das große Fresko im Kapitelsaal von So. Spirito, durch
mehrere kleine Hausaltärchen in Rom und Florenz und
durch die Fresken der unteren Strozzikapelle in Sa. Maria
Novella in Florenz. Aber nicht auf die einzelnen Zuschrei-
bungen kommt es an, sondern auf das Gesamtbild. Giottino
wird vor allem als malerischer, unter A. Lorenzettis Einfluß
stehender Künstler in Gegensatz gebracht zu den Maler-
plastikern Orcagna und Taddeo Gaddi. Auch das Streben
nach Harmonie, das bei ihm stärker ist als das nach Charak-
teristik, die lebendig feine Zeichnung und der Lichtrhythmus
heben Giottino persönlich heraus.
Belebt wird dies Künstlerbild dadurch, daß Siren
Giottino in den Vergleich mit vier bedeutenden Genossen
stellt: Giovanni da Milano, Agnolo Gaddi, Andrea da Fi-
renze und Antonio Veneziano. Die Charakteristiken dieser
Künstler decken sich nicht durchweg mit der Vorstellung,
die der Referent von ihnen hat; Giovanni da Milano wird
meines Erachtens unter-, Andrea überschätzt. Sehr wichtig
ist die neue Chronologie bei Agn. Gaddi: Chorfresken in
Sa. Croce um 1380, dann Capp. Castellani ib., um 1392 erst
die Prato-Fresken! Im Anhang wird katalogweise das
Oeuvre von zehn Malern, nämlich Taddeo Gaddi, Andrea
Orcagna, Nardo di Cione, Jacopo di Cione, den oben
erwähnten Malern, und Spinello Aretino zusammengestellt.
Die Trecentoforscher werden diese Liste genau durchsehen;
sie enthalten viel Revolution. Taddeo werden z. B. die
Hiobfresken im Pisaner Camposanto zugeschrieben; An-
drea Orcagna werden die Hauptfiguren des Jüngsten Ge-
richts in Sa. Maria Novella zurückgegeben, das Werk des
aus Oberitalien eingewanderten Giovanni da Milano wird
bedeutend erweitert (die Krönung Mariä in der Galleria
Corsini in Rom gehörte meines Erachtens Giottino; brieflich
stimmt mir Siren jetzt darin zu). Die spanische Kapelle
wird mit Recht ganz (auch die Decke) dem Andrea da
Firenze gegeben und die Entstehung der Malereien um 1370,
d. h. also vor Pisa angesetzt, wo Andrea bald nach 1377
gestorben sein muß. Mit Recht wird Andrea da Firenze
auch das Poliptychon in der Sakristei der Carmine in
Florenz zugesprochen. In engste Verbindung wird Giottino
mit Agostino Veneziano gestellt; ein Vergleich der Sylvester-
fresken mit den Rainerfresken in Pisa ist dafür sehr lehrreich.
Das Beste über diesen letzteren Maler ist noch immer in
Knudsons (dänischem) Buch zu finden. — Als Malerplastiker
werden die drei Ciones und Taddeo Gaddi zusammengefaßt,
von denen der letztere Giottos Reliefstil, freilich mit quanti-
tativer Sättigung und unter Verzicht auf dramatische Span-
nung, fortführt; er gehört nicht zu den Selbständigen und
war bei seinem Tod 1366 schon überholt. In Orcagnas
Liste finden wir neu ein Madonnenbild in SS. Appostoli,
ein Triptychon der Capp. Bonsi in der Badia und ein Drei-
blatt in der National Gallery (Nr. 581). — Im Kapitel über
Spinello Aretino hätte ich gern eine ausführliche Wür-
digung der Fresken in Antella gefunden, die sehr hoch
stehen, und die für die Entwicklung der Caterinalegende
in der Malerei so wichtig sind.
Über viele Zuschreibungen kann sich der Referent
nicht äußern, da er die am versteckten Ort befindlichen
Tafeln nicht gesehen hat. Auch bei den Taufen, bei denen
seine persönliche Meinung abweicht, hat er von dem
gescheiten neuen Vorschlage gelernt. Man hat bei Siren
überall das Gefühl, auf sicherem Boden zu stehen und nicht
mit Einfällen und Launen behelligt zu werden. Auf
diesem Grunde läßt sich weiterbauen. Klar scheiden sich
jetzt die Malerischen von den Malerplastikern im Trecento.
Sirens Buch behandelt vorwiegend die zweite Hälfte des
Trecento. Dieser, und nicht der Zeit unmittelbar nach
Giotto, sondern der dritten Periode gehört Giottino an.
Hier liegt der Grund, weshalb Siren den Namen Maso
.ablehnt. Es ist kein Streit um Worte, sondern um Stil-
perioden. Siren wäre der erste, der den Namen preisgäbe,
wenn dadurch nicht neuer Verwirrung Vorschub geleistet
würde. Hier haben wir ein treffliches Seminarexempel.
Übrigens ist auch ein zweites Datum der Maso-Verteidiger
falsch. Die Strozzikapelle im Kreuzgang von Sa. Maria
Novella soll 1337 erbaut sein; diese Zahl nennt Wood Brown
aber für die Antoniuskapelle, die links von der Treppe liegt.
Die Strozzikapelle ist von Bice Truncivalli-Strozzi gestiftet
worden und die Fresken können stilistisch nicht vor 1355—60
angesetzt werden. Schade, daß Siren, der sie auch für
Frühwerke hält, sie nicht zuerst besprochen hat; sie sind
jedenfalls gebundener als die Assisi-Fresken. Von der
römischen Exkursion 1367—69, die Giovanni da Milano
und Giottino mit vielen Florentinern, Orvietanern und Um-
brern unternahmen, ist kaum die Rede; und doch handelt
es sich um ein Unternehmen, das zu dem der Quattrocen-
tisten, die Sixtus IV. 1481 berief, ein Gegenstück bildet.
Erhalten ist davon freilich nur das Bildchen Giottinos in
der Corsini-Galerie.
Noch ein Wort über die Zuschreibung der Hiobfresken
im Pisaner Camposanto an Taddeo Gaddi. Siren scheint
sie um 1342, gleichzeitig mit den Gewölbemalereien
in S. Francesco, anzusetzen. Aber man kann deutlich
verfolgen, daß die Fresken dieser großen Camposanto-
Wand successiv von links nach rechts, anfangend mit dem
Trionfo della Morte und den zugehörigen Bildern, gemalt
worden sind (nur die Assunta scheint noch früher). Der
»Prolog im Himmel«, d. h. das Gespräch Gottes mit Lu-
zifer, ist mit grandiosem Pathos gesättigt. So etwas findet
sich bei Taddeo sonst nie. Der leidende nackte Hiob
gleicht einem antiken Flußgott; das weitausgebreitete Stadt-
bild Roms ist ebenfalls bei Taddeo ohne Analogon. Vor
1375 sind die Hiobfresken sicher anzusetzen; aber sie
30 fahre weiter hinauszuschieben, scheint mir unmöglich.
Paul Schubring.
Inhalt: Seidlitz' »Leonardo da Vinci ; Italienische Forschungen; Josef Durra, Die Baukunst der Griechen; Hans von Marees' Fresken in Neapel;
Hans Cornelius, Elementargesetze der bildenden Kunst; Bernhard Berenson, Italian Painters of the Renaissance; Die Erzeugnisse der»lear
Tree Press«; The new New York; Oswald Sirin, Giottino und seine Stellung in der gleichzeitigen florentinischen Malerei.
Herausgeber und verantwortliche Redaktion: E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13
Druck von Ernst Hedrich Nachf. o. m. b. h. Leipzig