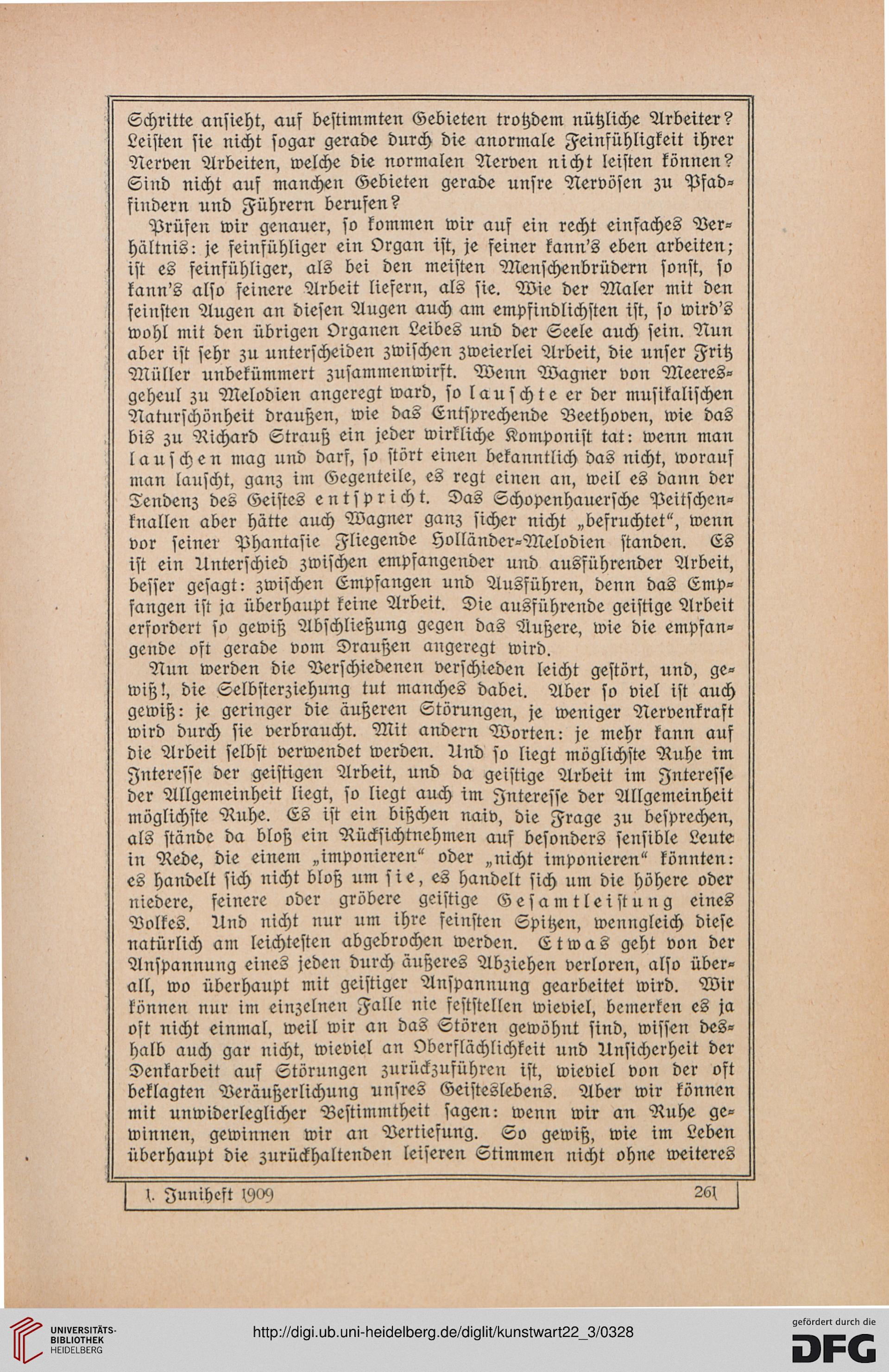Schritte ansieht, auf bestimmten Gebieten trotzdem nützliche Arbeiter?
Leisten sie nicht sogar gerade dnrch die anormale Feinfühligkeit ihrer
Nerven Arbeiten, welche die normalen Nerven nicht leisten können?
Sind nicht auf manchen Gebieten gerade unsre Nervösen zu Pfad-
findern und Führern berufen?
Prüfen wir genauer, so kommen wir auf ein recht einfaches Ver--
hältnis: je feinfühliger ein Organ ist, je feiner kann's eben arbeiten,-
ist es feinfühliger, als bei den meisten Menschenbrüdern sonst, so
kann's also feinere Arbeit liefern, als sie. Wie der Maler mit den
feinsten Augen an diesen Augen auch am empsindlichsten ist, so wird's
wohl mit den übrigen Organen Leibes und der Seele auch sein. Nun
aber ist sehr zu unterscheiden zwischen zweierlei Arbeit, die unser Fritz
Müller unbekümmert zusammenwirft. Wenn Wagner von Meeres-
geheul zu Melodien angeregt ward, so lauschte er der musikalischen
Naturschönheit draußen, wie das Entsprechende Beethoven, wie das
bis zu Richard Strauß ein jeder wirkliche Komponist tat: wenn man
lauschen mag und darf, so stört einen bekanntlich das nicht, worauf
man lauscht, ganz im Gegenteile, es regt einen an, weil es dann der
Tendenz des Geistes entspricht. Das Schopenhauersche Peitschen-
knallen aber hätte auch Wagner ganz sicher nicht „befruchtet", wenn
vor seiner Phantasie Fliegende Holländer-Melodien standen. Es
ist ein Unterschied zwischen empfangender und ausführender Arbeit,
besser gesagt: zwischen Empfangen und Ausführen, denn das Emp-
fangen ist ja überhaupt keine Arbeit. Die ausführende geistige Arbeit
erfordert so gewiß Abschließung gegen das Außere, wie die empfan-
gende oft gerade vom Draußen angeregt wird.
Nun werden die Verschiedenen verschieden leicht gestört, und, ge-
wiß!, die Selbsterziehung tut manches dabei. Aber so viel ist auch
gewiß: je geringer die äußeren Störungen, je weniger Nervenkraft
wird durch sie verbraucht. Mit andern Worten: je mehr kann auf
die Arbeit selbst verwendet werden. Und so liegt möglichste Ruhe im
Interesse der geistigen Arbeit, und da geistige Arbeit im Interesse
der Allgemeinheit liegt, so liegt auch im Interesse der Allgemeinheit
möglichste Ruhe. Es ist ein bißchen naiv, die Frage zu besprechen,
als stände da bloß ein Rücksichtnehmen auf besonders sensible Leute
in Rede, die einem „imponieren" oder „nicht imponieren" könnten:
es handelt sich nicht bloß um sie, es handelt sich um die höhere oder
niedere, feinere oder gröbere geistige Gesamtleistung eines
Volkes. Und nicht nur um ihre feinsten Spitzen, wenngleich diese
natürlich am leichtesten abgebrochen werden. Etwas geht von der
Anspannung eines jeden durch äußeres Abziehen verloren, also über-
all, wo überhaupt mit geistiger Anspannung gearbeitet wird. Wir
können nur im einzelnen Falle nie feststellen wieviel, bemerken es ja
oft nicht einmal, weil wir an das Stören gewöhnt sind, wissen des-
halb auch gar nicht, wieviel an Oberflächlichkeit und Unsicherheit der
Denkarbeit auf Störungen zurückzuführen ist, wieviel von der oft
beklagten Veräußerlichung unsres Geisteslebens. Aber wir können
mit unwiderleglicher Bestimmtheit sagen: wenn wir an Ruhe ge-
winnen, gewinnen wir an Vertiefung. So gewiß, wie im Leben
überhaupt die zurückhaltenden leiseren Stimmen nicht ohne weiteres
t. Iuniheft VOsl 26t
Leisten sie nicht sogar gerade dnrch die anormale Feinfühligkeit ihrer
Nerven Arbeiten, welche die normalen Nerven nicht leisten können?
Sind nicht auf manchen Gebieten gerade unsre Nervösen zu Pfad-
findern und Führern berufen?
Prüfen wir genauer, so kommen wir auf ein recht einfaches Ver--
hältnis: je feinfühliger ein Organ ist, je feiner kann's eben arbeiten,-
ist es feinfühliger, als bei den meisten Menschenbrüdern sonst, so
kann's also feinere Arbeit liefern, als sie. Wie der Maler mit den
feinsten Augen an diesen Augen auch am empsindlichsten ist, so wird's
wohl mit den übrigen Organen Leibes und der Seele auch sein. Nun
aber ist sehr zu unterscheiden zwischen zweierlei Arbeit, die unser Fritz
Müller unbekümmert zusammenwirft. Wenn Wagner von Meeres-
geheul zu Melodien angeregt ward, so lauschte er der musikalischen
Naturschönheit draußen, wie das Entsprechende Beethoven, wie das
bis zu Richard Strauß ein jeder wirkliche Komponist tat: wenn man
lauschen mag und darf, so stört einen bekanntlich das nicht, worauf
man lauscht, ganz im Gegenteile, es regt einen an, weil es dann der
Tendenz des Geistes entspricht. Das Schopenhauersche Peitschen-
knallen aber hätte auch Wagner ganz sicher nicht „befruchtet", wenn
vor seiner Phantasie Fliegende Holländer-Melodien standen. Es
ist ein Unterschied zwischen empfangender und ausführender Arbeit,
besser gesagt: zwischen Empfangen und Ausführen, denn das Emp-
fangen ist ja überhaupt keine Arbeit. Die ausführende geistige Arbeit
erfordert so gewiß Abschließung gegen das Außere, wie die empfan-
gende oft gerade vom Draußen angeregt wird.
Nun werden die Verschiedenen verschieden leicht gestört, und, ge-
wiß!, die Selbsterziehung tut manches dabei. Aber so viel ist auch
gewiß: je geringer die äußeren Störungen, je weniger Nervenkraft
wird durch sie verbraucht. Mit andern Worten: je mehr kann auf
die Arbeit selbst verwendet werden. Und so liegt möglichste Ruhe im
Interesse der geistigen Arbeit, und da geistige Arbeit im Interesse
der Allgemeinheit liegt, so liegt auch im Interesse der Allgemeinheit
möglichste Ruhe. Es ist ein bißchen naiv, die Frage zu besprechen,
als stände da bloß ein Rücksichtnehmen auf besonders sensible Leute
in Rede, die einem „imponieren" oder „nicht imponieren" könnten:
es handelt sich nicht bloß um sie, es handelt sich um die höhere oder
niedere, feinere oder gröbere geistige Gesamtleistung eines
Volkes. Und nicht nur um ihre feinsten Spitzen, wenngleich diese
natürlich am leichtesten abgebrochen werden. Etwas geht von der
Anspannung eines jeden durch äußeres Abziehen verloren, also über-
all, wo überhaupt mit geistiger Anspannung gearbeitet wird. Wir
können nur im einzelnen Falle nie feststellen wieviel, bemerken es ja
oft nicht einmal, weil wir an das Stören gewöhnt sind, wissen des-
halb auch gar nicht, wieviel an Oberflächlichkeit und Unsicherheit der
Denkarbeit auf Störungen zurückzuführen ist, wieviel von der oft
beklagten Veräußerlichung unsres Geisteslebens. Aber wir können
mit unwiderleglicher Bestimmtheit sagen: wenn wir an Ruhe ge-
winnen, gewinnen wir an Vertiefung. So gewiß, wie im Leben
überhaupt die zurückhaltenden leiseren Stimmen nicht ohne weiteres
t. Iuniheft VOsl 26t